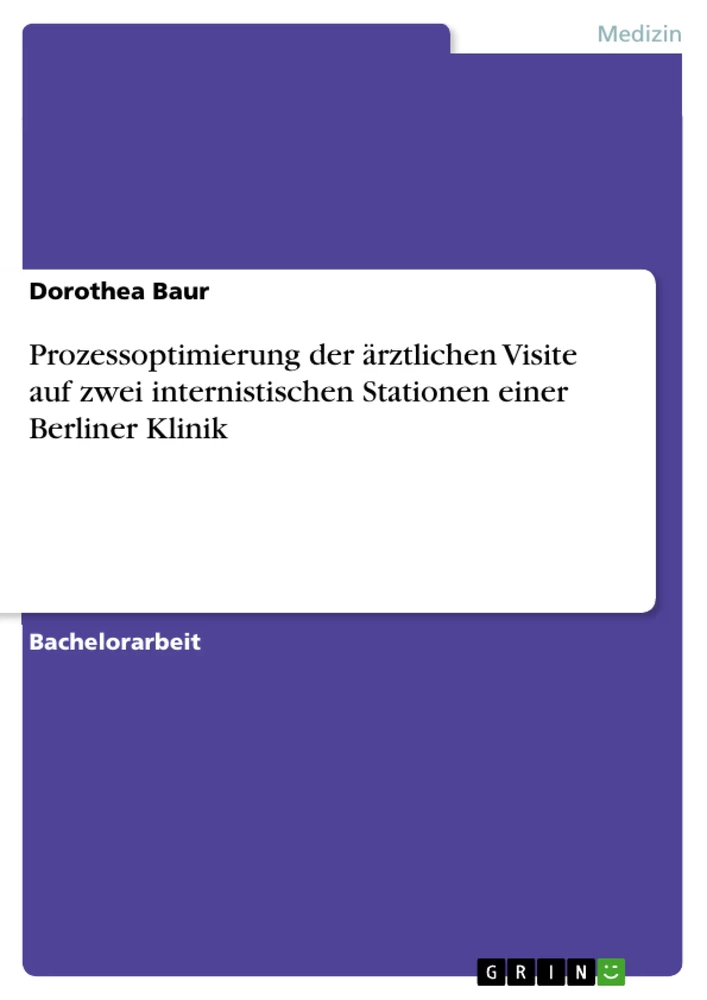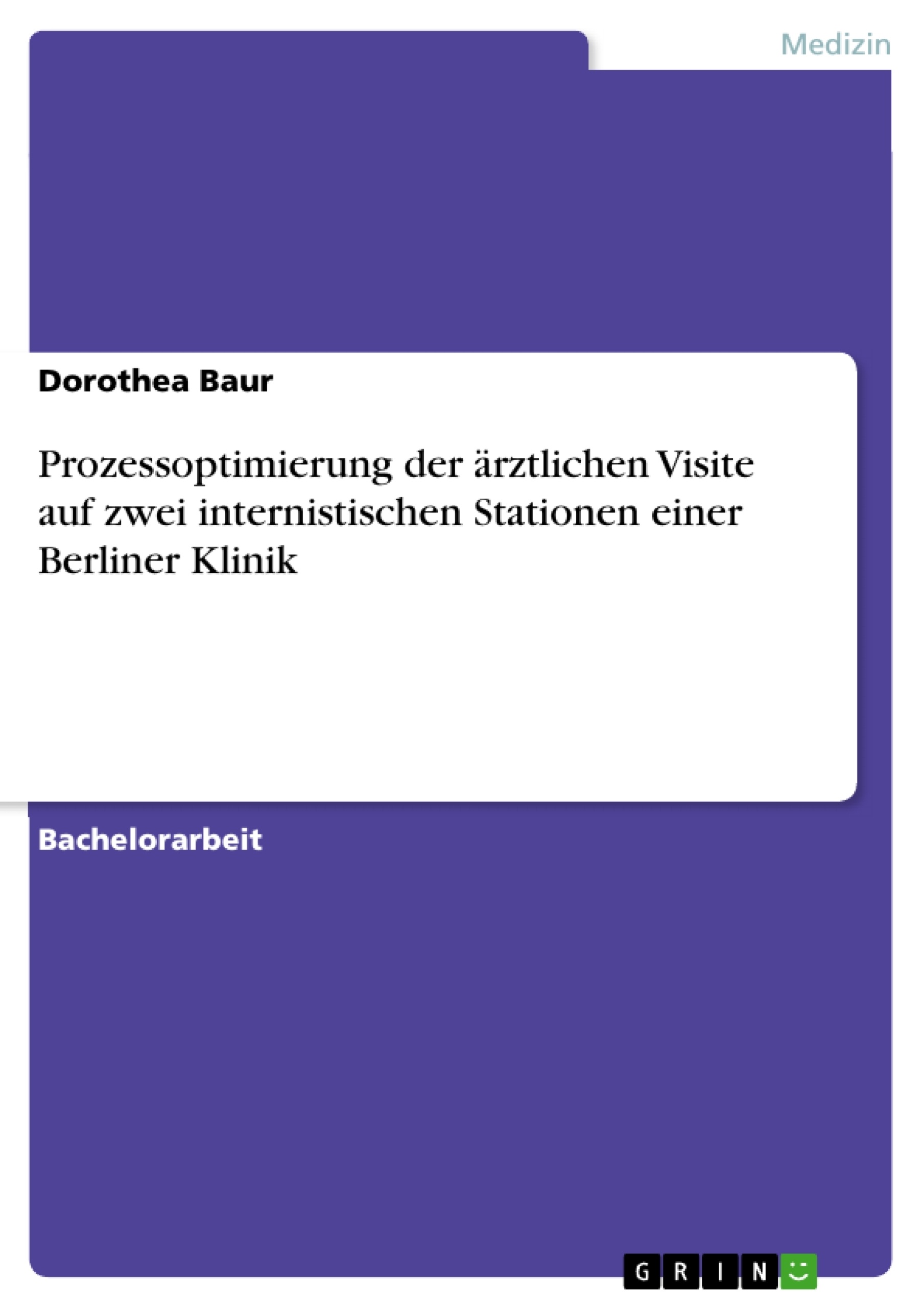Die ärztliche Visite nimmt im klinischen Alltag eine zentrale Rolle ein. Eine möglichst störungsfreie und effiziente Visite stellt einen wichtigen Teilprozess zur optimalen Leistungserbringung dar. Aus dem bisherigen Visitenverlauf auf den untersuchten Stationen ergibt sich Potential zur Prozessoptimierung. Als zentrale Optimierungsfelder im Stationsalltag gelten dabei die geringe Einbindung der Pflegenden in die Visite als auch die Problematik papiergebundener Patientenakten, die während der Visite der Pflege nicht zugänglich sind. Initiiert durch eine Befragung zur Mitarbeiterzufriedenheit in der Pflege, untersucht diese Arbeit die Planung, Organisation und Ablauf der Visite, analysiert Störfaktoren und entwickelt basierend auf den Einschätzungen aller Beteiligten Handlungsempfehlungen, zur Steigerung der Prozessqualität. Den Kern eines effizienten Patientenmanagements bildet die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Ärzten und Pflegefachpersonal. Ein klar strukturierter und präzise beschriebener Prozess der Ärztlichen Visite kann die Qualität der Behandlung verbessern. Gleichzeitig kann die befriedigende Arbeitsgestaltung durch mehr Prozesspartizipation gesteigert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Relevanz des Themas
- 1.2 Ausgangsituation auf den Stationen
- 1.3 Zielsetzung der Arbeit
- 2 Theoretische Einführung
- 2.1 Prozessdefinition
- 2.2 Prozessarten
- 2.3 Qualität von Dienstleistungen
- 3 Ergebnisse
- 3.1 Aufbau Station 1 und 2
- 3.2 Auswertung zeitliche Dokumentation Visitenzeiten Station 1 und 2
- 3.2.1 Auswertung zeitliche Dokumentation der Visitenzeiten Station 1 Bereich a
- 3.2.2 Auswertung zeitliche Dokumentation der Visitenzeiten Station 1 Bereich b
- 3.2.3 Auswertung zeitliche Dokumentation der Visitenzeiten Station 2 Bereich a
- 3.2.4 Auswertung zeitliche Dokumentation der Visitenzeiten Station 2 Bereich b
- 3.3 Auswertung Beobachtungen Station 1 und 2
- 3.3.1 Auswertung Beobachtung Station 1 Bereich a
- 3.3.2 Auswertung Beobachtung Station 1 Bereich b
- 3.3.3 Auswertung Beobachtung Station 2 Bereich a
- 3.3.4 Auswertung Beobachtung Station 2 Bereich b
- 3.3.5 Auswertung der Ergebnisse Experten-Leitfadeninterviews und Gruppeninterviews
- 3.3.6 Auswertung Station 1
- 3.3.7 Auswertung Station 2
- 3.3.8 Handlungsempfehlungen/Prozessoptimierung Station 1 und 2
- 3.3.9 Handlungsempfehlungen/Prozessoptimierung Station 1
- 3.3.10 Handlungsempfehlungen/Prozessoptimierung Station 2
- 4 Diskussion
- 5 Ausblick/Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Prozessoptimierung der ärztlichen Visite auf zwei internistischen Stationen einer Berliner Klinik. Das Hauptziel ist die Identifizierung von Störfaktoren und die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Prozessqualität und der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflegepersonal. Die Arbeit basiert auf einer empirischen Untersuchung mittels Beobachtung, zeitlicher Dokumentation, Experteninterviews und Gruppendiskussionen.
- Analyse der aktuellen Prozesse der ärztlichen Visite
- Identifizierung von Störfaktoren und Ineffizienzen
- Bewertung der interdisziplinären Zusammenarbeit
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Prozessoptimierung
- Verbesserung der Behandlungsqualität und Arbeitszufriedenheit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Prozessoptimierung der ärztlichen Visite ein und beschreibt die Relevanz des Themas im klinischen Alltag. Es beleuchtet die Ausgangssituation auf den untersuchten Stationen und formuliert die Zielsetzung der Arbeit, die auf der Verbesserung der Effizienz und Qualität der Visite durch Optimierung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflegepersonal beruht.
2 Theoretische Einführung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert den Begriff "Prozess" und beschreibt verschiedene Prozessarten. Es werden relevante Forschungsmethoden vorgestellt, die in der empirischen Untersuchung zum Einsatz kommen, sowie die Qualitätsmerkmale von Dienstleistungen im Kontext der ärztlichen Visite. Die Kapitelstruktur dient dabei der systematischen Einordnung der angewandten Methoden in den theoretischen Rahmen.
3 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es beschreibt den Aufbau der beiden untersuchten Stationen und analysiert die erhobenen Daten aus der zeitlichen Dokumentation der Visitenzeiten, den Beobachtungen der Visiten, den Experteninterviews mit den Stationsärzten und den Gruppendiskussionen mit dem Pflegepersonal. Die Ergebnisse werden sowohl für jede Station einzeln als auch vergleichend dargestellt. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden schließlich konkrete Handlungsempfehlungen für die Prozessoptimierung abgeleitet.
4 Diskussion: (Dieses Kapitel wird aufgrund der Anweisung, keine Zusammenfassung des Schlusskapitels zu liefern, nicht zusammengefasst.)
Schlüsselwörter
Ärztliche Visite, Prozessoptimierung, Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Pflegepersonal, Stationsärzte, Empirische Sozialforschung, Behandlungsqualität, Handlungsempfehlungen, Prozessqualität, Stationsmanagement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Prozessoptimierung der ärztlichen Visite
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Prozessoptimierung der ärztlichen Visite auf zwei internistischen Stationen einer Berliner Klinik. Das Hauptziel ist die Identifizierung von Störfaktoren und die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Prozessqualität und der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflegepersonal.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer empirischen Untersuchung mittels Beobachtung, zeitlicher Dokumentation der Visitenzeiten, Experteninterviews mit den Stationsärzten und Gruppendiskussionen mit dem Pflegepersonal.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretische Einführung, Ergebnisse, Diskussion und Ausblick/Fazit. Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas und die Zielsetzung dar. Die theoretische Einführung definiert relevante Begriffe wie "Prozess" und beschreibt verschiedene Prozessarten sowie Qualitätsmerkmale von Dienstleistungen. Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert die empirischen Befunde, während die Diskussion diese interpretiert. Der Ausblick/Fazit rundet die Arbeit ab.
Was sind die zentralen Themenschwerpunkte?
Zentrale Themen sind die Analyse der aktuellen Prozesse der ärztlichen Visite, die Identifizierung von Störfaktoren und Ineffizienzen, die Bewertung der interdisziplinären Zusammenarbeit, die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Prozessoptimierung und die Verbesserung der Behandlungsqualität und Arbeitszufriedenheit.
Wie sind die Ergebnisse strukturiert?
Das Kapitel "Ergebnisse" analysiert den Aufbau der beiden Stationen und präsentiert detaillierte Auswertungen der zeitlichen Dokumentation der Visitenzeiten und der Beobachtungen. Es beinhaltet separate Auswertungen für jeden Bereich der beiden Stationen und die Auswertung der Experten-Leitfadeninterviews und Gruppeninterviews. Schliesslich werden konkrete Handlungsempfehlungen für die Prozessoptimierung abgeleitet, sowohl für jede Station einzeln als auch gemeinsam.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ärztliche Visite, Prozessoptimierung, Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Pflegepersonal, Stationsärzte, Empirische Sozialforschung, Behandlungsqualität, Handlungsempfehlungen, Prozessqualität, Stationsmanagement.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der Kapitel gibt einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels. Detaillierte Informationen finden sich im vollständigen Text der Bachelorarbeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Effizienz und Qualität der ärztlichen Visite durch Optimierung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflegepersonal zu verbessern.
- Quote paper
- Dorothea Baur (Author), 2016, Prozessoptimierung der ärztlichen Visite auf zwei internistischen Stationen einer Berliner Klinik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355609