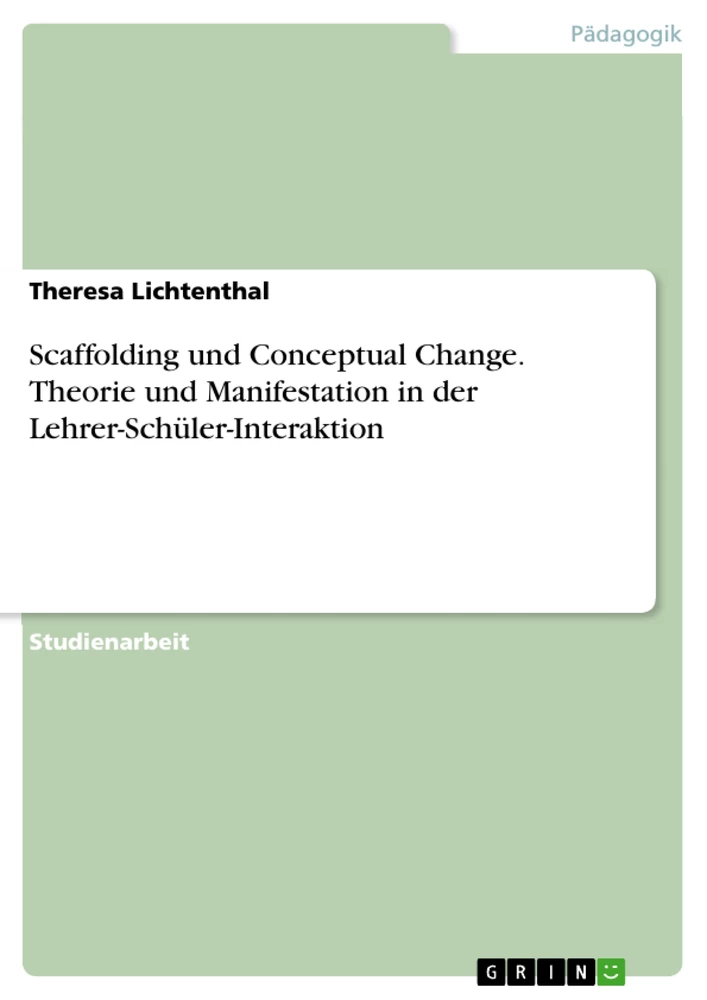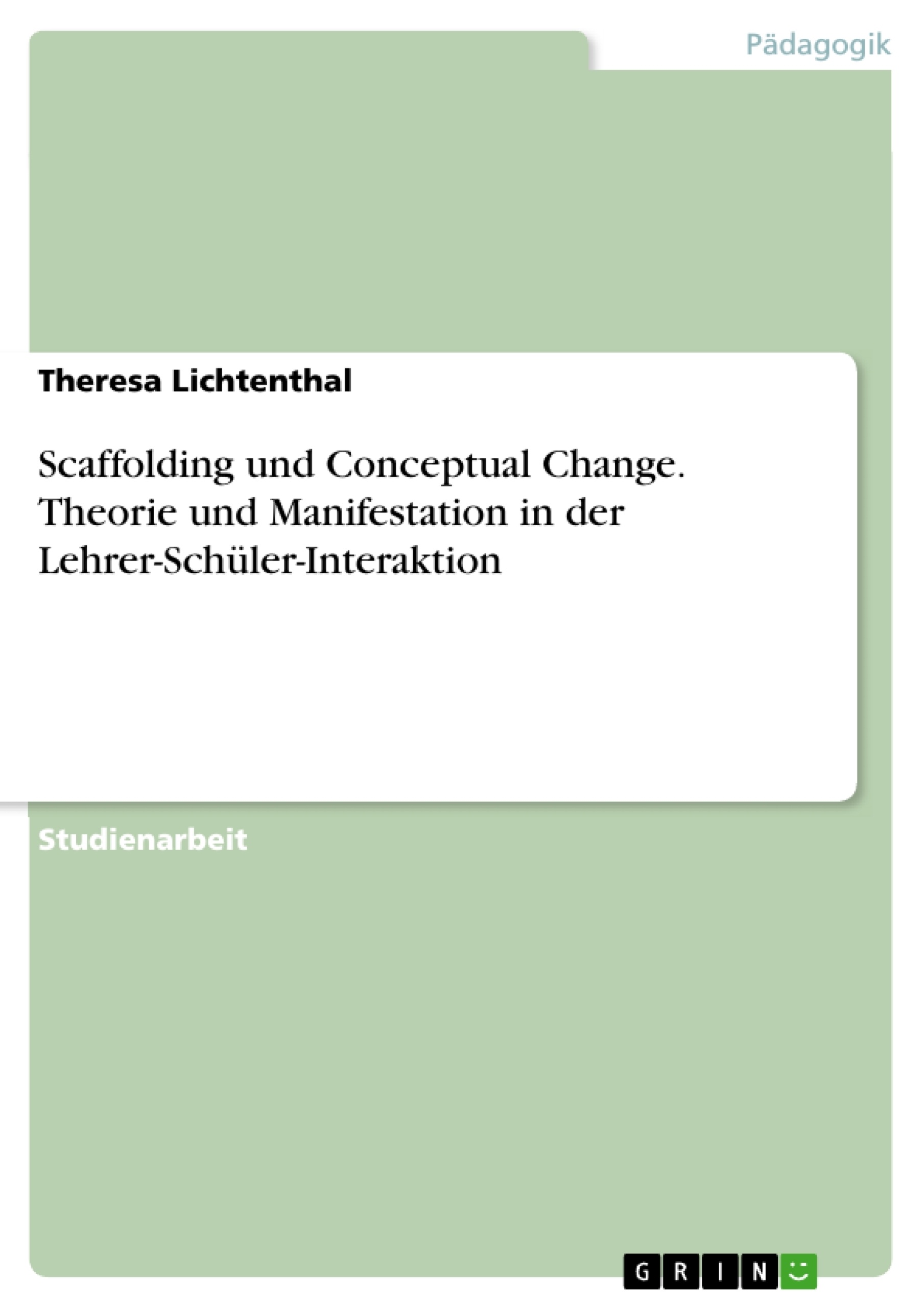In dieser Arbeit soll eine Unterrichtssequenz des Sachunterrichts einer dritten Klasse betrachtet werden, die vor dem Hintergrund zweier konstruktivistischer Lerntheorien, Scaffolding und Conceptual Change, analysiert werden soll. Anders als bei behavioristischen oder kognitiven Theorien steht bei den betrachteten konstruktivistischen Theorien nicht Wissen, das durch den Lehrer an die Schüler herangetragen wird, im Zentrum. Es geht vielmehr um die Lernenden selbst, die neue Phänomene selbstständig entdecken und erklären. Thema der Unterrichtsstunde ist eine Stationenarbeit zum Thema Auftrieb. Die Schüler befassen sich mit der Fragestellung, wie Wasser sich verhält, wenn man einen Gegenstand eintaucht.
Der Teilrahmenplan Grundschule Rheinland-Pfalz gibt bei der Ausführung des Lernbereichs Sachunterricht bekannt, dass Kinder eine „natürliche Neugierde“ sowie einen „Forschergeist“ mit in den Unterricht bringen. Ihr Interesse sei außerdem auf die „Erkundung von Sachverhalten und Mechanismen“ gerichtet und sie entdeckten ihre „besonderen Interessen und Neigungen am besten, wenn der Sachunterricht die Möglichkeit […] zum Entdecken, Forschen und Lernen“ gebe. (vgl. MINISTERIUM FÜR BILDUNG, FRAUEN UND JUGEND 2006, 3). Dabei spielen Versuche und Experimente eine zentrale Rolle.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- I. Einleitung
- II. Theorieteil
- II.1. Scaffolding
- II.2. Conceptual Change
- II.3. Diskussion der beiden Theorien
- III. Manifestation von Scaffolding und Conceptual Change in der Lehrer-Schüler-Interaktion
- III.1. Kurze Darstellung der Unterrichtssituation (Transkript)
- III.2. Analyse der Unterrichtssituation vor dem Hintergrund der Theorien
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert eine Unterrichtssequenz des Sachunterrichts einer dritten Klasse aus der Perspektive zweier konstruktivistischer Lerntheorien: Scaffolding und Conceptual Change. Ziel ist es, die Anwendung dieser Theorien in einer konkreten Unterrichtssituation zu beleuchten und die Bedeutung von Schüleraktivität und selbstständigem Lernen zu verdeutlichen.
- Scaffolding als Unterstützung des Schülers durch den Lehrer im Lernprozess
- Conceptual Change als Prozess der Umstrukturierung von Alltagsvorstellungen zu wissenschaftlichen Konzepten
- Die Rolle von Experimenten und handlungsorientiertem Unterricht im Sachunterricht
- Die Bedeutung des individuellen Wissensstandes des Schülers für den Unterrichtserfolg
- Die Anwendung der Theorien in der Praxis mit Bezug auf eine konkrete Unterrichtssituation zum Thema Auftrieb
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die grundlegende Problemstellung der Arbeit vor und führt in das Thema der Unterrichtssequenz zum Thema Auftrieb ein. Der Theorieteil behandelt die beiden konstruktivistischen Lerntheorien Scaffolding und Conceptual Change, die in dieser Arbeit als analytischer Rahmen dienen. Das Kapitel "Manifestation von Scaffolding und Conceptual Change in der Lehrer-Schüler-Interaktion" analysiert eine konkrete Unterrichtssituation mit Bezug auf die beiden Theorien.
Schlüsselwörter (Keywords)
Scaffolding, Conceptual Change, Konstruktivismus, Lerntheorien, Sachunterricht, Lehrer-Schüler-Interaktion, Auftrieb, experimenteller Unterricht, handlungsorientierter Unterricht, Wissenschaftsdidaktik, Präkonzepte, Postkonzepte, Alltagsvorstellungen, wissenschaftliche Konzepte.
- Quote paper
- Theresa Lichtenthal (Author), 2016, Scaffolding und Conceptual Change. Theorie und Manifestation in der Lehrer-Schüler-Interaktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355066