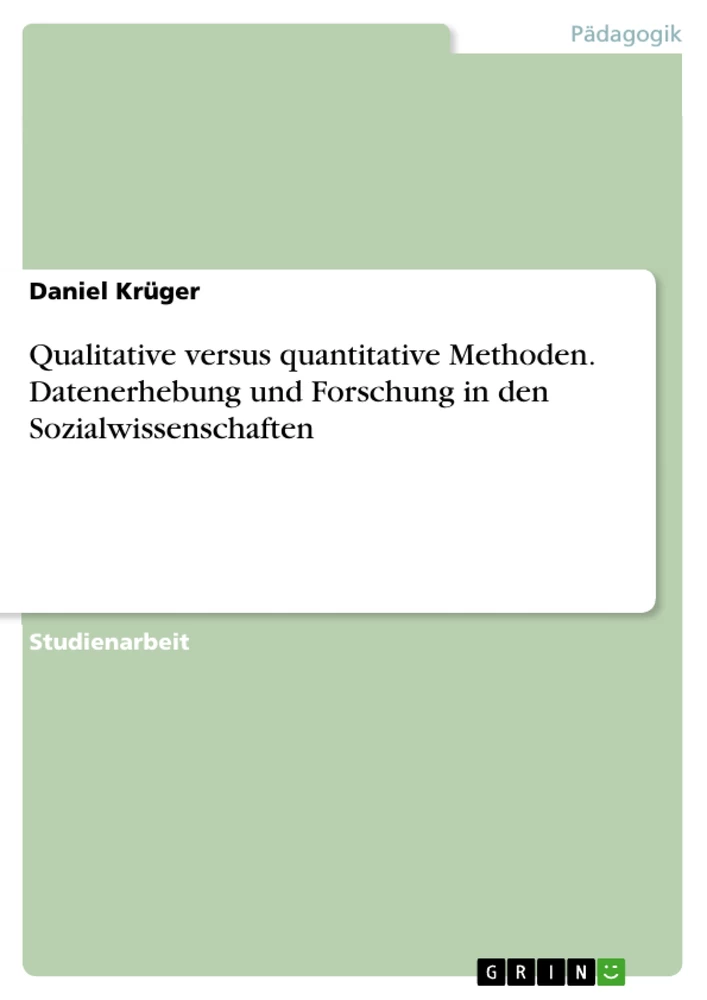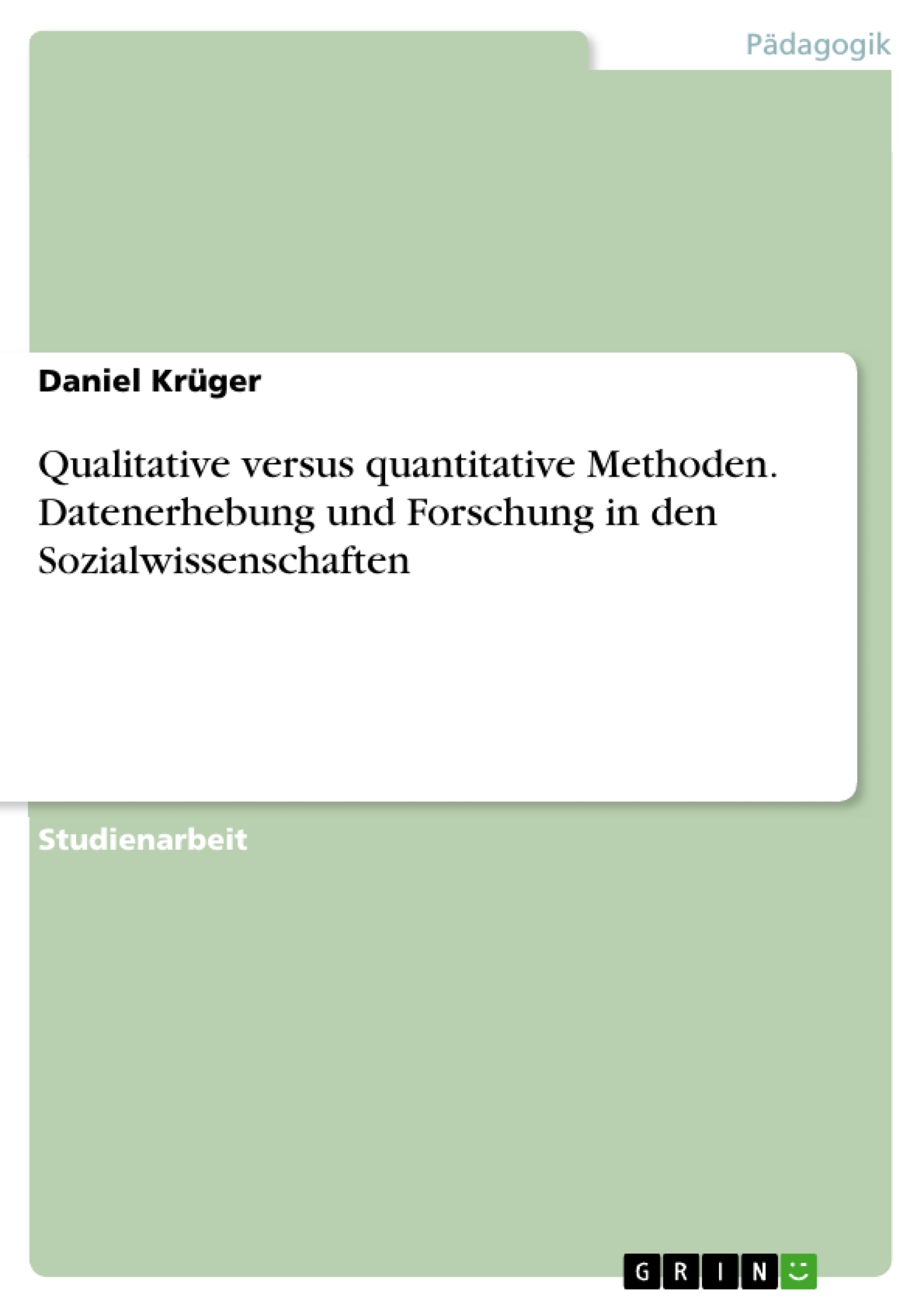Diese Arbeit soll dazu dienen, prägnant die gängigsten Forschungsmethoden in der empirischen Sozialforschung gegenüberzustellen und Grenzen der Einsatzspektren kritisch zu hinterfragen. Im Fazit soll auf wichtige Kritikpunkte der Sozialforschung eingegangen werden, außerdem wird ein Ausblick auf dominante Forschungstrends in der Sozialforschung und die mit ihr eng verwobenen Berufs- und Wirtschaftspädagogik gegeben werden.
Die Sozialforschung erforscht den Untersuchungsgegenstand „soziale Welt“. Diese Welt grenzt sich von der „natürlichen Welt“, also der Welt der Naturwissenschaften, dadurch ab, dass im Fokus der Untersuchung humane Akteure, in Einzelform (Individuen) oder soziale Gruppen stehen. Weiter ist im Wesentlichen darin zu differenzieren, dass aufgrund des natürlichen Vorkommens der Untersuchungsobjekte in ihrem sozialen Umfeld, die Theoriebildung von oftmals nahezu beliebig vielfältigem Einfluss weiterer Faktoren und Aspekte abhängt. Daher wird die Sozialforschung im Prinzip als empirisch bzw. quantitativ (etwas zählend) und qualitativ (etwas messend) unterteilt.
Als empirisch gilt Wissen immer dann, wenn es gegenüber einem vorhandenen oder anerkannten System überprüfbar ist. Empirische Aussagen bedürfen immer erst einer statistischen Überprüfung, damit jene als tragfähig gelten. Dahingegen dienen qualitative Untersuchungen zum Gewinn von Erkenntnissen in der Einzelfallforschung. Diese ist auch oftmals die Basis für die Bildung neuer Hypothesen sowie Grundlage für die Initiierung neuer Forschungsprojekte. Während in der Naturwissenschaft deterministisch beschreibbare Vorgänge mit allgemeiner Gültigkeit einen Anspruch haben, überall im Universum zu gelten, ist die Übertragung sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse auf die Realität gemäß der Ansicht der Empiriker nur zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit möglich. Daher ist es Schwerpunkt der qualitativen Sozialforschung, individuelle Hintergründe bzw. Phänomene im Detail zu beschreiben bzw. zu erfassen. Damit einher geht diese Forschungsaktivität mit einem stetig andauernden Methodenstreit, dessen Zwischenkonsens sicherlich auch zur Gründung der empirischen Forschung beigetragen hat. Letztlich hat sich aber hinsichtlich der Nützlichkeit für die Forschung oftmals ein Methodenmix bewährt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Klassifizierung von Forschungsmethoden
- 2.1 Methoden zur Datensammlung
- 3. Fazit
- 4. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, gängige Forschungsmethoden in der empirischen Sozialforschung gegenüberzustellen und deren Einsatzgrenzen kritisch zu hinterfragen. Sie beleuchtet den Methodenstreit zwischen qualitativen und quantitativen Ansätzen und skizziert dominante Forschungstrends in der Sozialforschung und angrenzenden Bereichen wie Berufs- und Wirtschaftspädagogik.
- Gegenüberstellung quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden
- Kritisches Hinterfragen der Einsatzgrenzen von Forschungsmethoden
- Analyse des Methodenstreits in der Sozialforschung
- Dominante Forschungstrends in der Sozialforschung und angrenzenden Disziplinen
- Methoden zur Datensammlung in der quantitativen Sozialforschung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Sozialforschung ein und differenziert zwischen der "sozialen Welt" und der "natürlichen Welt". Sie hebt die Herausforderungen der Theoriebildung in der Sozialforschung aufgrund vielfältiger Einflussfaktoren hervor und unterteilt die Sozialforschung in empirische, quantitative und qualitative Ansätze. Die Einleitung betont die Bedeutung der empirischen Überprüfung und den Unterschied zwischen quantitativen Untersuchungen, die auf Generalisierbarkeit abzielen, und qualitativen Untersuchungen, die individuelle Hintergründe und Phänomene im Detail erfassen. Der Methodenstreit wird angesprochen, und es wird die Nützlichkeit eines Methodenmixes für die Forschung hervorgehoben. Die Arbeit selbst wird als Gegenüberstellung gängiger Forschungsmethoden mit kritischer Hinterfragung der Einsatzspektren vorgestellt, mit einem Ausblick auf Kritikpunkte und dominante Forschungstrends.
2. Klassifizierung von Forschungsmethoden: Dieses Kapitel klassifiziert gängige Forschungsmethoden der Sozialforschung und präsentiert diese als bipolare Dimensionen (quantitativ/qualitativ), anstatt einer strikten Dichotomie. Es erklärt Gegensatzpaare wie nomothetisch/ideografisch, Labor/Feld, deduktiv/induktiv, und erläutert die Herausforderungen und potenziellen Verzerrungen bei der Anwendung dieser Methoden. Das Kapitel betont die Bedeutung der Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität) bei quantitativen Methoden und die Anwendung von Postulaten wie Mayrings dreizehn Säulen des qualitativen Denkens zur Qualitätssicherung. Es wird die Unterscheidung zwischen Induktion und Deduktion erklärt und der Unterschied zwischen "Erklären" und "Verstehen" in der Forschung diskutiert, wobei die Kritik der qualitativen Sozialforschung an einem mechanistischen Menschenbild in quantitativen Ansätzen herausgestellt wird.
2.1 Methoden zur Datensammlung: Dieses Kapitel beschreibt Methoden zur Datensammlung, die sowohl für quantitative als auch qualitative Forschung verwendet werden können, wobei der quantitative Nutzen im Vordergrund steht. Es werden Befragungen (schriftlich, mündlich, Leitfadeninterviews, Fragebögen) und Beobachtungen (systematisch/unsystematisch, verdeckt/offen, teilnehmend/nicht teilnehmend) behandelt. Die Herausforderungen bei Befragungen, insbesondere bei offenen Fragen, bezüglich der Vergleichbarkeit der Aussagen werden hervorgehoben. Die Beobachtung wird in die Phasen Wahrnehmung, Beschreibung und Interpretation unterteilt und ein Beispiel für den Einsatz bei der Erprobung von Unterrichtsmethoden genannt.
Schlüsselwörter
Qualitative Methoden, quantitative Methoden, Sozialforschung, Methodenstreit, empirische Forschung, Datensammlung, Befragung, Beobachtung, Gütekriterien, Induktion, Deduktion, Nomothetisch, Ideografisch, Forschungsdesign, Methodenmix, Berufs- und Wirtschaftspädagogik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Forschungsmethoden in der empirischen Sozialforschung
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über Forschungsmethoden in der empirischen Sozialforschung. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf dem Vergleich und der kritischen Auseinandersetzung mit quantitativen und qualitativen Forschungsansätzen, einschließlich der Methoden zur Datensammlung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, gängige Forschungsmethoden gegenüberzustellen und deren Einsatzgrenzen kritisch zu hinterfragen. Sie beleuchtet den Methodenstreit zwischen qualitativen und quantitativen Ansätzen und skizziert dominante Forschungstrends in der Sozialforschung und angrenzenden Bereichen wie Berufs- und Wirtschaftspädagogik.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Gegenüberstellung quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden, kritisches Hinterfragen der Einsatzgrenzen von Forschungsmethoden, Analyse des Methodenstreits in der Sozialforschung, dominante Forschungstrends in der Sozialforschung und angrenzenden Disziplinen sowie Methoden zur Datensammlung in der quantitativen Sozialforschung.
Wie werden die Forschungsmethoden klassifiziert?
Die Arbeit klassifiziert Forschungsmethoden als bipolare Dimensionen (quantitativ/qualitativ), anstatt einer strikten Dichotomie. Es werden Gegensatzpaare wie nomothetisch/ideografisch, Labor/Feld und deduktiv/induktiv erläutert, sowie die Herausforderungen und potenziellen Verzerrungen bei der Anwendung dieser Methoden diskutiert. Die Bedeutung der Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität) bei quantitativen Methoden und die Anwendung von Postulaten zur Qualitätssicherung bei qualitativen Methoden werden hervorgehoben.
Welche Methoden der Datensammlung werden beschrieben?
Das Kapitel zur Datensammlung beschreibt Befragungen (schriftlich, mündlich, Leitfadeninterviews, Fragebögen) und Beobachtungen (systematisch/unsystematisch, verdeckt/offen, teilnehmend/nicht teilnehmend). Die Herausforderungen bei Befragungen, insbesondere bei offenen Fragen, bezüglich der Vergleichbarkeit der Aussagen werden ebenso beleuchtet wie die Unterteilung der Beobachtung in Wahrnehmung, Beschreibung und Interpretation.
Was ist der Unterschied zwischen quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden?
Quantitative Untersuchungen zielen auf Generalisierbarkeit ab, während qualitative Untersuchungen individuelle Hintergründe und Phänomene im Detail erfassen. Die Arbeit betont die Nützlichkeit eines Methodenmixes und diskutiert die Kritik der qualitativen Sozialforschung an einem mechanistischen Menschenbild in quantitativen Ansätzen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Qualitative Methoden, quantitative Methoden, Sozialforschung, Methodenstreit, empirische Forschung, Datensammlung, Befragung, Beobachtung, Gütekriterien, Induktion, Deduktion, Nomothetisch, Ideografisch, Forschungsdesign, Methodenmix, Berufs- und Wirtschaftspädagogik.
Wie wird die Einleitung strukturiert?
Die Einleitung führt in die Thematik der Sozialforschung ein, differenziert zwischen der "sozialen Welt" und der "natürlichen Welt", hebt die Herausforderungen der Theoriebildung hervor und unterteilt die Sozialforschung in empirische, quantitative und qualitative Ansätze. Sie betont die Bedeutung der empirischen Überprüfung und den Unterschied zwischen quantitativen und qualitativen Untersuchungen.
Was wird im Kapitel zur Klassifizierung von Forschungsmethoden behandelt?
Dieses Kapitel klassifiziert gängige Forschungsmethoden und präsentiert diese als bipolare Dimensionen. Es erklärt Gegensatzpaare wie nomothetisch/ideografisch, Labor/Feld, deduktiv/induktiv und erläutert die Herausforderungen und potenziellen Verzerrungen. Die Bedeutung der Gütekriterien bei quantitativen Methoden und die Anwendung von Postulaten zur Qualitätssicherung bei qualitativen Methoden werden hervorgehoben. Der Unterschied zwischen "Erklären" und "Verstehen" in der Forschung wird diskutiert.
- Quote paper
- B.Eng. Daniel Krüger (Author), 2017, Qualitative versus quantitative Methoden. Datenerhebung und Forschung in den Sozialwissenschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354789