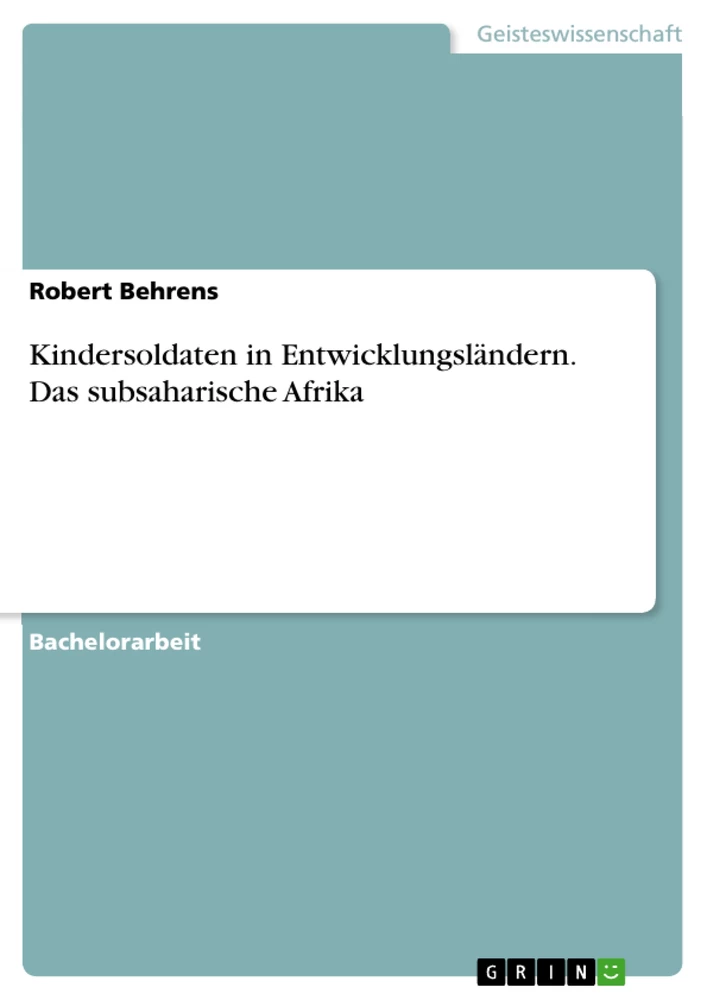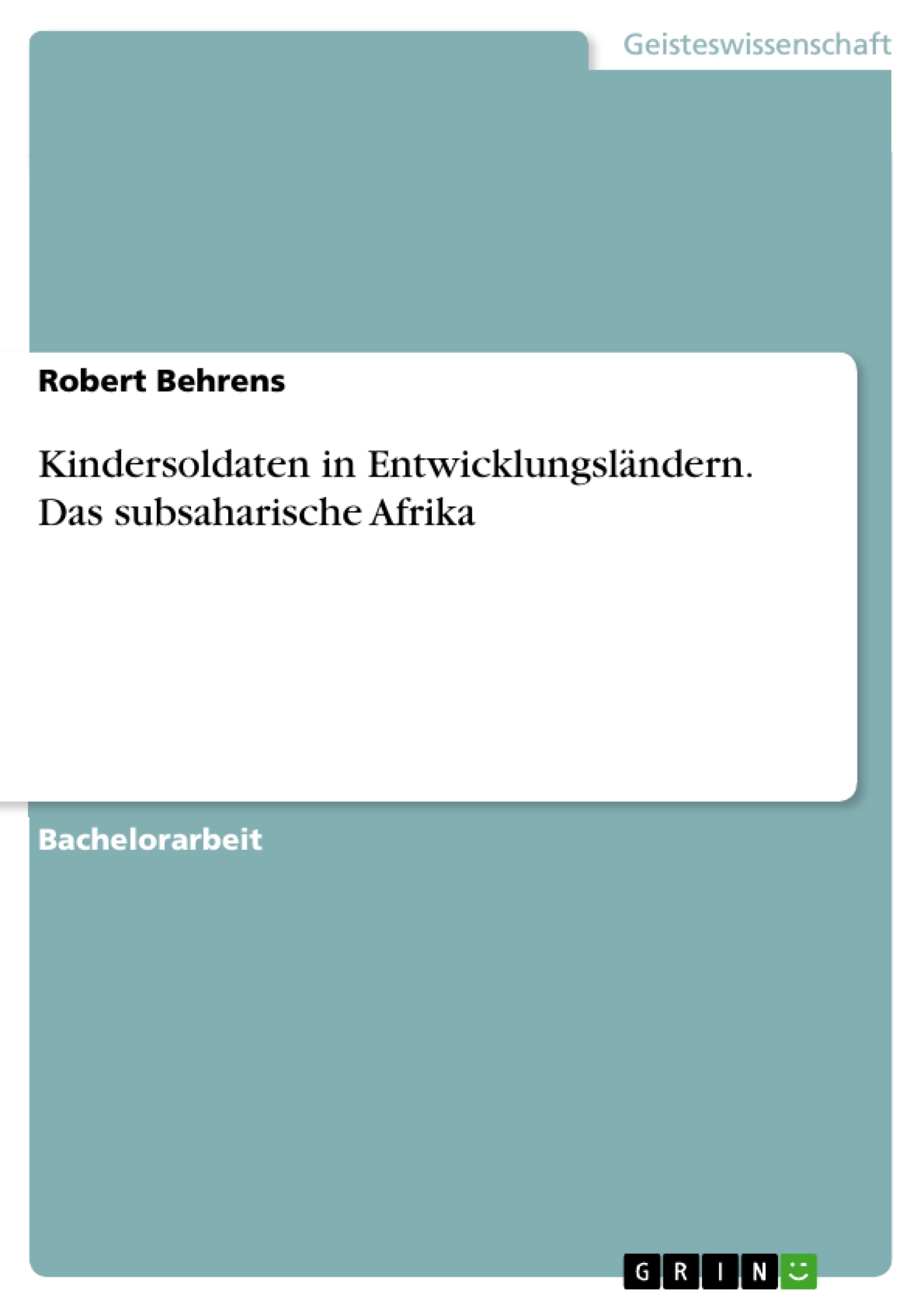Kinder auf der ganzen Welt leiden unter den schrecklichen Folgen von Kriegen und bewaffneten Auseinandersetzungen. Flucht, Hunger, Unterernährung, Krankheit, fehlender Ausbildung, Verlust von Familienmitgliedern, eigene Verletzungen (physisch, psychisch) und sexueller Missbrauch, das sind Dinge, mit denen überlebende Kinder zurechtkommen müssen. Nach Angaben von Olara Otunnu gab es außerdem allein zwischen den Jahren 1990 und 2000 etwa zwei Millionen Kinder, die an den Folgen von Kriegen und anderen bewaffneten Konflikten verstorben sind.
Besonders schockierend ist in diesem Zusammenhang die Situation von Kindersoldaten, also Kindern, die in bewaffneten Konflikten nicht nur zu Opfern, sondern auch zu Tätern gemacht werden. Sie nehmen direkt am Kriegsgeschehen teil und sind den obig genannten Gefahren des Krieges daher im besonderen Maße ausgesetzt. Zudem gehen die physischen und psychischen Folgen des Daseins als Kindersoldat noch über die obig genannten Auswirkungen eines Krieges hinaus. Trotz zahlreicher Bemühungen mittels des Völkerrechts Instrumentarien zu schaffen, die den Einsatz von Kindern in kriegerischen Konflikten verhindern, werden aktuell weltweit schätzungsweise bis zu 300.000 Kinder als Soldaten eingesetzt.
Vor diesem Hintergrund soll in der Arbeit untersucht werden, wie das Phänomen der Kindersoldaten wirksam bekämpft werden kann und worin momentan die Schwierigkeit besteht, die Zahl neuer Rekrutierungen von Kindersoldaten zu vermindern.
Die Arbeit ist hierzu in zwei große Themenschwerpunkte gegliedert worden. Kapitel drei bis sechs ordnen die Problematik in den Kontext von Forschung (Kapitel 2), Geographie (Kapitel 3), Demographie (Kapitel 4), Kindheitsdefinition (Kapitel 5) und Kinderarbeit (Kapitel 6) ein. Das Phänomen der Kindersoldaten tritt zwar weltweit auf. Die Untersuchung begrenzt sich jedoch auf den Raum des subsaharischen Afrika. Als Beispiele werden Sierra Leone und Uganda herangezogen, da aus den beiden Ländern eine Vielzahl von Erlebnisberichten vorliegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand
- 3. Geographischer Hintergrund
- 4. Demographischer Hintergrund
- 5. Definition Kindheit
- 5.1 Wandel des Verständnisses von Kindheit
- 5.2 Völkerrechtliche Definition
- 6. Kinderarbeit
- 6.1 Definition Kinderarbeit
- 6.2 Ursachen
- 7. Kindersoldaten
- 7.1 Definition Kindersoldaten
- 7.2 Einsatzorte Kindersoldaten
- 7.3 Ursachen
- 7.3.1 Kriege und bewaffnete Konflikte
- 7.3.2 Problematik der Kleinwaffen
- 7.4 Rekrutierung
- 7.5 Tätigkeiten der Kindersoldaten
- 7.6 Rolle der Mädchen
- 7.6.1 Sexuelle Ausbeutung
- 7.7 Folgeerscheinungen des Daseins als Kindersoldat
- 7.8 Demobilisierung und Reintegration
- 8. Schlussfolgerungen und Handlungsbedarf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Phänomen Kindersoldaten in Entwicklungsländern, insbesondere im subsaharischen Afrika. Ziel ist es, die Ursachen, Folgen und Herausforderungen der Reintegration von Kindersoldaten zu beleuchten. Die Arbeit analysiert den Kontext, in dem Kinder rekrutiert werden, und die langfristigen Auswirkungen dieser Erfahrung auf die Betroffenen.
- Definition und Wandel des Kinderbegriffs
- Ursachen für die Rekrutierung von Kindersoldaten
- Folgen der Rekrutierung für die Kinder
- Herausforderungen bei der Demobilisierung und Reintegration
- Der geografische und demografische Kontext im subsaharischen Afrika
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Kindersoldaten ein und beschreibt die Relevanz der Thematik. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die Forschungsfrage. Es wird die Bedeutung des subsaharischen Afrikas als Schwerpunktregion erläutert und die methodische Vorgehensweise kurz angerissen.
2. Forschungsstand: Dieses Kapitel präsentiert einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Kindersoldaten. Es werden wichtige Studien und Publikationen vorgestellt, die sich mit den Ursachen, Folgen und Strategien zur Bekämpfung des Problems auseinandersetzen. Der Fokus liegt auf der Analyse bereits existierender Literatur und der Identifizierung von Forschungslücken.
3. Geographischer Hintergrund: Das Kapitel liefert einen geographischen Überblick über das subsaharische Afrika, die Regionen, die von bewaffneten Konflikten besonders betroffen sind, und deren spezifischen geografischen Herausforderungen, die die Rekrutierung von Kindersoldaten beeinflussen können (z.B. schwieriges Gelände, schwache staatliche Kontrolle). Es dient als Grundlage für die anschließende Analyse.
4. Demographischer Hintergrund: Dieses Kapitel analysiert den demografischen Kontext im subsaharischen Afrika, indem es Faktoren wie hohe Geburtenraten, niedrige Lebenserwartung und die Altersstruktur der Bevölkerung untersucht. Es wird der Zusammenhang zwischen diesen demografischen Faktoren und der Anfälligkeit von Kindern für Rekrutierung in bewaffnete Gruppen beleuchtet.
5. Definition Kindheit: Das Kapitel definiert den Begriff „Kindheit“ und analysiert den Wandel seines Verständnisses im Laufe der Zeit und in verschiedenen kulturellen Kontexten. Es wird der Unterschied zwischen den völkerrechtlichen Definitionen und den in bestimmten Regionen geltenden Auffassungen von Kindheit diskutiert, um die Komplexität des Themas zu verdeutlichen.
6. Kinderarbeit: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Thema Kinderarbeit, definiert den Begriff und untersucht die Ursachen für Kinderarbeit. Es wird der Zusammenhang zwischen Kinderarbeit und der Rekrutierung von Kindersoldaten erörtert und analysiert, wie Kinderarbeit Kinder vulnerabler für die Rekrutierung macht.
7. Kindersoldaten: Dieser Abschnitt beleuchtet umfassend die Thematik Kindersoldaten. Es wird die Definition, die Einsatzorte, die Ursachen der Rekrutierung (Kriege, Kleinwaffenverbreitung), die Tätigkeiten der Kindersoldaten sowie die besondere Rolle der Mädchen, inklusive sexueller Ausbeutung, eingehend analysiert. Die langfristigen Folgen des Daseins als Kindersoldat und die Herausforderungen der Demobilisierung und Reintegration bilden den Schlusspunkt dieses Kapitels. Der Abschnitt synthetisiert die Ergebnisse der vorangegangenen Kapitel und bietet eine detaillierte Betrachtung der komplexen Problematik.
Schlüsselwörter
Kindersoldaten, subsaharisches Afrika, bewaffnete Konflikte, Kinderrechte, Rekrutierung, Demobilisierung, Reintegration, Kinderarbeit, demografischer Wandel, Entwicklungsländer, Völkerrecht, sexuelle Ausbeutung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Kindersoldaten im subsaharischen Afrika
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht das Phänomen Kindersoldaten in Entwicklungsländern, insbesondere im subsaharischen Afrika. Sie beleuchtet die Ursachen, Folgen und Herausforderungen der Reintegration von Kindersoldaten und analysiert den Kontext ihrer Rekrutierung sowie die langfristigen Auswirkungen dieser Erfahrung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Wandel des Kinderbegriffs, Ursachen für die Rekrutierung von Kindersoldaten, Folgen der Rekrutierung für die Kinder, Herausforderungen bei der Demobilisierung und Reintegration, sowie den geografischen und demografischen Kontext im subsaharischen Afrika. Zusätzlich werden Kinderarbeit und die Rolle der Mädchen, inklusive sexueller Ausbeutung, untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Forschungsstand, geographischer Hintergrund, demografischer Hintergrund, Definition Kindheit, Kinderarbeit, Kindersoldaten und Schlussfolgerungen und Handlungsbedarf. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas Kindersoldaten, beginnend mit einer allgemeinen Einführung und einem Überblick über den aktuellen Forschungsstand, gefolgt von einer detaillierten Analyse des geographischen und demografischen Kontextes im subsaharischen Afrika. Die Definition von "Kindheit" und der Zusammenhang mit Kinderarbeit werden ebenfalls behandelt, bevor das Kapitel über Kindersoldaten die Ursachen, Folgen und die Reintegrationsproblematik umfassend analysiert.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine Analyse des aktuellen Forschungsstandes zu Kindersoldaten. Die methodische Vorgehensweise wird in der Einleitung kurz angerissen, die genaue Methode ist jedoch nicht im Preview spezifiziert.
Welche konkreten Fragen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht die Ursachen der Rekrutierung von Kindersoldaten, die Folgen der Rekrutierung für die Kinder (inklusive der besonderen Situation von Mädchen und sexueller Ausbeutung) und die Herausforderungen bei der Demobilisierung und Reintegration. Sie analysiert den geographischen und demografischen Kontext im subsaharischen Afrika und den Wandel des Verständnisses von Kindheit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kindersoldaten, subsaharisches Afrika, bewaffnete Konflikte, Kinderrechte, Rekrutierung, Demobilisierung, Reintegration, Kinderarbeit, demografischer Wandel, Entwicklungsländer, Völkerrecht, sexuelle Ausbeutung.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen und der Handlungsbedarf werden im letzten Kapitel (Kapitel 8) dargestellt, der konkrete Inhalt ist jedoch im Preview nicht detailliert aufgeführt.
Auf welche Regionen konzentriert sich die Arbeit?
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem subsaharischen Afrika, mit einer Analyse der geographischen und demografischen Faktoren, die die Rekrutierung von Kindersoldaten beeinflussen.
Wie wird der Begriff „Kindheit“ in der Arbeit definiert?
Kapitel 5 definiert den Begriff „Kindheit“ und analysiert seinen Wandel im Laufe der Zeit und in verschiedenen kulturellen Kontexten. Es wird der Unterschied zwischen den völkerrechtlichen Definitionen und den in bestimmten Regionen geltenden Auffassungen diskutiert.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Kinderarbeit und Kindersoldaten dargestellt?
Kapitel 6 untersucht den Zusammenhang zwischen Kinderarbeit und der Rekrutierung von Kindersoldaten, wobei analysiert wird, wie Kinderarbeit Kinder vulnerabler für die Rekrutierung macht.
- Quote paper
- Robert Behrens (Author), 2010, Kindersoldaten in Entwicklungsländern. Das subsaharische Afrika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354597