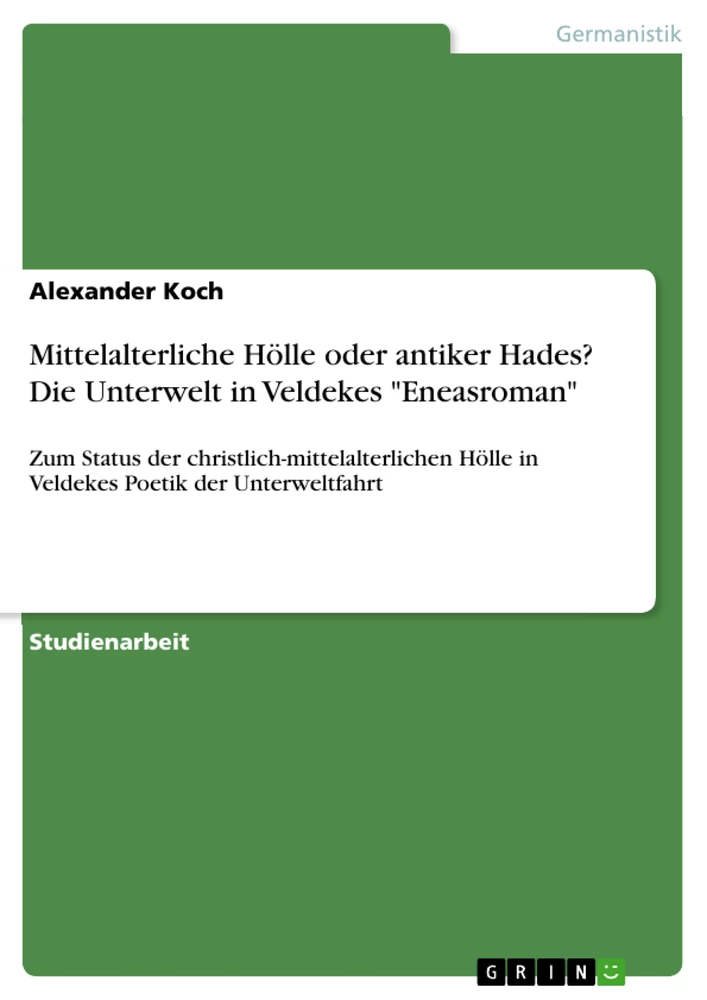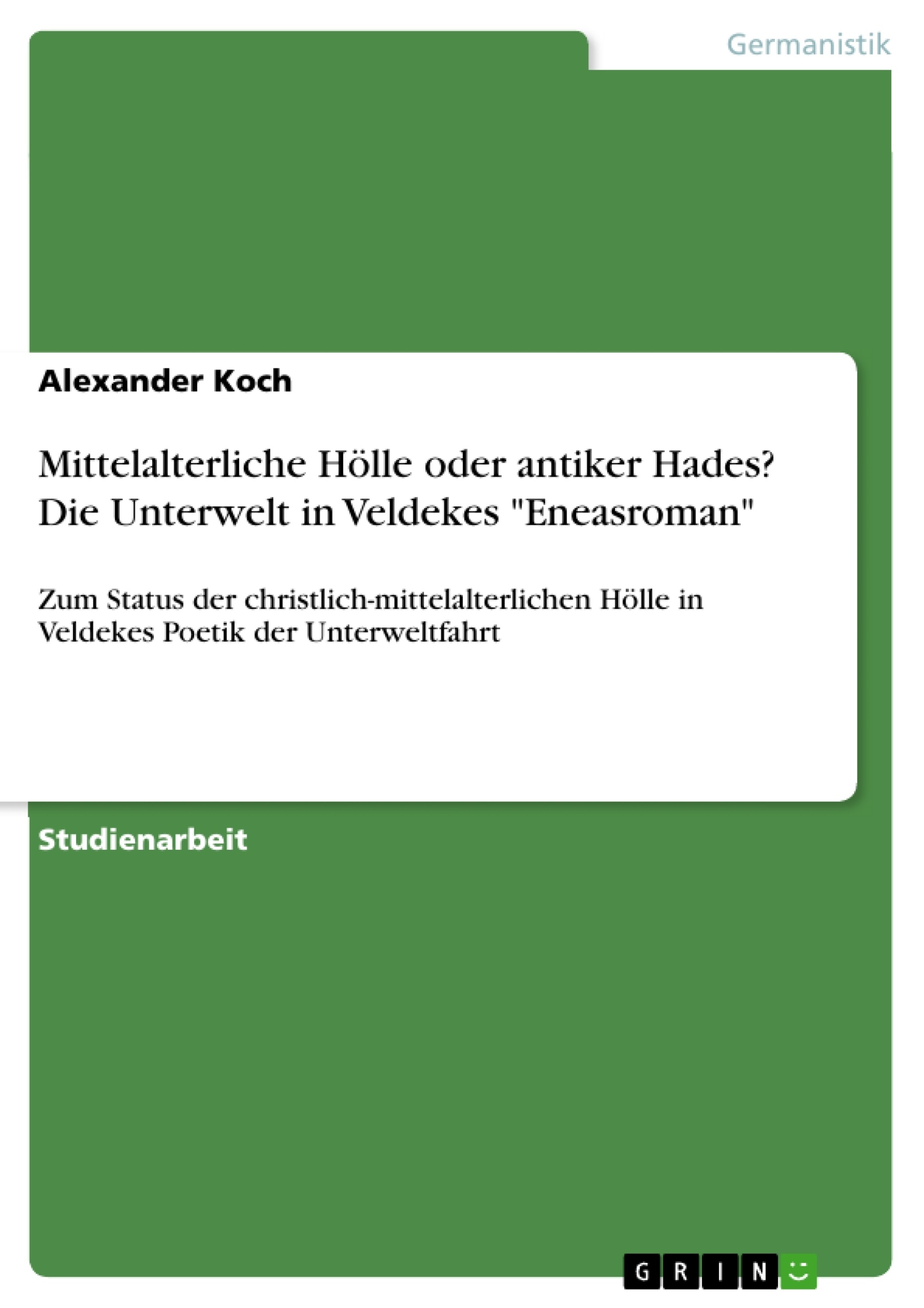Ist Veldekes Unterwelt und die Höllenfahrt des Eneas in seinem "Eneasroman" (um 1170 bis 1188 entstanden) eine mittelalterliche Hölle oder ein antiker Hades? Die Beantwortung dieser Frage soll Gegenstand dieser Hausarbeit sein.
Hierfür wird einsteigend die religiöse und literarische Rezeption der christlichen Hölle im 12. Jahrhundert skizziert, um zu extrahieren, in welchem Rahmen Veldeke seine Unterwelt konzipierte und wodurch er möglicherweise geprägt wurde. Anschließend wird Veldekes Poetik im Kontext mittelalterlichen Erzählens betrachtet und damit zusammenhängend zentrale Elemente dieses Erzählkonzepts erläutert, mit dem Ziel, diese Funktionslogik in der Unterweltepisode wiederzufinden und zu analysieren. Abschließend wird eine Hypothese darüber aufgestellt, welcher Intention diese Poetik folgt und welche Rolle dabei der christlichen Hölle zukommt.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitende Betrachtung
- B. Veldekes Unterweltfahrt - eine „interpretatio christiana“ der helle?
- 1. Das Höllenkonzept in religiöser und literarischer Tradition des 12. Jahrhunderts
- 2. Veldekes Poetik in der Unterweltfahrt
- 2.1 Der „artifex“ und sein Umgang mit der „materia“
- 2.2 Das „artificium“: Veldekes Unterwelt und ihre Topografie
- 2.3 Veldekes Unterwelt: mittelalterliche Hölle oder antiker Hades? - Funktionen von Eneas' Katabasis im Kontext von Synkretismus und Künstleranspruch
- C. Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Status der christlichen Hölle in Heinrich von Veldekes Eneasroman. Sie analysiert, inwiefern Veldekes Darstellung der Unterwelt eine „interpretatio christiana“ darstellt und welche poetische Programmatik seine Erzählung in diesem Abschnitt prägt. Die Arbeit fragt nach Veldekes Intentionen und der Rolle der christlichen Hölle im Kontext antiker Einflüsse.
- Das Höllenkonzept im 12. Jahrhundert: religiöse und literarische Traditionen
- Veldekes Poetik der Unterweltfahrt: Erzählkonzept und zentrale Elemente
- Die Funktion von Eneas' Katabasis: Synkretismus und künstlerischer Anspruch
- Der Vergleich zwischen Veldekes Unterwelt und der mittelalterlichen Hölle bzw. dem antiken Hades
- Veldekes Intentionen und die Rolle der christlichen Hölle in seinem Werk
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitende Betrachtung: Die Einleitung stellt die scheinbar widersprüchliche Kombination heidnischer und christlicher Elemente in Veldekes Beschreibung der Unterwelt vor. Sie führt das zentrale Paradoxon ein: das Nebeneinander von antiken Figuren und dem Konzept der christlichen Hölle im Hochmittelalter. Die Arbeit formuliert die Forschungsfrage nach dem Status der christlichen Hölle in Veldekes Poetik und skizziert den methodischen Ansatz, der die religiöse und literarische Rezeption der Hölle im 12. Jahrhundert beleuchtet, Veldekes Poetik analysiert und schließlich eine Hypothese zur Intention dieser Poetik formuliert.
B. Veldekes Unterweltfahrt - eine „interpretatio christiana“ der helle?: Dieses Kapitel ist zweigeteilt. Der erste Teil skizziert das vielschichtige und dynamische Höllenkonzept des 12. Jahrhunderts, indem er auf verschiedene theologische und literarische Quellen eingeht, wie z.B. die Offenbarung des Paulus, die Werke von Gregor dem Großen, Papst Honorius, Hildegard von Bingen und Haymo von Auxerre. Es wird die Entwicklung des Höllenkonzepts von einem vagen Konstrukt zu einem differenzierten System von Strafen, das sich an der Schwere der Sünden orientiert, aufgezeigt. Der zweite Teil fokussiert sich auf Veldekes Poetik innerhalb des mittelalterlichen Erzählens und analysiert die Funktionslogik der Unterweltepisode im Eneasroman. Dieser Teil beschreibt die spezifischen Merkmale von Veldekes Darstellung der Unterwelt und ordnet sie in den größeren Kontext seines literarischen und kulturellen Umfelds ein.
Schlüsselwörter
Heinrich von Veldeke, Eneasroman, Unterweltfahrt, christliche Hölle, Hochmittelalter, „interpretatio christiana“, poetische Programmatik, antiker Hades, Synkretismus, religiöse und literarische Traditionen des 12. Jahrhunderts, Höllenkonzept, mittelalterliches Erzählen.
Häufig gestellte Fragen zum Eneasroman von Heinrich von Veldeke
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Darstellung der Unterwelt im Eneasroman von Heinrich von Veldeke. Im Fokus steht die Frage, inwieweit Veldekes Beschreibung der Unterwelt als "interpretatio christiana" verstanden werden kann und welche poetische Programmatik seine Erzählung in diesem Abschnitt prägt. Es wird analysiert, welche Intentionen Veldeke verfolgte und welche Rolle die christliche Hölle im Kontext antiker Einflüsse spielt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Höllenkonzept des 12. Jahrhunderts in seinen religiösen und literarischen Traditionen, Veldekes Poetik der Unterweltfahrt mit ihren erzählerischen Konzepten und zentralen Elementen, die Funktion von Eneas' Katabasis im Hinblick auf Synkretismus und künstlerischen Anspruch, den Vergleich zwischen Veldekes Unterwelt und der mittelalterlichen Hölle bzw. dem antiken Hades sowie Veldekes Intentionen und die Rolle der christlichen Hölle in seinem Werk.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Eine Einleitung, ein Hauptteil ("Veldekes Unterweltfahrt - eine „interpretatio christiana“ der Hölle?") mit zwei Unterkapiteln (1. Das Höllenkonzept im 12. Jahrhundert und 2. Veldekes Poetik in der Unterweltfahrt) und einen Schlussteil. Der Hauptteil analysiert zunächst das Höllenkonzept des 12. Jahrhunderts, bevor er sich mit Veldekes poetischer Umsetzung auseinandersetzt, inklusive der Analyse von Veldekes Umgang mit seiner "materia" und dem "artificium" seiner Unterweltdarstellung sowie der Funktion von Eneas' Katabasis.
Welche Quellen werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene theologische und literarische Quellen des 12. Jahrhunderts, darunter die Offenbarung des Johannes, Werke von Gregor dem Großen, Papst Honorius, Hildegard von Bingen und Haymo von Auxerre. Sie analysiert die Entwicklung des Höllenkonzepts von einem vagen Konstrukt zu einem differenzierten System von Strafen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Heinrich von Veldeke, Eneasroman, Unterweltfahrt, christliche Hölle, Hochmittelalter, „interpretatio christiana“, poetische Programmatik, antiker Hades, Synkretismus, religiöse und literarische Traditionen des 12. Jahrhunderts, Höllenkonzept, mittelalterliches Erzählen.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welchen Status hat die christliche Hölle in der Poetik von Heinrich von Veldekes Eneasroman? Die Arbeit untersucht das scheinbare Paradoxon der Kombination heidnischer und christlicher Elemente in Veldekes Beschreibung der Unterwelt.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit beleuchtet die religiöse und literarische Rezeption der Hölle im 12. Jahrhundert, analysiert Veldekes Poetik und formuliert eine Hypothese zu den Intentionen dieser Poetik.
- Quote paper
- Alexander Koch (Author), 2016, Mittelalterliche Hölle oder antiker Hades? Die Unterwelt in Veldekes "Eneasroman", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354578