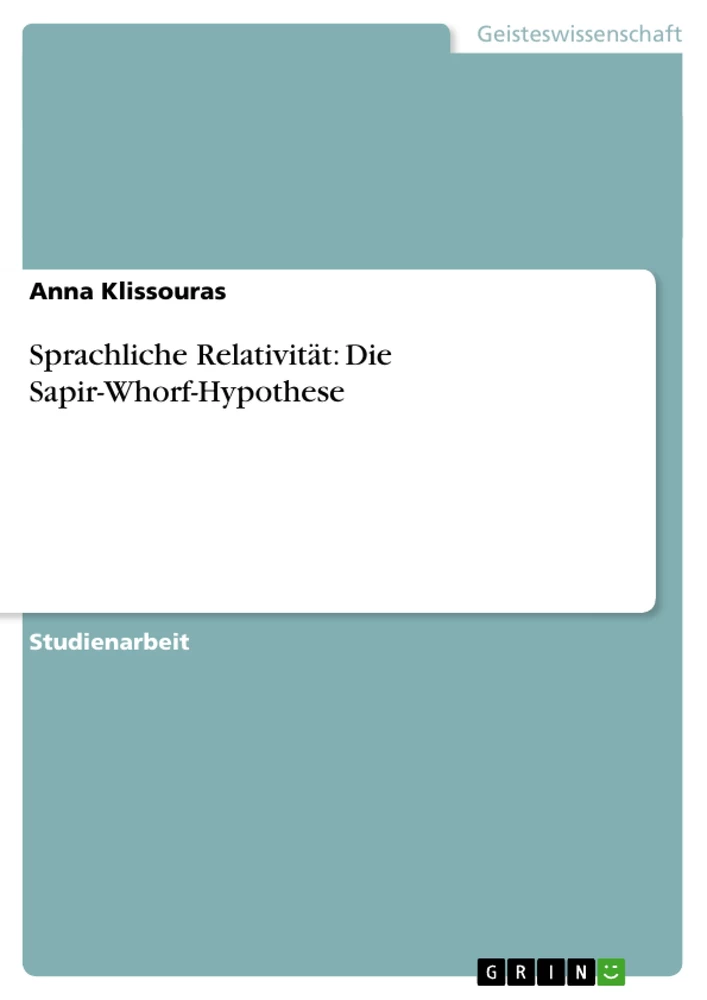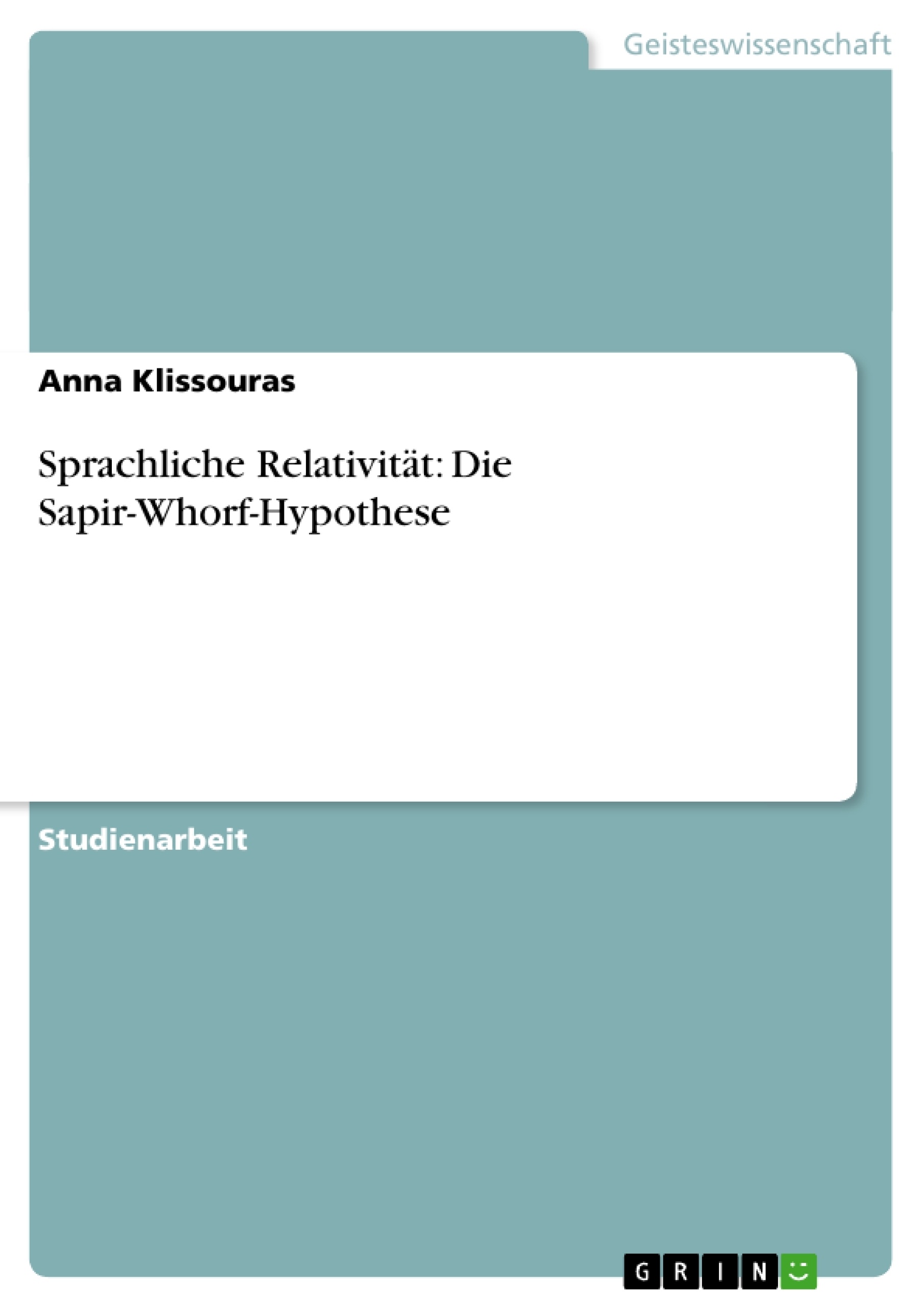In der vorliegenden Arbeit soll der durch Benjamin Lee Whorf (1897-1941) maßgeblich geprägte und popularisierte sprachliche Relativismus vorgestellt und auf seine Plausibilität geprüft werden. Als Untersuchungsweg dient mir dabei einerseits ein philosophischer, andererseits ein empirischer Zugang zur Problemlage. Denn eine interdisziplinäre Herangehensweise ist vonnöten, da die Sprache nicht als Einzeldisziplin verstanden werden kann, sondern vielmehr Bereiche der kognitiven Psychologie, Erkenntnistheorie, Neurologie, Ethnologie, und Linguistik berührt. In knapper Form soll eine Erläuterung der Frage geleistet werden, in wie weit die Sprache als restriktiver Rahmen für die menschliche Freiheit gesehen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Abgrenzung: Nativismus vs. Relativismus
- Sprachliche und Kognitive Kategorien
- Wörter
- Grammatik
- Mengenbegriffe
- Substantive
- Zeitbegriffe
- Dauer und Intensität
- Satzaufbau
- Zum Ursprung sprachlicher Kategorien
- Sprache erzeugt Realität
- Zeit und Raum
- Sprache und Logik
- Grenzen und Möglichkeiten der Wissenschaft
- Kritik und empirische Überprüfung
- Kritiker
- Die empirische Perspektive
- Farbexperimente
- Lucys Numerale
- Neurolinguistische Ansätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den sprachlichen Relativismus, wie er von Benjamin Lee Whorf geprägt wurde, und prüft dessen Plausibilität. Sie verbindet einen philosophischen mit einem empirischen Ansatz, um die komplexen Beziehungen zwischen Sprache, Kognition und Realität zu beleuchten. Die Arbeit befasst sich auch mit der Frage, inwieweit Sprache die menschliche Freiheit einschränkt.
- Der Vergleich von Nativismus und Relativismus in der Sprachphilosophie
- Die Rolle sprachlicher Kategorien (Wörter und Grammatik) in der Wahrnehmung und dem Denken
- Die empirische Überprüfung der Whorf-Sapir-Hypothese anhand von Beispielen aus verschiedenen Sprachen
- Die Grenzen und Möglichkeiten wissenschaftlicher Untersuchung im Kontext sprachlicher Relativität
- Der Einfluss der Sprache auf die menschliche Realität
Zusammenfassung der Kapitel
Abgrenzung: Nativismus vs. Relativismus: Dieses Kapitel differenziert zwischen nativistischen und relativistischen Ansätzen in der Sprachphilosophie. Während Nativisten von einer universellen, angeborenen Sprachstruktur ausgehen, betonen Relativisten die kulturelle Bedingtheit von Sprache und deren Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität. Whorfs Relativismus, der die Identität von innerer und äußerer Sprache postuliert, wird als Gegenposition zum Nativismus (Chomsky, Fodor) dargestellt und durch die Existenz von vielfältigen Sprachen untermauert. Die Problematik der nativistischen Unterscheidung von innerer und äußerer Sprache wird anhand von Putnams Argumentation zur Verschlüsselung und Entschlüsselung sprachlicher Botschaften diskutiert. Das Kapitel legt den Grundstein für die weitere Auseinandersetzung mit Whorfs Hypothese und grenzt den Forschungsgegenstand ab.
Sprachliche und Kognitive Kategorien: Dieses Kapitel untersucht die Rolle sprachlicher Kategorien im Prozess des Denkens. Whorf argumentiert, dass die Kategorisierung der Welt nicht biologisch vorgegeben ist, sondern durch den Wortschatz und die Grammatik der Muttersprache bestimmt wird. Die willkürliche Formung von Wörtern wird anhand von Regeln der englischen Sprache erläutert, und die Grenzen der Benennung aufgrund der Kategorisierung werden diskutiert. Das Kapitel veranschaulicht die Willkürlichkeit sprachlicher Kategorien anhand von Beispielen aus außereuropäischen Sprachen (Hopi, Eskimo), die unterschiedliche Bezeichnungen für ähnliche Phänomene verwenden. Es wird gezeigt, dass die Bedeutung von Wörtern kontextabhängig ist und nicht natürlich determiniert.
Schlüsselwörter
Sprachlicher Relativismus, Nativismus, Whorf-Sapir-Hypothese, Sprachliche Kategorien, Kognitive Kategorien, Wahrnehmung, Realität, Sprache und Denken, Empirische Forschung, Linguistik, Kognitionspsychologie, Grammatik, Wortschatz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sprachlicher Relativismus vs. Nativismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den sprachlichen Relativismus, insbesondere die Hypothese von Benjamin Lee Whorf, und deren Plausibilität. Sie analysiert die komplexen Beziehungen zwischen Sprache, Kognition und Realität und betrachtet dabei sowohl philosophische als auch empirische Ansätze. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Einfluss von Sprache auf die menschliche Freiheit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit vergleicht Nativismus und Relativismus in der Sprachphilosophie. Sie untersucht die Rolle sprachlicher Kategorien (Wörter und Grammatik) bei der Wahrnehmung und dem Denken. Die Whorf-Sapir-Hypothese wird anhand von Beispielen aus verschiedenen Sprachen empirisch geprüft. Die Grenzen und Möglichkeiten wissenschaftlicher Untersuchungen im Kontext sprachlicher Relativität werden diskutiert, ebenso wie der Einfluss von Sprache auf die menschliche Realität.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis mit Kapiteln zu den Themen: Abgrenzung Nativismus vs. Relativismus; Sprachliche und Kognitive Kategorien (Wörter, Grammatik, Mengen-, Zeit- und Raumbegriffe, Satzaufbau); Zum Ursprung sprachlicher Kategorien; Sprache erzeugt Realität; Sprache und Logik; Grenzen und Möglichkeiten der Wissenschaft (inkl. Kritik, empirische Überprüfung, Farbexperimente, Lucys Numerale, neurolinguistische Ansätze). Zusätzlich gibt es eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und Kapitelzusammenfassungen.
Was sind die zentralen Unterschiede zwischen Nativismus und Relativismus?
Nativisten gehen von einer universellen, angeborenen Sprachstruktur aus, während Relativisten die kulturelle Bedingtheit von Sprache und deren Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität betonen. Whorfs Relativismus, der die Identität von innerer und äußerer Sprache postuliert, steht im Gegensatz zum Nativismus (Chomsky, Fodor).
Welche Rolle spielen sprachliche Kategorien im Denken?
Whorf argumentiert, dass die Kategorisierung der Welt nicht biologisch vorgegeben, sondern durch Wortschatz und Grammatik der Muttersprache bestimmt wird. Die Arbeit illustriert die Willkürlichkeit sprachlicher Kategorien anhand von Beispielen aus verschiedenen Sprachen und zeigt, dass die Bedeutung von Wörtern kontextabhängig ist.
Wie wird die Whorf-Sapir-Hypothese empirisch geprüft?
Die Arbeit verwendet Beispiele aus verschiedenen Sprachen (z.B. Hopi, Eskimo) und untersucht die Unterschiede in der Bezeichnung ähnlicher Phänomene. Weitere empirische Ansätze umfassen Farbexperimente, die Untersuchung von Lucys Numeralen und neurolinguistische Ansätze.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachlicher Relativismus, Nativismus, Whorf-Sapir-Hypothese, Sprachliche Kategorien, Kognitive Kategorien, Wahrnehmung, Realität, Sprache und Denken, Empirische Forschung, Linguistik, Kognitionspsychologie, Grammatik, Wortschatz.
Welche Kritikpunkte werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Kritik an der Whorf-Sapir-Hypothese und diskutiert die Grenzen und Möglichkeiten wissenschaftlicher Untersuchungen im Kontext sprachlicher Relativität. Die Problematik der nativistischen Unterscheidung von innerer und äußerer Sprache wird anhand von Putnams Argumentation diskutiert.
- Quote paper
- Anna Klissouras (Author), 2004, Sprachliche Relativität: Die Sapir-Whorf-Hypothese, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35418