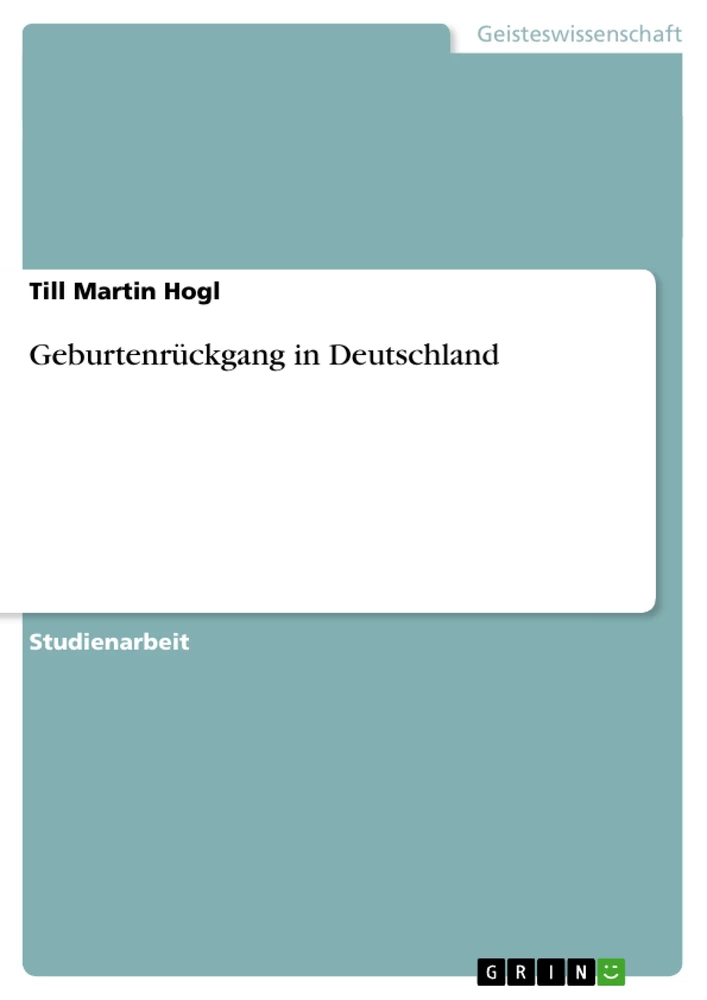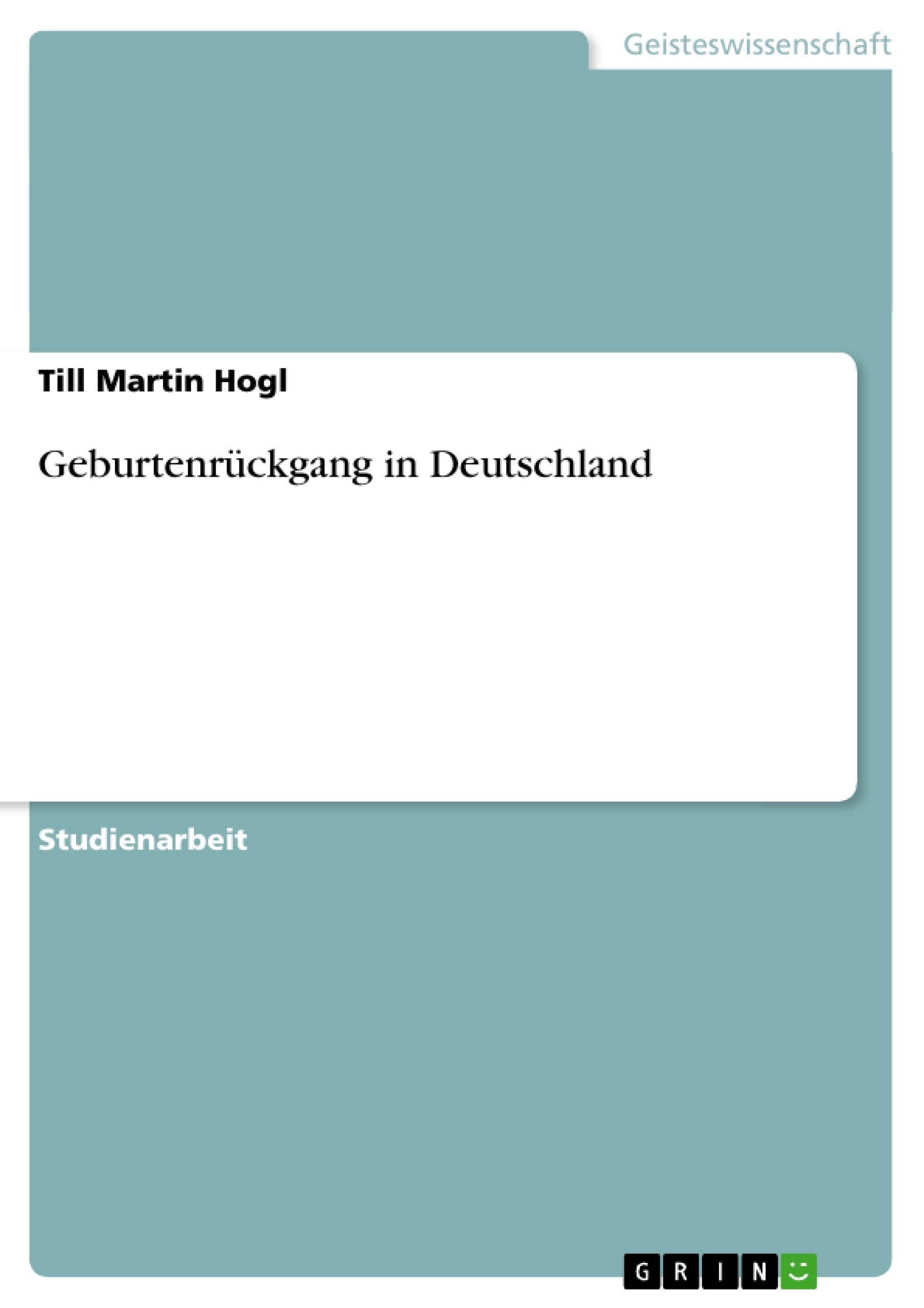„Kinder stehen in Deutschland nicht im fröhlichen Mittelpunkt, sondern unter einem bedrohlichen Artenschutz.“
(Jeanne Rubner, Süddeutsche Zeitung, Nr. 106, 8. Mai 2004)
Betrachtet man die Fertilität in der Bundesrepublik, so liegt diese seit Mitte der siebziger Jahre ziemlich konstant bei 1,35 Kindern pro Frau. Eine Geburtenrate von 2,1 Kindern wäre jedoch notwendig, um die Bevölkerungszahl stabil zu halten. Neben einem, ohne Zuwanderung zu erwartenden Rückgang der Bevölkerung, ist ein weiterer demographischer Trend zu beobachten: die Überalterung der Bevölkerung. Zum einen resultiert dies aus einer gesteigerten Lebenserwartung, zum anderen aber auch aus der anhaltend niedrigen Kinderzahl pro Familie. 1 Deutschland nimmt im weltweiten Vergleich der Geburtenzahlen einen der letzten Plätze ein. Dies wäre, wenn man sich denn ausschließlich auf die Betrachtung der Daten und Statistiken beschränken würde, weniger besorgniserregend. Bedenkt man jedoch die Folgen des Geburtenrückgangs, sind diese alarmierend. Durch die Umkehrung der Bevölkerungspyramide entstehen enorme finanzielle Kosten für die Sozialsysteme und es bleibt fraglich, ob diese in der Zukunft überhaupt noch funktionieren k önnen. Das Innovationskapital des Wirtschaftsstandorts Deutschland wird verringert. Ökonomische Krisen sind aufgrund der Mehrbelastung der sozialen Sicherungssysteme vorprogrammiert, um nur einige der Folgen zu nennen. Angesichts dieser Tatsachen ist es umso erstaunlicher, dass dieses Thema in der Politik über Jahrzehnte stiefmütterlich behandelt und verdrängt wurde. In der Soziologie lässt sich dieser Umgang mit der Thematik nicht feststellen, denn das Thema Geburtenrückgang streift zahlreiche Teilbereiche der soziologischen Forschung, sei es nun Familien- und Bevölkerungssoziologie, soziologische Theorie oder das interdisziplinäre Forschungsgebiet der Bevölkerungswissenschaft (Demographie). Die vorliegende Arbeit wird sich im Schwerpunkt mit dem Phänomen des Geburtenrückgangs in der Bundesrepublik Deutschland beschäftigen. Die zentrale Frage, ist die nach den Ursachen dieser Entwicklung unter Berücksichtigung der
Familien- und Gesellschaftsstrukturen. Welche erfolgsversprechenden Lösungsansätze gibt es, ge rade hinsichtlich einer Umkehrung des Trends in Frankreich?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Theorien des Geburtenrückgangs und des generativen Verhaltens
- II.1 Die „wealth-flow-theory of fertility decline“ (J. C. Caldwell)
- II.2 Die „Theorie der säkularen Nachwuchsbeschränkung“ (Hans Linde)
- II.3 Zusammenfassung
- III. Geburtenrückgang in Deutschland (West)
- III.1 Historische Betrachtung des Geburtenrückgangs
- III.2 Familien- und Gesellschaftsstrukturen im Wandel
- III.3 Ursachen des Geburtenrückgangs (in Deutschland)
- III.4 Die Bevölkerungssituation in Deutschland und im westlichen Europa
- IV. Familienpolitik und familienpolitische Lösungsansätze in der Bundesrepublik Deutschland (- im Vergleich mit Frankreich)
- IV.1 Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland
- IV.2 Lösungsansätze
- IV.3 Familienpolitik in Frankreich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Geburtenrückgangs in der Bundesrepublik Deutschland. Sie untersucht die Ursachen dieser Entwicklung, insbesondere im Kontext der Familien- und Gesellschaftsstrukturen. Darüber hinaus analysiert die Arbeit familienpolitische Lösungsansätze in Deutschland und vergleicht diese mit dem französischen Modell.
- Theorien des Geburtenrückgangs und des generativen Verhaltens
- Historische Entwicklung des Geburtenrückgangs in Deutschland
- Familien- und Gesellschaftsstrukturen im Wandel und ihre Auswirkungen auf die Fertilität
- Familienpolitik und familienpolitische Lösungsansätze in Deutschland
- Vergleich der Familienpolitik in Deutschland und Frankreich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Geburtenrückgangs in Deutschland ein und beleuchtet die Problematik der niedrigen Geburtenrate und der Folgen für die Gesellschaft.
Kapitel II stellt verschiedene theoretische Erklärungsansätze für den Geburtenrückgang vor, unter anderem die „wealth-flow-theory“ von J. C. Caldwell und die „Theorie der säkularen Nachwuchsbeschränkung“ von Hans Linde.
Kapitel III untersucht den Geburtenrückgang in Deutschland, mit Fokus auf historische Entwicklungen, veränderte Familien- und Gesellschaftsstrukturen sowie die Ursachen des Rückgangs.
Kapitel IV analysiert die Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland und präsentiert verschiedene Lösungsansätze, um den Trend des Geburtenrückgangs umzukehren. Der Vergleich mit der französischen Familienpolitik rundet das Kapitel ab.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Geburtenrückgang, Fertilität, Familienstrukturen, Gesellschaftswandel, Familienpolitik, demografische Entwicklung, „wealth-flow-theory“, „Theorie der säkularen Nachwuchsbeschränkung“, Deutschland, Frankreich.
- Quote paper
- Till Martin Hogl (Author), 2004, Geburtenrückgang in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35415