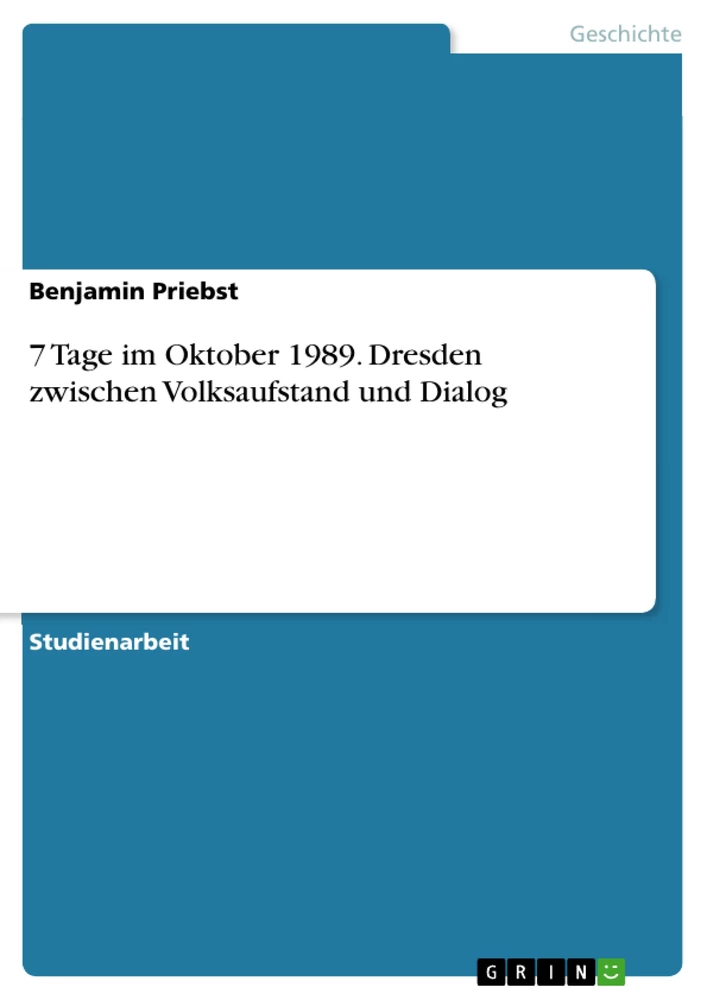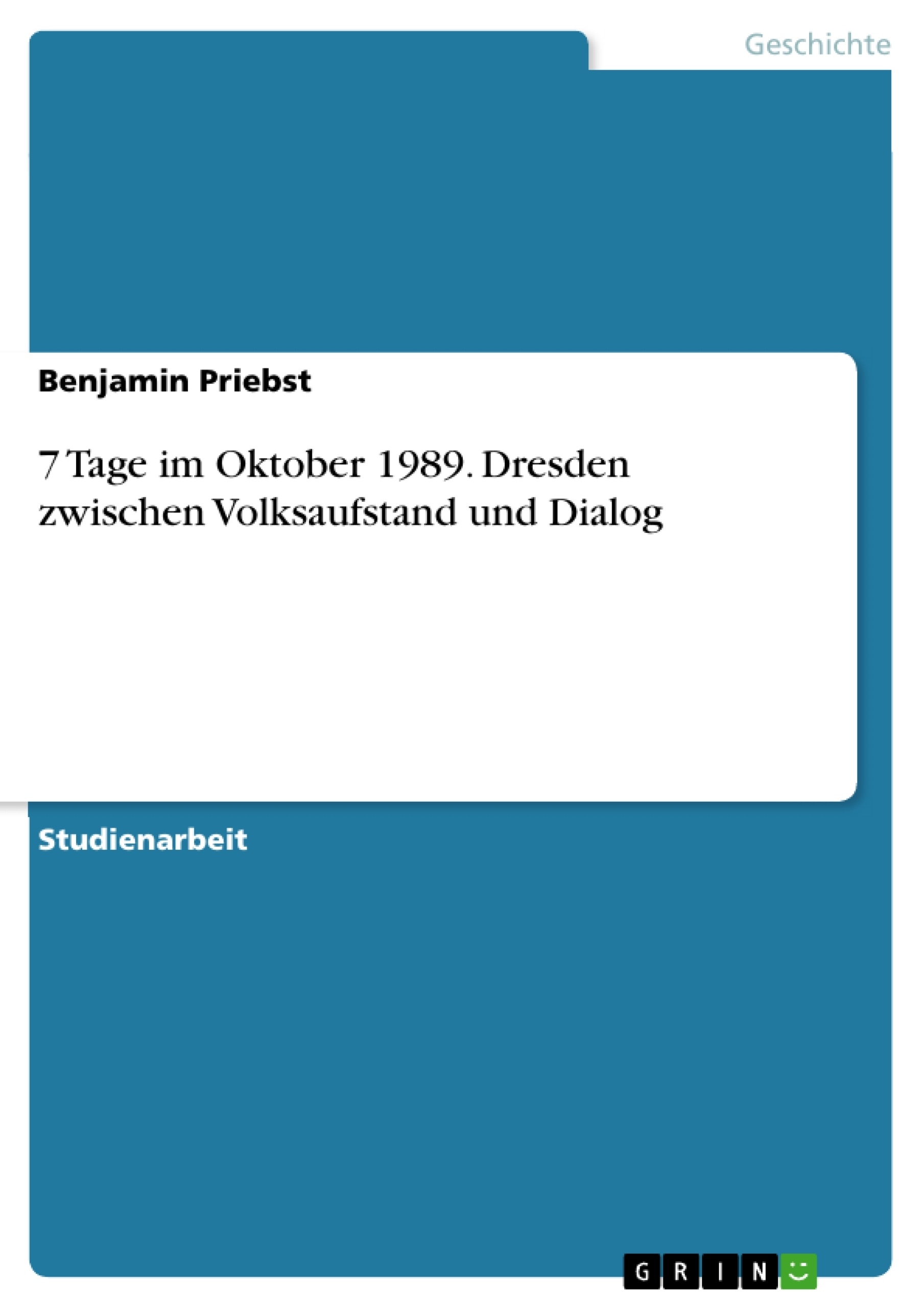Die Zielsetzung dieser Hausarbeit ist es, den Verlauf der Ereignisse in Dresden vom 3. bis zum 9. Oktober nachzuzeichnen, und dabei zu zeigen, welche die spezifischen Faktoren, die günstigen Umstände also waren, die in Dresden den Weg für diesen ersten friedlichen Dialog ebneten. Anhand der Erinnerungen engagierter Bürger, Demonstranten und unbeteiligter Zeugen auf der einen Seite, aber auch durch die kritische Auseinandersetzung mit Interviewtexten, Memoiren und anderen Stellungnahmen damaliger Entscheidungsträger auf der anderen, werden die so dramatischen wie folgenreichen sieben Tage im Oktober dargestellt. Hierbei ist von zentralem Interesse, welche die Faktoren für die Mobilisierung und Politisierung der Bevölkerung waren, und inwieweit der Verlauf der Ereignisse auch von den Entscheidungen bzw. Initiativen einzelner Personen abhing.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Szenen der Gewalt als Auftakt der Friedlichen Revolution - Die Unruhen um den Dresdner Hauptbahnhof vom 3. bis 5. Oktober 1989
- 3. Vom „Wir wollen raus!“ zum „Wir bleiben hier!“ - Das Erwachen der Dresdner Bürgerschaft
- 4. Der Richtungswechsel in letzter Minute – Hans Modrow und Wolfgang Berghofer auf Deeskalationskurs
- 5. Ausblick und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit verfolgt das Ziel, den Verlauf der Ereignisse in Dresden vom 3. bis zum 9. Oktober 1989 nachzuzeichnen und die spezifischen Faktoren zu identifizieren, die in Dresden den Weg für einen ersten friedlichen Dialog ebneten. Die Arbeit analysiert die Ereignisse anhand von Erinnerungen von Bürgern, Demonstranten und Zeugen sowie durch die kritische Auseinandersetzung mit Interviewtexten und Memoiren von Entscheidungsträgern. Im Zentrum steht das Interesse an den Faktoren der Mobilisierung und Politisierung der Bevölkerung und dem Einfluss individueller Entscheidungen.
- Die Rolle der Gewalt im Auslöser der friedlichen Revolution in Dresden.
- Die Entwicklung der Demonstrationsbewegung und der Wandel der Forderungen von "Wir wollen raus!" zu "Wir bleiben hier!".
- Die Bedeutung von Entscheidungen einzelner Personen (z.B. Hans Modrow) für die Deeskalation.
- Die spezifischen Umstände in Dresden, die einen friedlichen Dialog ermöglichten.
- Die Analyse der Mobilisierung und Politisierung der Dresdner Bevölkerung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung setzt den Kontext der Ereignisse im Herbst 1989 in der DDR. Sie betont die Bedeutung günstiger Umstände, wie Gorbatschows Politik und den Vertrauensverlust in die SED-Führung, für den Erfolg der friedlichen Revolution. Besonders hervorgehoben wird das hohe Protestpotential in Dresden, illustriert durch die hohe Anzahl von Ausreiseanträgen. Die Arbeit konzentriert sich auf die sieben Tage im Oktober 1989 in Dresden, die einen friedlichen Dialog zwischen Demonstranten und der Staatsführung ermöglichten, trotz des Risikos von Gewalt.
2. Szenen der Gewalt als Auftakt der Friedlichen Revolution - Die Unruhen um den Dresdner Hauptbahnhof vom 3. bis 5. Oktober 1989: Dieses Kapitel beschreibt die Ereignisse um den Dresdner Hauptbahnhof als Auftakt der Friedlichen Revolution. Die Schließung der Grenze zur Tschechoslowakei führte zu einer großen Ansammlung von Ausreisewilligen am Hauptbahnhof. Die gewaltsame Reaktion der Sicherheitskräfte auf die Proteste – mit Verhaftungen und Verletzten – wird detailliert geschildert. Die Ereignisse werden als ein wichtiger Auslöser der Demonstrationen in Dresden dargestellt, die den Weg für spätere friedliche Proteste ebneten. Der Kontrast zwischen der gewaltsamen Unterdrückung und dem späteren friedlichen Dialog bildet einen zentralen Punkt dieses Kapitels.
Häufig gestellte Fragen zu: Szenen der Gewalt als Auftakt der Friedlichen Revolution in Dresden
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Verlauf der Ereignisse in Dresden vom 3. bis 9. Oktober 1989 und analysiert die Faktoren, die in Dresden einen friedlichen Dialog zwischen Demonstranten und der Staatsführung ermöglichten. Der Fokus liegt auf der Mobilisierung und Politisierung der Bevölkerung sowie dem Einfluss individueller Entscheidungen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf Erinnerungen von Bürgern, Demonstranten und Zeugen sowie auf kritischen Analysen von Interviewtexten und Memoiren von Entscheidungsträgern.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle von Gewalt als Auslöser der friedlichen Revolution in Dresden, der Entwicklung der Demonstrationsbewegung (vom „Wir wollen raus!“ zum „Wir bleiben hier!“), der Bedeutung von Entscheidungen einzelner Personen (z.B. Hans Modrow) für die Deeskalation, den spezifischen Umständen in Dresden, die einen friedlichen Dialog ermöglichten, und der Analyse der Mobilisierung und Politisierung der Dresdner Bevölkerung.
Was geschah am Dresdner Hauptbahnhof vom 3. bis 5. Oktober 1989?
Die Schließung der Grenze zur Tschechoslowakei führte zu einer großen Ansammlung von Ausreisewilligen am Hauptbahnhof. Die gewaltsame Reaktion der Sicherheitskräfte auf die Proteste mit Verhaftungen und Verletzten wird als wichtiger Auslöser der Demonstrationen in Dresden dargestellt, die den Weg für spätere friedliche Proteste ebneten.
Welche Rolle spielte Gewalt im Kontext der Friedlichen Revolution in Dresden?
Die gewaltsame Unterdrückung der Proteste am Hauptbahnhof bildete einen scharfen Kontrast zum späteren friedlichen Dialog und wird als wichtiger Auslöser der Demonstrationen analysiert. Die Arbeit untersucht die paradoxe Rolle der Gewalt als Auslöser für die friedliche Entwicklung der Ereignisse.
Welche Bedeutung hatten die Entscheidungen von Hans Modrow und Wolfgang Berghofer?
Die Arbeit analysiert den Richtungswechsel von Hans Modrow und Wolfgang Berghofer hin zu einem Deeskalationskurs und deren Bedeutung für die friedliche Entwicklung der Situation in Dresden.
Wie lässt sich der Wandel der Forderungen von „Wir wollen raus!“ zu „Wir bleiben hier!“ erklären?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Demonstrationsbewegung und den Wandel der Forderungen von Ausreisewünschen hin zu Forderungen nach Veränderungen innerhalb des Systems.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die spezifischen Umstände in Dresden, die trotz des Risikos von Gewalt einen friedlichen Dialog ermöglichten. Die Einleitung betont den Kontext der Ereignisse im Herbst 1989 in der DDR, inklusive Gorbatschows Politik und dem Vertrauensverlust in die SED-Führung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Ereignisse am Dresdner Hauptbahnhof, ein Kapitel über die Entwicklung der Dresdner Bürgerschaft, ein Kapitel über den Richtungswechsel von Modrow und Berghofer, und einen Ausblick/Schluss.
- Quote paper
- Benjamin Priebst (Author), 2011, 7 Tage im Oktober 1989. Dresden zwischen Volksaufstand und Dialog, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353968