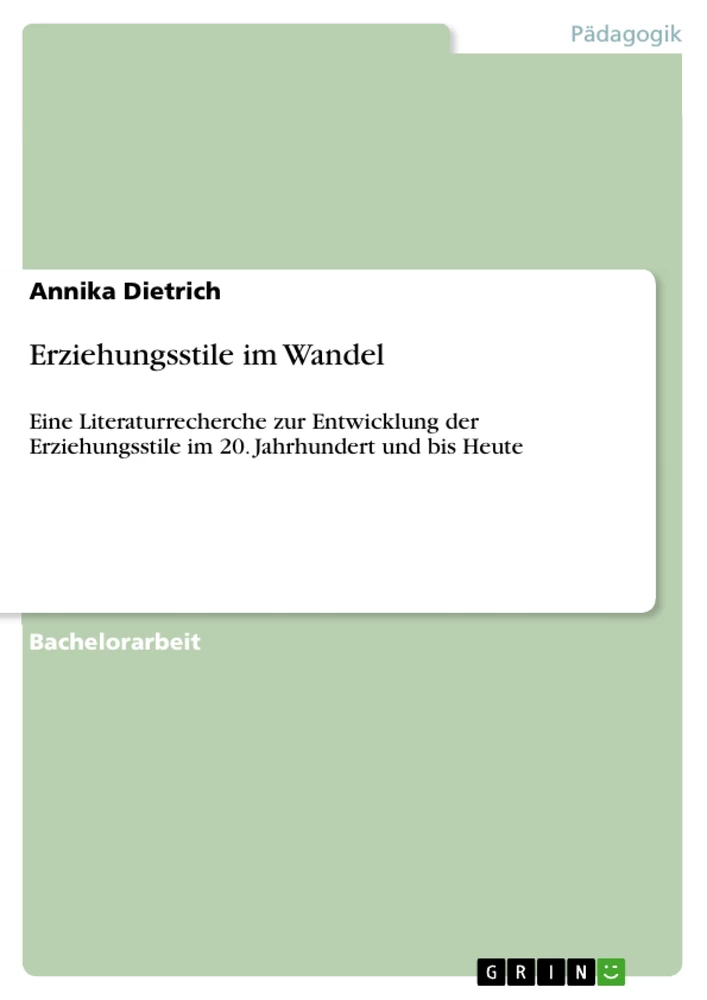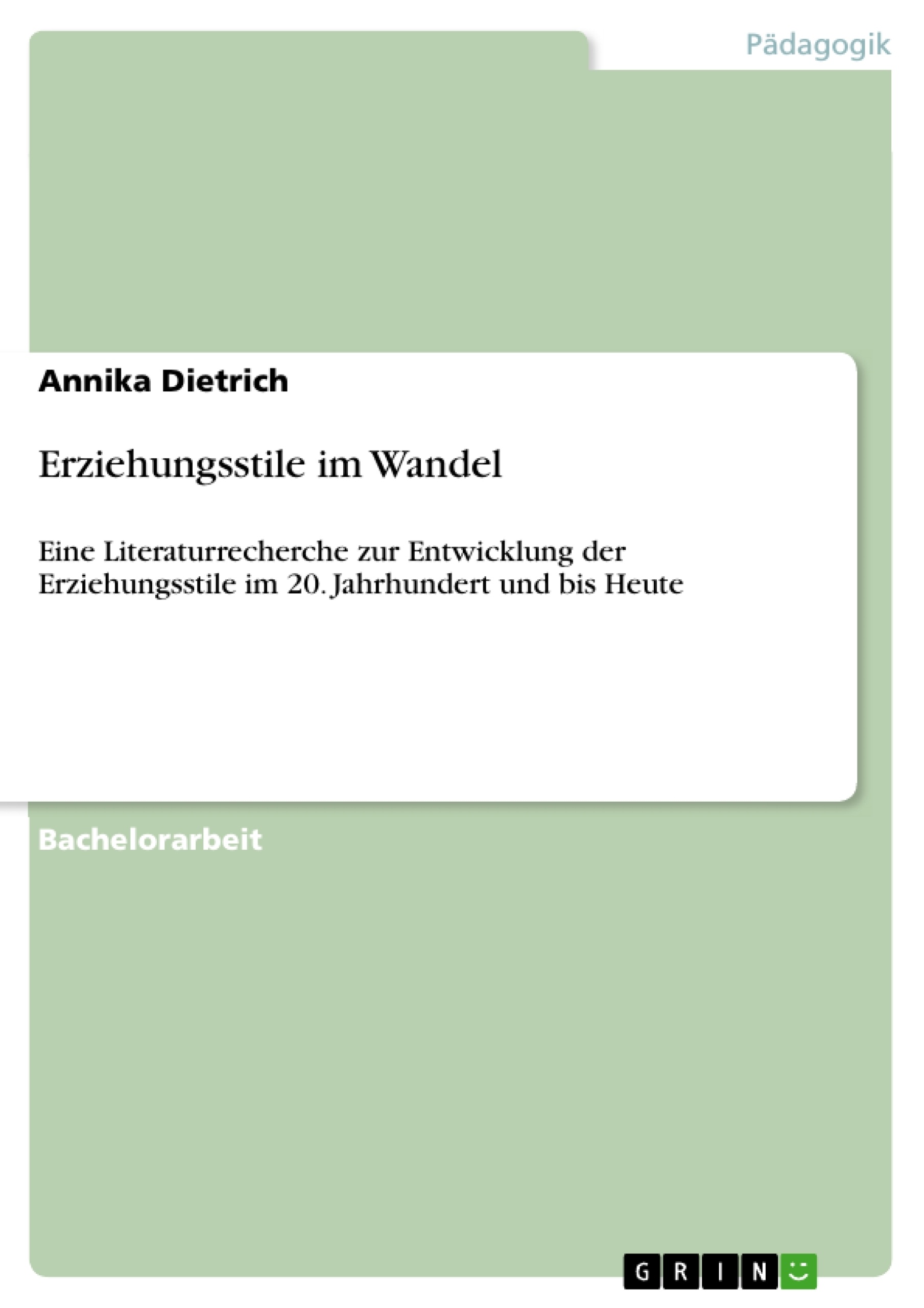Kulturübergreifend sehen sich Menschen der Tatsache gegenüber gestellt, dass Kinder wachsen und erwachsen werden und in diesem Prozess begleitet und unterstützt werden wollen. Die biologischen Gegebenheiten erzwingen ein Begleiten und Versorgen eines Kindes, vor allem eines Neugeborenen, denn auf sich allein gestellt könnte ein Kind nicht überleben (vgl. Hassenstein, 2001, S. 51). Doch nicht nur für Nahrung und Sicherheit wird von den Eltern oder Bezugspersonen gesorgt. Pädagogische Erfahrungen, die über den Lauf der Jahre gesammelt wurden, werden weitergegeben oder abgestoßen. Man spricht von Erziehung. (vgl. Oelkers, 2013, S.3)
Lange Zeit war Erziehung mit Züchtigung gleichzusetzen. In unterschiedlichen Kulturen gab es unterschiedliche Züchtigungsarten, Schüler wurden in Ecken gestellt oder gar mit einer Eselsmütze vor der Klasse gedemütigt. Körperliche Strafen wie Schläge waren ebenfalls lange Zeit üblich, sind heute jedoch gesetzlich verboten. Das Ziel dieser Erziehung war es, „das Kind dem Erwachsenen gefügig zu machen“ (Waldschmidt, 2010, S. 55).
Erich Weber (1976, S. 47) definiert Erziehung als „die in sozialer Interaktion erfolgende absichtliche Lernhilfe.“ Groothof bestätigt dies durch die Klärung der Aufgabe eines Erziehenden: Ein Erzieher ist jene Person, die „planmäßige pädagogische Hilfen an der Bildung und der Ausbildung der nachfolgenden Generation leistet.“ (Groothof, 2012, S. 424) Dem Erziehenden ist die Aufgabe der Sozialisation und Personalisation zugeschrieben, das heißt das Einführen in „verantwortliches, zwischenmenschliches und gesellschaftliches Verhalten“. (ebd., S. 424) Dass dies nicht durch körperliche Züchtigung stattfinden kann, ist heute klar. Die Erziehung ist eine umfassende und lebenslange Aufgabe, die mit einem hohen Maß an Verantwortlichkeit einhergeht.
Im 20. Jahrhundert kam es zu einem großen Wandel der Erziehungsstile, der durch gesellschaftliche, politische und entwicklungspsychologische Veränderungen und Erkenntnisse vorangetrieben wurde. Dieser Wandel soll in dieser Arbeit genauer beschrieben und untersucht werden. Der Einfluss der einzelnen Erziehungsstile aufeinander soll beleuchtet und die Verknüpfungen sollen dargestellt werden. Außerdem soll erklärt werden, wie sich daraus der heutige Erziehungsstil entwickelt hat.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- 1.1 Eingrenzung des Themas
- 1.2 Die Bedeutung des Themas für die frühkindliche Pädagogik
- 1.3 Aufbau
- II Methodik
- 2.1 Fragestellung
- 2.2 Die Literaturrecherche
- III Theoretische Grundlage
- 3.1 Was ist Erziehung?
- 3.2 Die Erziehungsstile
- IV Vertiefung: Die Erziehungsstile und deren Wandel
- 4.1 Die autoritäre Erziehung
- 4.2 Die antiautoritäre Erziehung
- 4.3 Die emanzipatorische Erziehung
- 4.4 Erziehung im 21. Jahrhundert
- 4.4.1 Interaktive Erziehung
- 4.4.2 Der Schrei nach Autorität
- 4.4.3 Die Familie und sich wandelnde Orte der Erziehung im 21. Jahrhundert
- 4.5 Pädagogik im 20. Jahrhundert und bis heute
- 4.6 Bezug zwischen den unterschiedlichen Erziehungsstilen
- 4.7 Einflussfaktoren auf Erziehung
- V Schlusswort und Ausblick
- 5.1 Zusammenfassung
- 5.2 Erwartungen zur Entwicklung
- 5.3 Bedeutung für mich als Kindheitspädagogin
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung von Erziehungsstilen im 20. Jahrhundert und deren Einfluss auf die heutige Erziehung. Ziel ist es, den Wandel der Erziehungsstile nachzuvollziehen, die Verknüpfungen zwischen den einzelnen Stilen aufzuzeigen und zu erklären, wie sich daraus der heutige Erziehungsstil entwickelt hat. Die Arbeit beleuchtet auch den Einfluss gesellschaftlicher, politischer und entwicklungspsychologischer Veränderungen auf die Erziehung.
- Wandel der Erziehungsstile im 20. Jahrhundert
- Einfluss von gesellschaftlichen, politischen und entwicklungspsychologischen Faktoren
- Beziehungen zwischen verschiedenen Erziehungsstilen
- Entwicklung des heutigen Erziehungsstils
- Das Bild des Kindes im Wandel der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Erziehung ein und erläutert deren Bedeutung, insbesondere im Kontext der frühkindlichen Pädagogik. Sie beschreibt den Wandel der Erziehung von der körperlichen Züchtigung hin zu moderneren Ansätzen und hebt die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit dem Thema im Kontext sozialer und pädagogischer Berufe hervor. Der ständige Wandel der Gesellschaft und der Einfluss von historischen Ereignissen wie den Weltkriegen und der Wiedervereinigung Deutschlands werden als wichtige Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Erziehungsstile genannt. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und grenzt das Thema auf die Entwicklung der Erziehung im 20. Jahrhundert ein, wobei ein kurzer Blick auf die vorangegangene Geschichte geworfen wird, um den historischen Kontext zu verdeutlichen.
II Methodik: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es legt die Forschungsfrage dar und beschreibt die durchgeführte Literaturrecherche als Grundlage der Analyse.
III Theoretische Grundlage: Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der Arbeit, indem es den Begriff "Erziehung" definiert und verschiedene Erziehungsstile vorstellt. Es bildet die Basis für die vertiefende Betrachtung der einzelnen Erziehungsstile in den folgenden Kapiteln.
IV Vertiefung: Die Erziehungsstile und deren Wandel: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Erziehungsstile (autoritär, antiautoritär, emanzipatorisch) und deren Entwicklung im Laufe des 20. Jahrhunderts und bis in die Gegenwart. Es beleuchtet den Einfluss von gesellschaftlichen Veränderungen und den fortschreitenden Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie auf die jeweiligen Erziehungsstile. Die Unterkapitel untersuchen verschiedene Aspekte der Erziehung im 21. Jahrhundert, wie die interaktive Erziehung, den Wunsch nach mehr Autorität und die sich verändernden Erziehungsorte innerhalb der Familie. Der Vergleich der Erziehungsstile im 20. und 21. Jahrhundert und die Darstellung der Einflussfaktoren auf die Erziehung runden das Kapitel ab.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Entwicklung von Erziehungsstilen im 20. Jahrhundert
Was ist der allgemeine Inhalt dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung von Erziehungsstilen im 20. Jahrhundert und deren Einfluss auf die heutige Erziehung. Sie verfolgt den Wandel der Erziehungsstile, zeigt die Verbindungen zwischen den einzelnen Stilen auf und erklärt, wie sich daraus der heutige Erziehungsstil entwickelt hat. Zusätzlich beleuchtet sie den Einfluss gesellschaftlicher, politischer und entwicklungspsychologischer Veränderungen auf die Erziehung.
Welche Erziehungsstile werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert verschiedene Erziehungsstile, darunter den autoritären, den antiautoritären und den emanzipatorischen Erziehungsstil. Sie betrachtet deren Entwicklung im Laufe des 20. Jahrhunderts und bis in die Gegenwart.
Welche Faktoren beeinflussen die Entwicklung der Erziehungsstile laut der Arbeit?
Die Arbeit betont den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen, politischer Entwicklungen und fortschreitender Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie auf die jeweiligen Erziehungsstile. Auch historische Ereignisse wie die Weltkriege und die Wiedervereinigung Deutschlands werden als wichtige Einflussfaktoren genannt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Teile: Eine Einleitung, die das Thema einführt und den Aufbau der Arbeit beschreibt; ein Methodenkapitel, das die Forschungsfrage und die Literaturrecherche erläutert; ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen, welches den Begriff "Erziehung" definiert und verschiedene Erziehungsstile vorstellt; ein ausführliches Kapitel zur Vertiefung der Erziehungsstile und deren Wandel im 20. und 21. Jahrhundert; und schließlich ein Schlusswort mit Zusammenfassung, Ausblick und persönlicher Bedeutung für die Autorin.
Was sind die zentralen Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die zentralen Themenschwerpunkte sind der Wandel der Erziehungsstile im 20. Jahrhundert, der Einfluss von gesellschaftlichen, politischen und entwicklungspsychologischen Faktoren, die Beziehungen zwischen verschiedenen Erziehungsstilen, die Entwicklung des heutigen Erziehungsstils und das Bild des Kindes im Wandel der Zeit.
Welche Methodik wird in der Arbeit angewendet?
Das Methodenkapitel beschreibt die Vorgehensweise der Arbeit und erläutert die durchgeführte Literaturrecherche als Grundlage der Analyse.
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die jeweils den Inhalt und die wichtigsten Punkte der einzelnen Kapitel kurz und prägnant beschreiben. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über den gesamten Inhalt der Arbeit und erleichtern das Verständnis der komplexen Thematik.
Welche Bedeutung hat die Arbeit für die frühkindliche Pädagogik?
Die Arbeit hebt die Bedeutung des Themas für die frühkindliche Pädagogik hervor und verdeutlicht die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit dem Thema im Kontext sozialer und pädagogischer Berufe.
Wie wird der heutige Erziehungsstil in der Arbeit beschrieben?
Die Arbeit beleuchtet Aspekte des heutigen Erziehungsstils, wie die interaktive Erziehung, den Wunsch nach mehr Autorität und die sich verändernden Erziehungsorte innerhalb der Familie. Sie vergleicht den Erziehungsstil des 20. und 21. Jahrhunderts und stellt die Einflussfaktoren auf die Erziehung dar.
Gibt es einen Ausblick in der Arbeit?
Ja, das Schlusswort enthält einen Ausblick und Erwartungen zur zukünftigen Entwicklung von Erziehungsstilen.
- Quote paper
- BA Annika Dietrich (Author), 2016, Erziehungsstile im Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353568