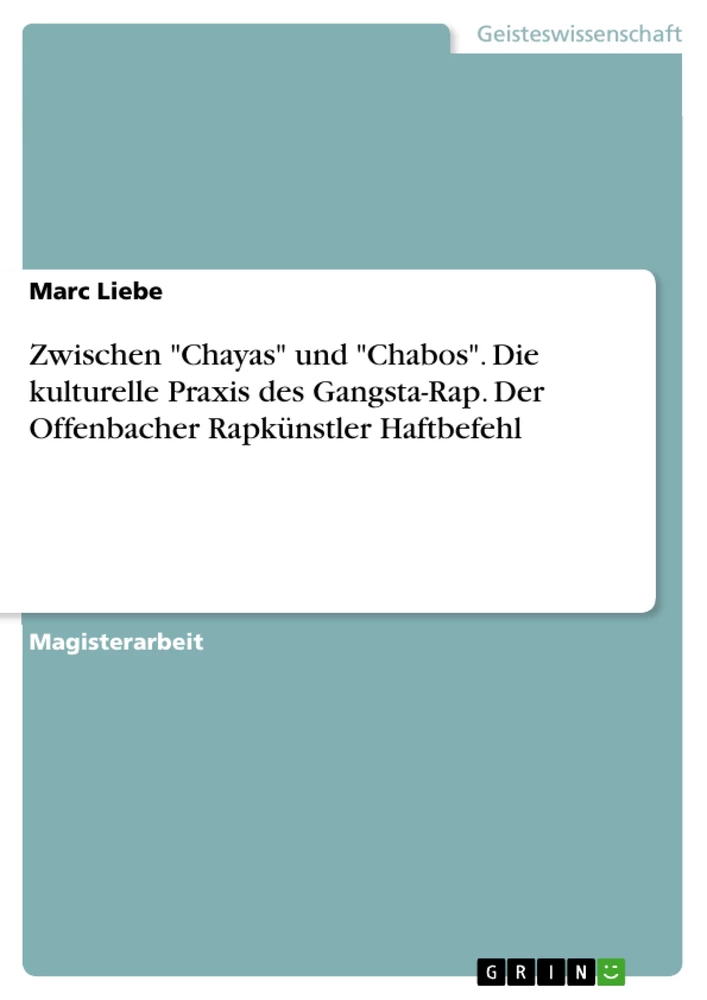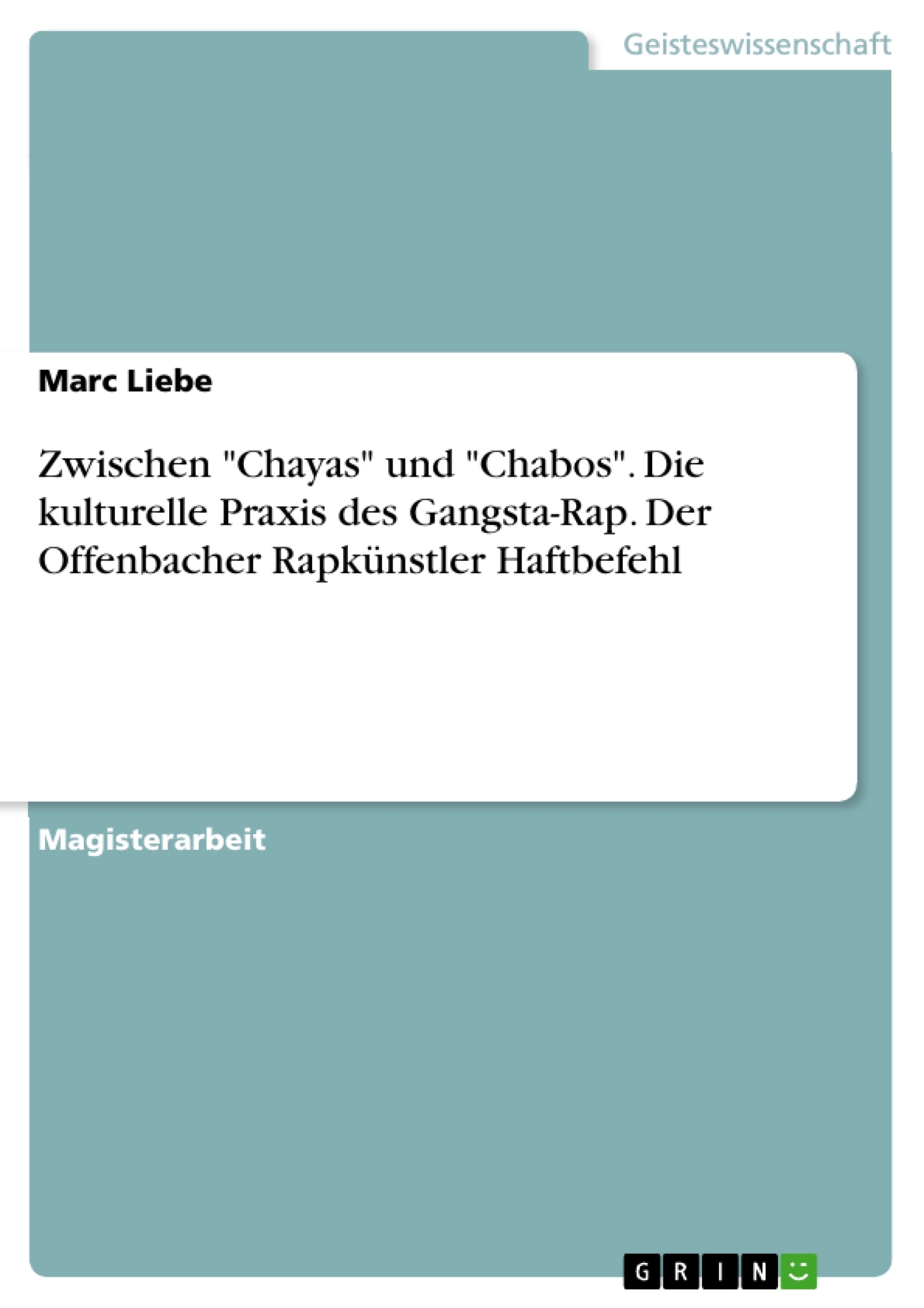Die Arbeit hat die kulturelle Praxis des Gangsta-Rap zum Thema und untersucht diese anhand deren Repräsentation und Performanz durch den Offenbacher Gangsta-Rapper Haftbefehl. Haftbefehl ist seit 2009 im Feld des deutschen Gangsta-Rap aktiv und kann mit seinem Debütalbum „Azzlack Stereotyp“ aus dem Jahre 2010 bereits einen Achtungserfolg verbuchen. In der Folge veröffentlicht er zwei weitere Alben und gründet sein eigenes Label Azzlackz. Aufgrund seines persönlichen kommerziellen Erfolges wird er im September 2013 von Universal Music unter Vertrag genommen. Durch die Unterstützung des Musikgiganten kann davon ausgegangen werden, dass der Erfolg des Offenbachers in naher Zukunft noch intensiviert wird, ist das Label ebenfalls die musikalische Heimat der beiden Rapper Sido und Bushido, die sich mit mehreren Goldschallplatten bereits im Mainstream etabliert haben.
Im Jahr 2012 ist die erste große wissenschaftliche Veröffentlichung, die sich mit dem Thema „Deutscher Gangsta-Rap“ unter Bezugnahme auf kulturwissenschaftliche, soziologische und linguistische Theorien auseinandersetzt, zu verzeichnen. Davor wurde das Thema „Gangsta-Rap“ hauptsächlich in den USA wissenschaftlich diskursiv aufgearbeitet. Aufbauend auf den Erkenntnissen von Dietrich/Seeliger und anderen wird in vorliegender Arbeit eine Transformation der kulturellen Praxis nach Pierre Bourdieu auf den Gangsta-Rap angestrebt. Die Leitfragen, anhand derer dieses Unterfangen vollzogen werden soll, sind folgende:
1.) Wie definiert sich ein Akteur des Gangsta-Rap-Feldes?;
2.) Was zeichnet den feldinternen Habitus aus?;
3.) Wie kommt es zu einem feldinternen Aufstieg?;
4.) Welche Funktionen haben Sprache und Ethnizität im Feld?;
5.) Gibt es eine Diskrepanz zwischen szeneinternen und -externen Diskurs?;
6.) Wie wird Gangsta-Rap in der Wissenschaft dargestellt?;
7.) Gibt es im Falle von Haftbefehl irgendwelche Besonderheiten, die vormals in der kulturellen Praxis des Gangsta-Rap nicht präsent waren?
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 1.1. Gegenstand der Arbeit und Leitfragen
- 1.2. Aufbau der Arbeit
- 2. Soziale Praxis nach Bourdieu
- 2.1. Sozialer Raum
- 2.2. Habitus
- 2.2.1. Geschmack
- 2.2.2. Die männliche Herrschaft
- 2.2.3. Sprache
- 2.3. Kapitalformen
- 2.4. Soziales Feld
- 2.5. Die kulturelle Praxis nach Bourdieu
- 3. Die Entstehung und Definition des Hip Hop
- 3.1. Rap
- 4. Entstehung und Definition des Gangsta-Rap
- 4.1. Gangsta-Rap in Deutschland
- 5. Neukontextualisierung der Gangsta-Rap-Praktiken
- 5.1. Identitätskonstruktion und -repräsentation
- 5.2. Authentizität
- 5.3. Performativität
- 5.4. Sprache
- 5.5. Ethnitizität
- 5.6.1. Der Krisendiskurs (2005-2009)
- 5.7. Geschlechtskonstruktionen
- 5.7.1. Männlichkeitskonstruktionen
- 5.8. Gettozentrizität und Urbanität
- 5.9. Lokalität und Neukontextualisierung
- 6. Inhalts- und Diskursanalyse
- 6.1. Auswahl des Untersuchungsmaterials
- 6.2. Methodisches Vorgehen
- 6.3. Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse
- 6.4. Diskursanalyse
- 6.5. Strukturierungsdimensionen und Kategorien
- 7. Die kulturelle Praxis des Gangsta-Rap darstellt in den Raptexten von Haftbefehl
- 7.1. Kurzbiografie von Haftbefehl
- 7.2. Die Funktion von Sprache und Ethnizität
- 7.2.1. Ethnizität als abgrenzendes Element
- 7.2.2. Sprache und Codes als Differenzierungsmassnahme
- 7.2.3. Diskursbetrachtung zur Funktion von Sprache und Ethnizität
- 7.2.4. Exkurs: Die Antisemitismus-Debatte
- 7.2.5. Zwischenfazit zur Funktion von Sprache und Ethnizität
- 7.3. Darstellung von Authentizität und Konstruktion einer Gangster-Identität
- 7.3.1. Gewaltdarstellung als Mittel zur Authentifizierung
- 7.3.2. Drogenhandel als Mittel der Authentifizierung
- 7.3.3. Gangsterfiguren als Mittel der Authentifizierung
- 7.3.4. Zuhälterei als Mittel der Authentifizierung
- 7.3.5. Diskursbetrachtung zur Importanz von Authentizität und Identität
- 7.3.6. Exkurs: Der Authentizitätstest im realen Leben
- 7.3.7. Zwischenfazit Authentizität und Gangster-Identität
- 7.4. Präsentation von sozialer Ungleichheit
- 7.4.1. Die Symbolik des Ghetto und Block als Raum der Hoffnungslosigkeit
- 7.4.2. Betäubung als Mittel zur Realitätsbewältigung
- 7.4.3. Die Stadt als Projektionsfläche der eigenen Identität
- 7.4.4. Repräsentation von Staat und Staatsgewalt
- 7.4.5. Repräsentation des Gefängnis
- 7.4.6. Diskursbetrachtung zur Repräsentation von sozialer Ungleichheit
- 7.4.7. Zwischenfazit zur Darstellung sozialer Ungleichheit
- 7.5. Geschlechtskonstruktionen im Gangsta-Rap
- 7.5.1. Die Symbolik der „Bitch“
- 7.5.2. Frauen als Status- und Sexsymbol
- 7.5.3. Sexualpraktiken als Artikulation der Männlichkeit
- 7.5.4. Weiblichkeit und Homophobie als Abgrenzungsmerkmal
- 7.5.5. Diskursbetrachtung zu Geschlechtskonstruktionen im Gangsta-Rap
- 7.5.6. Zwischenfazit zu Geschlechtskonstruktionen im Gangsta-Rap
- 7.6. Repräsentation von Rap- und Battle-Praktiken
- 7.6.1. Repräsentation der Skills
- 7.6.2. Diskreditierungstaktiken im Battle
- 7.6.3. Diffamierung der Deutsch-Rap-Szene
- 7.6.4. Diskursbetrachtung zu Rap- und Battle-Praktiken
- 7.6.5. Zwischenfazit zu Repräsentation von Rap- und Battle-Praktiken
- 7.7. Repräsentation des feldinternen und sozialen Aufstiegs
- 7.7.1. Das From Rags to Riches-Prinzip
- 7.7.2. Sozialer Aufstieg durch Bildung
- 7.7.3. Soziales Kapital als Mittel zum Aufstieg
- 7.7.4. Illustration des Erfolges in Form von Luxusgütern
- 7.7.5. Diskursbetrachtung zur Repräsentation des feldinternen und sozialen Aufstieg
- 7.7.6. Zwischenfazit zur Repräsentation des feldinternen und sozialen Aufstieg
- 8. Die Raum-Feld-Habitus-Symbiose am Beispiel Haftbefehls
- 9. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit zielt darauf ab, die kulturelle Praxis des Gangsta-Rap am Beispiel des Offenbacher Rapkünstlers Haftbefehl zu analysieren. Sie untersucht, wie der Künstler Sprache, Identität und soziale Ungleichheit in seinen Texten darstellt und damit die Bedeutung des Gangsta-Rap in der deutschen Gesellschaft widerspiegelt.
- Die Funktion von Sprache und Ethnizität im Gangsta-Rap.
- Die Konstruktion von Authentizität und Gangster-Identität.
- Die Repräsentation sozialer Ungleichheit und die Darstellung des Ghettos.
- Die Geschlechterkonstruktionen im Gangsta-Rap.
- Der feldinterne und soziale Aufstieg im Gangsta-Rap.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt den Gegenstand der Arbeit und die Leitfragen vor. Kapitel 2 erläutert das Konzept der sozialen Praxis nach Pierre Bourdieu und definiert wichtige Begriffe wie Sozialer Raum, Habitus, Kapitalformen und Soziales Feld.
Kapitel 3 und 4 befassen sich mit der Entstehung und Definition des Hip Hop und des Gangsta-Rap, wobei der Fokus auf die Entwicklung des Genres in Deutschland liegt. Kapitel 5 untersucht die Neukontextualisierung der Gangsta-Rap-Praktiken und beleuchtet Themen wie Identitätskonstruktion, Authentizität, Sprache, Ethnizität, Geschlechterkonstruktionen, Gettozentrizität und Lokalität.
Kapitel 6 beschreibt die methodische Vorgehensweise der Inhalts- und Diskursanalyse, die zur Analyse der Raptexte von Haftbefehl eingesetzt wird. Kapitel 7 analysiert die Raptexte von Haftbefehl, wobei die Funktion von Sprache und Ethnizität, die Darstellung von Authentizität und Gangster-Identität, die Repräsentation sozialer Ungleichheit, die Geschlechterkonstruktionen, die Repräsentation von Rap- und Battle-Praktiken sowie die Repräsentation des feldinternen und sozialen Aufstiegs im Fokus stehen.
Kapitel 8 untersucht die Raum-Feld-Habitus-Symbiose am Beispiel Haftbefehls und Kapitel 9 bietet ein Fazit und einen Ausblick auf die Zukunft des Gangsta-Rap in Deutschland.
Schlüsselwörter (Keywords)
Gangsta-Rap, Haftbefehl, Sprache, Ethnizität, Authentizität, Identität, Soziale Ungleichheit, Ghetto, Geschlechterkonstruktionen, Sozialer Aufstieg, Kultur, Popkultur, Diskursanalyse.
- Quote paper
- Marc Liebe (Author), 2014, Zwischen "Chayas" und "Chabos". Die kulturelle Praxis des Gangsta-Rap. Der Offenbacher Rapkünstler Haftbefehl, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353479