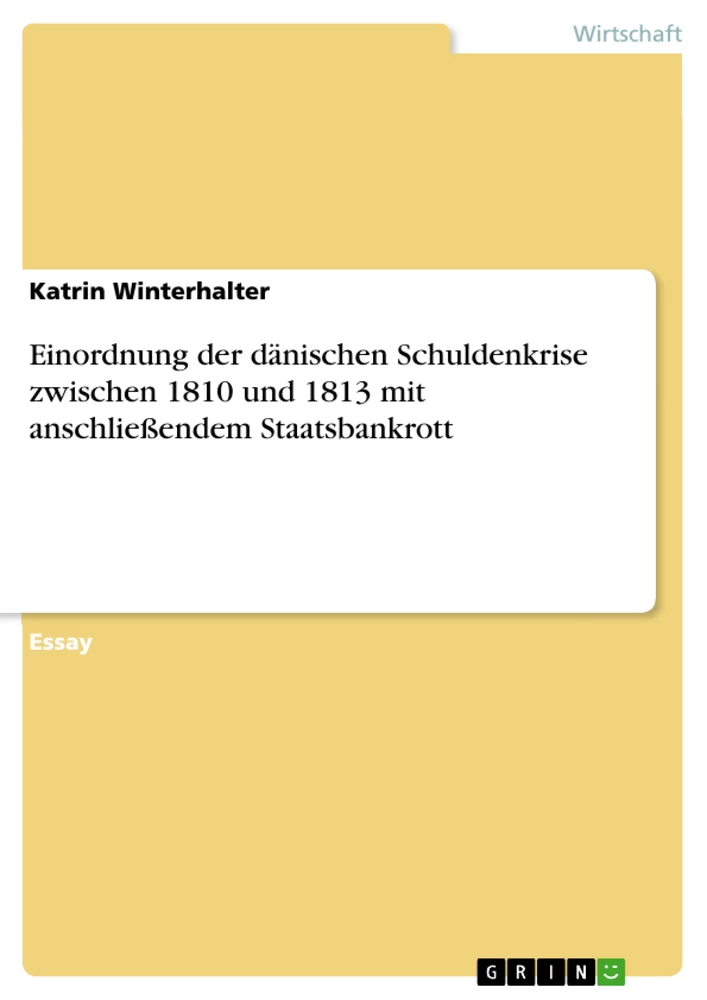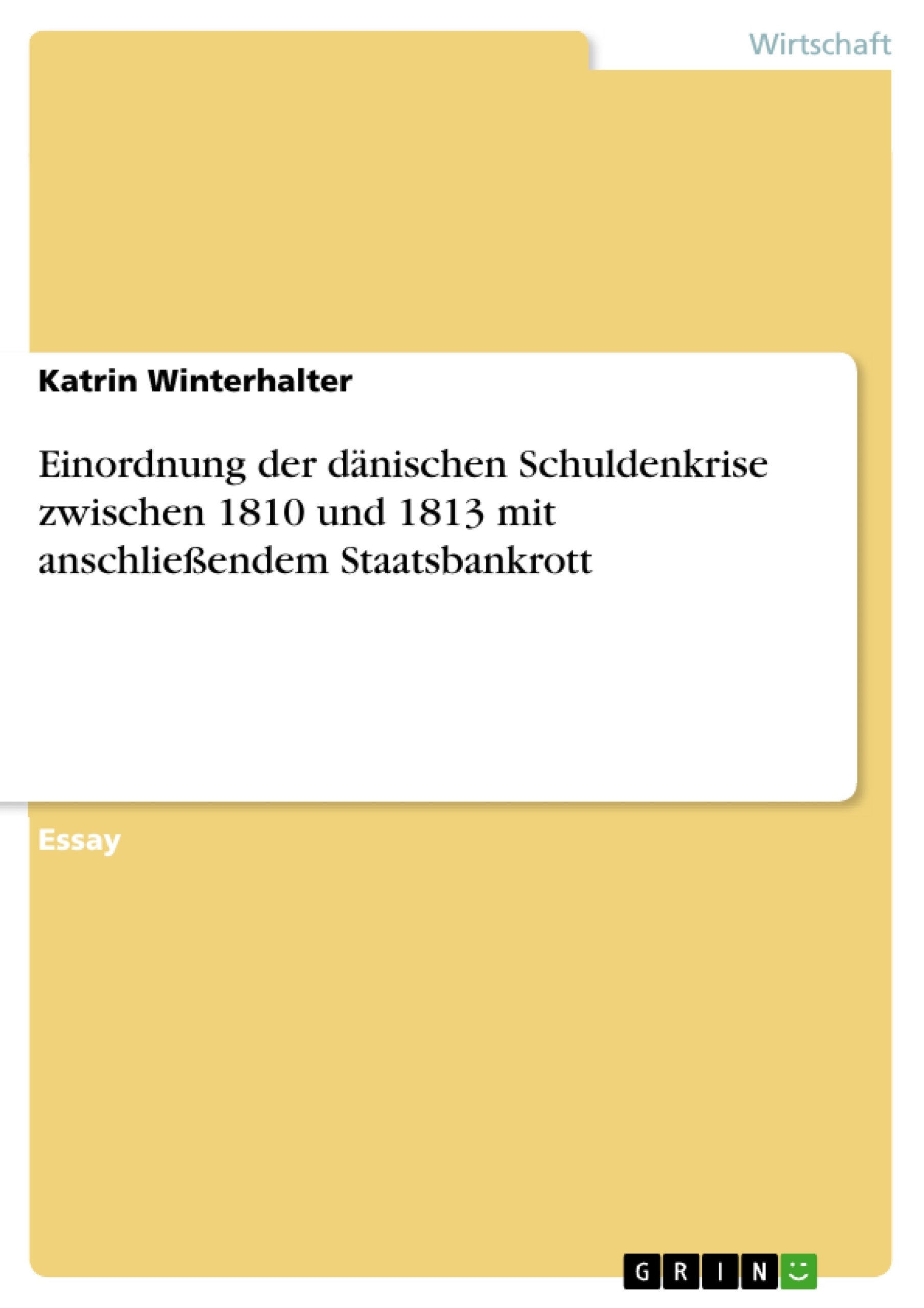„Countries don’t go bust!“ Diese, inzwischen vielfach zitierte, Aussage, prägte der von 1967 bis 1987 amtierende Vorstandsvorsitzende der Citibank Walter Wriston in einer Zeit, als seine Bank dafür in der Kritik stand, mehreren hochverschuldeten Mittel- und Südamerikanischen Ländern Kredite auszugeben. Die Kritik war nicht unbegründet: Tatsächlich zählte der Lateinamerikanische Kontinent alleine in Wristons Amtszeit ganze 23 Staatspleiten.
Solch ein Sachverhalt scheint in der Historie weltweiter Schuldenkrisen nicht neu. Mit allerhand Tricks und beschwichtigenden Worten wird die Schwere der Probleme kleingehalten. Entstand Wristons Credo nun aus reiner Unwissenheit oder verfolgte er einen durchdachten Plan? Lassen sich auf diese Weise Gläubiger, die Bevölkerung oder Handelspartner beruhigen? Gibt es wiederkehrende Verhaltensmuster, die Schuldenkrisen auszeichnen? Diese Fragen sollen auf den folgenden Seiten geklärt werden, wobei der praktische Bezug die dänische Schuldenkrise von 1810 bis 1813 mit anschließendem Staatsbankrott darstellt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einordnung der dänischen Schuldenkrise zwischen 1810 und 1813 mit anschließendem Staatsbankrott
- Die dänische Schuldenkrise im historischen Kontext
- Währungsreform 1791 und die Speciesbank
- Handelskrise und Kriege im ausgehenden 18. Jahrhundert
- Die Auswirkungen der Kriege auf die Kurantbank
- Analyse der Ursachen und Folgen der dänischen Schuldenkrise
- Der Zusammenhang zwischen Bankwesen und Staatsschulden
- Die Rolle der Globalisierung und der Ansteckungseffekte
- Die Bedeutung von Vertrauen und Erwartungen
- Vergleich mit anderen Schuldenkrisen
- Schuldenintoleranz und die Anfälligkeit für Schuldenkrisen
- Der Zusammenhang zwischen Schuldenkrisen und der Anzahl der in der Vergangenheit überwundener Krisen
- Der Staatsbankrott Dänemarks 1813
- Die Folgen des Staatsbankrotts für die dänische Wirtschaft
- Der Währungsschnitt 1813 und die Immobiliensteuer
- Vergleich mit dem Währungsschnitt in Westdeutschland 1948
- Langfristige Auswirkungen von Finanzkrisen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Dieser Essay analysiert die dänische Schuldenkrise von 1810 bis 1813 und den damit verbundenen Staatsbankrott. Dabei wird die Krise im historischen Kontext beleuchtet und vor dem Hintergrund theoretischer Erkenntnisse zu Schulden- und Finanzkrisen betrachtet. Der Essay zielt darauf ab, die Ursachen und Folgen der Krise zu untersuchen und die Bedeutung von Vertrauen, Erwartungen und politischen Entscheidungen in dieser Zeit zu verdeutlichen.
- Die dänische Schuldenkrise im historischen Kontext
- Die Rolle von Bankwesen und Staatsschulden in der Krise
- Die Bedeutung von Vertrauen und Erwartungen für die Stabilität des Finanzsystems
- Der Vergleich mit anderen Schuldenkrisen und die Rolle von Schuldenintoleranz
- Die langfristigen Auswirkungen von Finanzkrisen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Der Essay beginnt mit einer Einführung in die dänische Schuldenkrise von 1810 bis 1813. Die Krise wird im Kontext der internationalen Finanzgeschichte und der Geschichte des dänischen Bankwesens betrachtet. Es werden die Ursachen der Krise, wie beispielsweise die Auswirkungen der napoleonischen Kriege und die fehlende Einlösepflicht der Banknoten, untersucht.
Im zweiten Teil des Essays werden die Folgen der Schuldenkrise für die dänische Wirtschaft analysiert. Dabei wird der Staatsbankrott von 1813 und der damit verbundene Währungsschnitt sowie die Einführung einer Immobiliensteuer beleuchtet. Der Essay stellt außerdem den Zusammenhang zwischen Bankkrisen und Schuldenkrisen dar und analysiert die Rolle von Vertrauen und Erwartungen in dieser Zeit.
Im dritten Teil des Essays wird die dänische Schuldenkrise mit anderen internationalen Schuldenkrisen verglichen. Der Essay untersucht die Bedeutung von Schuldenintoleranz und die Anfälligkeit von Ländern für Schuldenkrisen. Es werden außerdem die langfristigen Auswirkungen von Finanzkrisen auf die Wirtschaft eines Landes diskutiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die dänische Schuldenkrise, Staatsbankrott, Schuldenintoleranz, Bankwesen, Staatsschulden, Vertrauen, Erwartungen, Globalisierung, Ansteckungseffekte, Finanzkrisen, Währungsreform, Währungsschnitt, Immobiliensteuer, historische Analyse, Finanzgeschichte.
- Quote paper
- Katrin Winterhalter (Author), 2017, Einordnung der dänischen Schuldenkrise zwischen 1810 und 1813 mit anschließendem Staatsbankrott, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353382