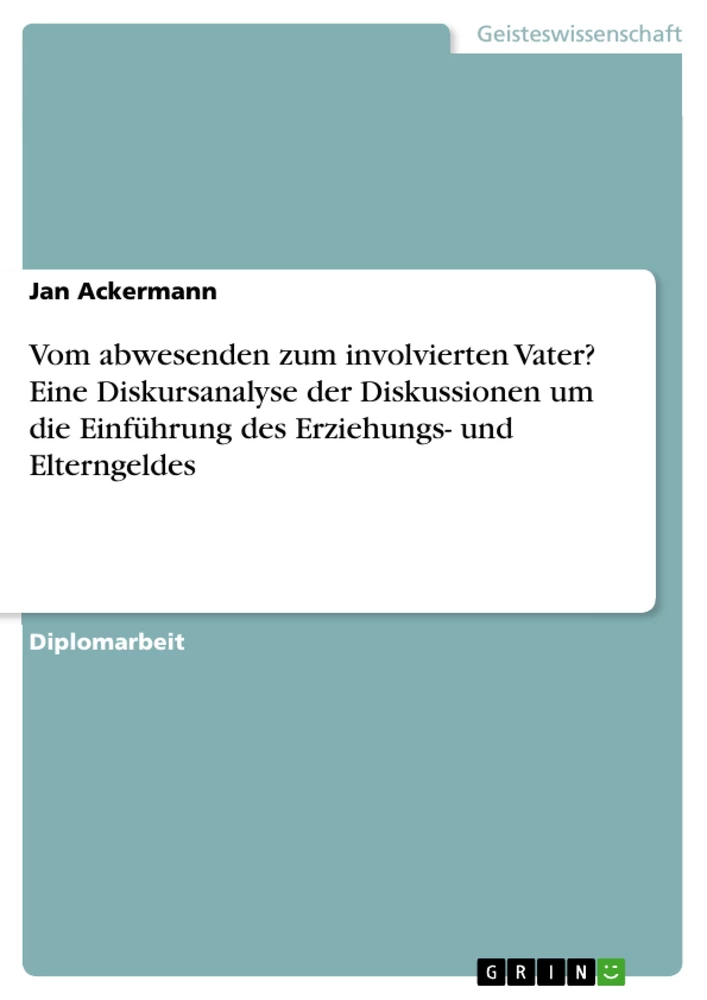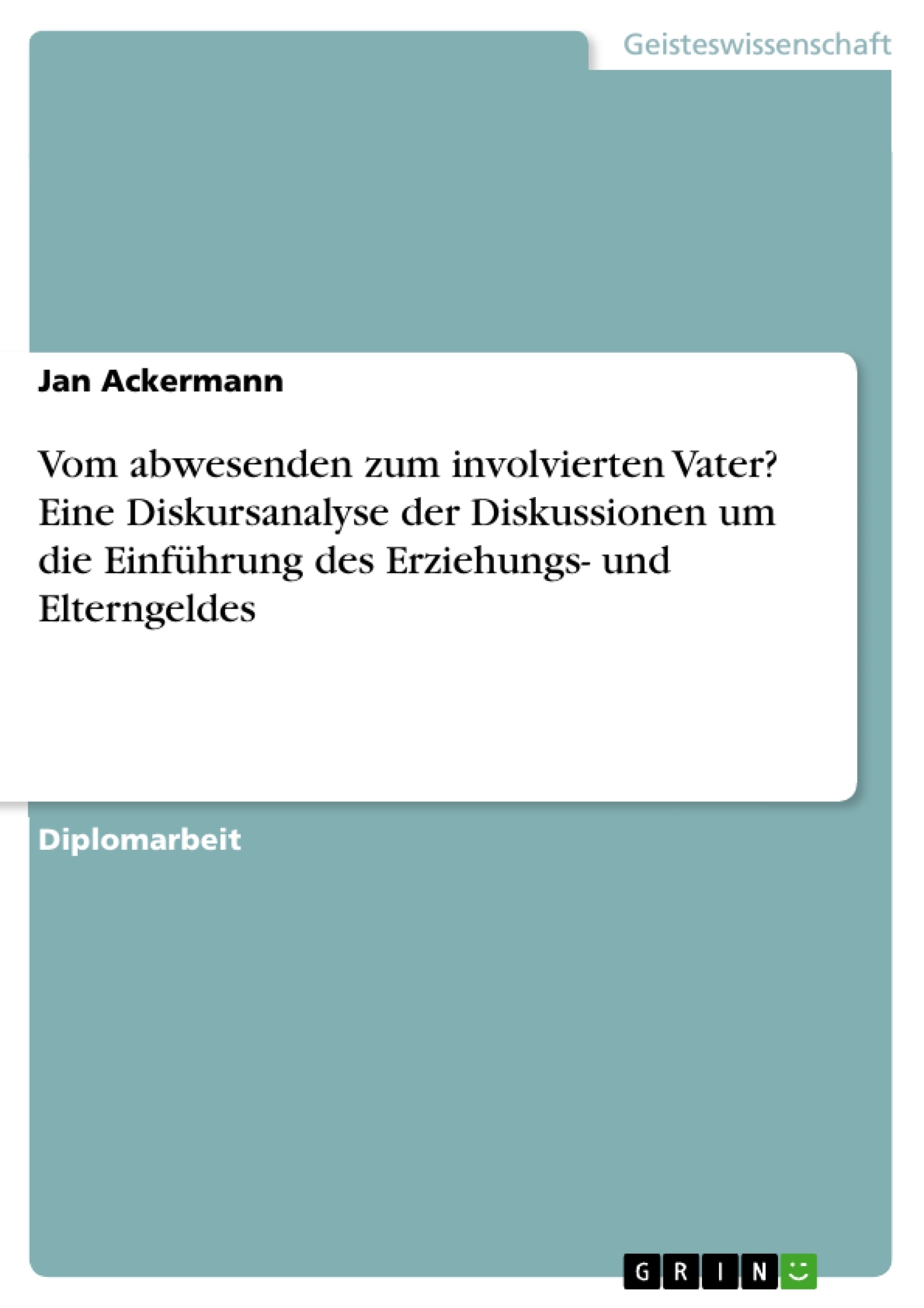In der Arbeit wird anhand der medialen Debatten um die Einführung des Erziehungsgeldes 1985 und um die Einführung des Elterngeldes 2006 die Frage untersucht, welche Bilder von Vaterschaft darin jeweils produziert werden und inwiefern sich dabei ein diskursiver Wandel beobachten lässt. Die Analyse des Vaterschaftsdiskurses wird dabei theoretisch eingebettet in Arbeiten zu Form und Funktion von Männlichkeit in der bürgerlichen Gesellschaft und in Beziehung gesetzt zum gesellschaftlichen Wandel und der tatsächlichen sozialen Praxis von Vätern.
Seit Entstehung der modernen kapitalistischen Gesellschaft und dem mit ihr verbundenen Leitbild der bürgerlichen Familie unterliegt die Rolle des Vaters in dieser Konstellation einem Wandel. Anne-Charlott Trepp konnte beispielsweise zeigen, wie sich bürgerliche Männer im Laufe des 19. Jahrhunderts immer weiter aus der Familie zurückzogen und auch dort die in der öffentlichen Sphäre wichtigen Verhaltensmuster kultivierten. Parallel zur Entstehung des bürgerlichen Familienmodells und der sich durchsetzenden Trennung von öffentlicher und privater Sphäre wurde mit großem Aufwand zunächst diskursiv die Polarisierung der Geschlechtscharaktere konstruiert, die sich im Laufe des 20. Jahrhunderts gemeinsam mit der bürgerlichen Familie klassenübergreifend verallgemeinerte. Die Zuweisung von Frauen an den privat organisierten reproduktiven Bereich und Männern an den öffentlichen Bereich von Staat und Warenproduktion, sowie die geschlechtsspezifische Kultivierung entsprechender Eigenschaften und Fähigkeiten ist eng mit der Entwicklung der modernen kapitalistischen Gesellschaftsform verknüpft. 1963 fasst Alexander Mitscherlich diese Entwicklung zeitdiagnostisch als Weg zur vaterlosen Gesellschaft zusammen.
Während die Diskussion um abwesende Väter bis in die Gegenwart anhält, zeichnet sich gleichzeitig eine gegenläufige Entwicklung ab: Unter den Schlagworten neue Väter oder involvierte Vaterschaft wird an Väter zunehmend der Anspruch gestellt, sich in familiale Sorgetätigkeiten einzubringen und dabei auch Emotionen zu zeigen. Beginnt damit auf diskursiver Ebene die Auflösung der modernen Polarisierung der Geschlechtscharaktere und eine neue Integration von Emotionalität und Sorge in hegemoniale Männlichkeit? In der Arbeit soll die Frage untersucht werden, welche Veränderungen sich im medialen Vaterschaftsdiskurs zwischen 1985 und 2006 feststellen lassen und wie diese vor dem dargestellten Hintergrund zu interpretieren wären.
Häufig gestellte Fragen zu "Language Preview"
Was ist das Ziel dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht anhand der medialen Debatten um die Einführung des Erziehungsgeldes 1985 und des Elterngeldes 2006, welche Bilder von Vaterschaft produziert werden und ob ein diskursiver Wandel zu beobachten ist.
In welchen theoretischen Rahmen ist die Analyse eingebettet?
Die Analyse ist eingebettet in Arbeiten zu Form und Funktion von Männlichkeit in der bürgerlichen Gesellschaft und in Beziehung gesetzt zum gesellschaftlichen Wandel und der tatsächlichen sozialen Praxis von Vätern.
Welche übergeordneten Fragen werden in der Arbeit gestellt?
Es soll untersucht werden, inwiefern die Diskussion um "neue Väter" und "involvierte Vaterschaft" die moderne Polarisierung der Geschlechtscharaktere aufhebt und ob eine so umgestaltete Männlichkeit noch mit dem Hegemoniebegriff zu fassen ist.
Wie werden Diskurse und soziale Praxis in der Arbeit betrachtet?
Diskurse und soziale Praxis werden als verschiedene Ebenen gesellschaftlicher Realität betrachtet, die sich gegenseitig beeinflussen. Diskurse stellen Deutungs- und Orientierungswissen bereit, das soziale Praxis und das Selbstverhältnis ausrichtet.
Welche Forschungsmethode wird verwendet?
Für die empirische Untersuchung des Vaterschaftsdiskurses wird die Kritische Diskursanalyse (KDA) nach Siegfried Jäger als Forschungsmethode verwendet.
Welche Materialien werden für die Analyse verwendet?
Der Materialkorpus besteht aus Artikeln aus der ZEIT, dem SPIEGEL und dem Familienmagazin Eltern.
Welche Zeiträume werden in der Analyse betrachtet?
Die Analyse konzentriert sich auf die Debatten um die Einführung des Erziehungsgeldes im Jahr 1985 und die Einführung des Elterngeldes im Jahr 2006.
Welche theoretischen Konzepte werden zur Analyse von Männlichkeit herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf das Konzept der hegemonialen Männlichkeit (Raewyn Connell), Überlegungen zu männlicher Herrschaft (Pierre Bourdieu), und die Konzeption hegemonialer Männlichkeit als 'institutionalisierte Praxis' und 'generatives Prinzip' (Michael Meuser und Sylka Scholz).
Was sind die zentralen Kategorien der Regulationstheorie, die in der Arbeit verwendet werden?
Die Arbeit verwendet Kategorien wie Akkumulationsregime, Regulationsweise, Gesellschaftsformationen, Entwicklungsweise und Reproduktionsweise, um gesamtgesellschaftliche Transformationsprozesse zu beschreiben.
Welche Dimensionen von Geschlecht werden nach Connell betrachtet?
Connell unterscheidet Machtbeziehungen, Produktionsbeziehungen, emotionale Bindungsstruktur (Kathexis), und symbolische Dimensionen von Geschlecht.
Was versteht Bourdieu unter symbolischer Gewalt?
Symbolische Gewalt ist jene sanfte, für ihre Opfer unmerkliche, unsichtbare Gewalt, die im wesentlichen über die rein symbolischen Wege der Kommunikation und des Erkennens ausgeübt wird.
- Citar trabajo
- Jan Ackermann (Autor), 2015, Vom abwesenden zum involvierten Vater? Eine Diskursanalyse der Diskussionen um die Einführung des Erziehungs- und Elterngeldes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353356