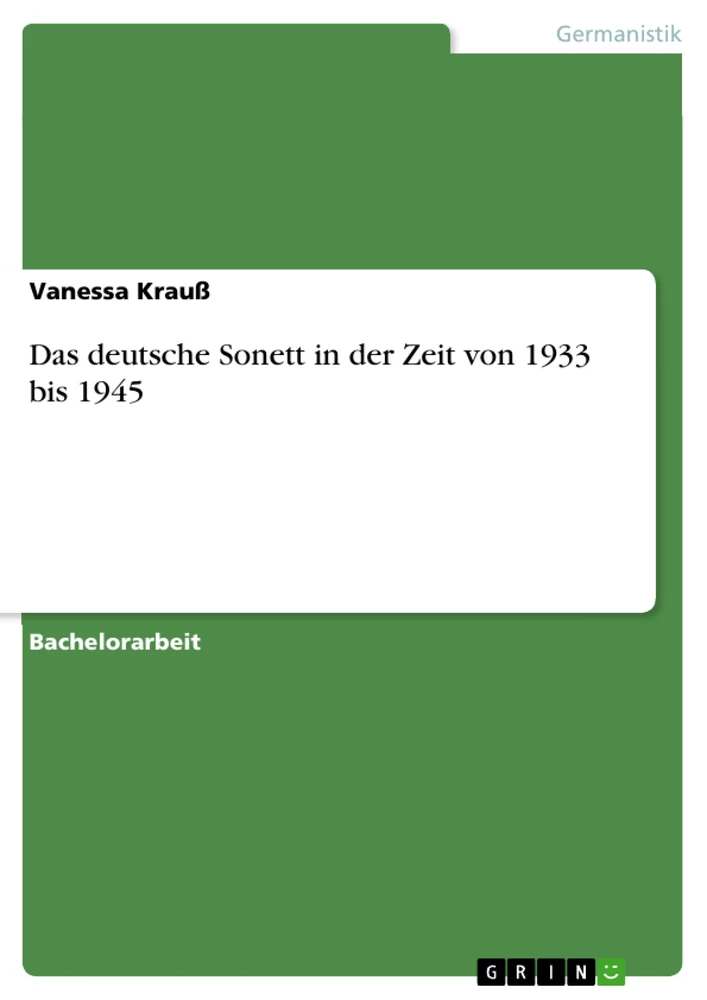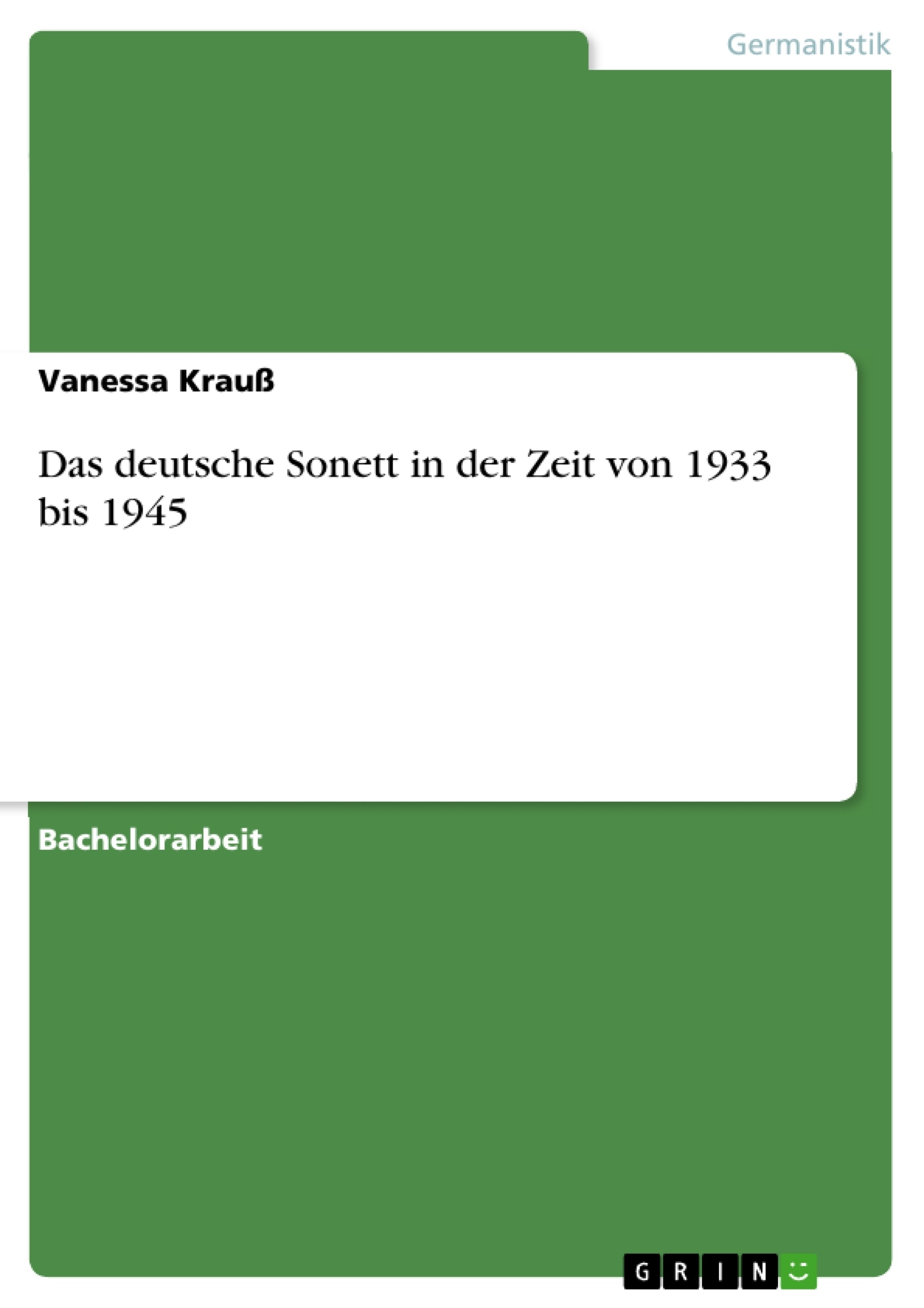Die einzige Gedichtform, die in der neueren deutschen Lyrik vom Barock bis heute mit nur geringen Unterbrechungen häufig verwendet wurde, ist das Sonett. Bei der Zeit von 1933 bis 1945, bekannt als die Zeit des Nationalsozialismus, handelt es sich um keine dieser ‚geringen Unterbrechungen‘, sondern eher um das Gegenteil: Die Sonettproduktion vor und nach 1945 ist von so großem Umfang, dass sie quantitativ die ‚Sonettenflut‘ der Romantik wohl noch übertrifft. Auch wenn für die vorliegende Untersuchung die Nachkriegszeit des zweiten Weltkriegs nicht mehr in Betracht gezogen wird, so liegt aus dem gewählten Zeitraum doch eine große Anzahl Sonette vor.
Um die in der Zeit von 1933 bis 1945 produzierten, d. h. geschriebenen, wenn auch nicht unbedingt veröffentlichten, Sonette soll es in der vorliegenden Arbeit gehen. Diese Unterscheidung zwischen Produktion und Publikation ist hierbei bedeutsam, da viele Sonette zwar im relevanten Zeitraum entstanden sind, aber erst nach Ende des Krieges veröffentlicht wurden. Vernachlässigt man diesen Aspekt, kann man zu dem Schluss kommen, dass das Sonett erst ab 1945 zu ‚wuchern' beginnt.
Aufgrund ihrer Bedeutung für die deutsche Geschichte wurde die Zeit des sogenannten Dritten Reichs auch literarisch eingehend untersucht, und es liegen Untersu-chungen zur nationalsozialistischen Literatur sowie zur Exilliteratur und zur Literatur der Inneren Emigration bzw. des Widerstandes vor. Für die vorliegende Arbeit wurde ein anderer Fokus gewählt: Statt der Literatur oder, etwas weniger breit betrachtet, Lyrik der verschiedenen Flügel der Zeit von 1933 bis 1945 im Allgemeinen soll nur die literarische Form des Sonetts betrachtet werden.
Auffällig ist nämlich, dass das Sonett zwischen 1933 und 1945 nicht vornehmlich in einem der genannten Flügel verwendet wurde, sondern in allen. Die Frage, die sich diesbezüglich unweigerlich aufdrängt, ist, warum in diesen so unterschiedlichen Strömungen immer wieder die gleiche lyrische Form verwendet wurde.
Anhand beispielhafter Analysen von Sonetten der verschiedenen Flügel sollen daher im Folgenden verschiedene Funktionen und Tendenzen in der Sonettdichtung der Zeit von 1933 bis 1945 untersucht werden. In Verbindung mit den verschiedenen, sich in den Sonetten manifestierenden Intentionen werden auch die (Nicht-)Traditionalität und die sich möglicherweise zeigenden Spielräume in Bezug auf die Formalia der Sonetttradition betrachtet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Heranführung an die Thematik
- 2.1 Sonetttradition
- 2.2 Gliederung der Zeit von 1933 bis 1945
- 3 Analyse des Sonettkorpus
- 3.1 Sonette im Nationalsozialismus
- 3.1.1 Gerhard Schumann
- 3.1.2 Josef Weinheber
- 3.1.3 Zwischenfazit Nationalsozialismus
- 3.2 Sonette in der Inneren Emigration
- 3.2.1 Albrecht Haushofer
- 3.2.2 Reinhold Schneider
- 3.2.3 Zwischenfazit Innere Emigration
- 3.3 Sonette im Exil
- 3.3.1 Johannes R. Becher
- 3.3.2 Bertolt Brecht
- 3.3.3 Zwischenfazit Exil
- 4 Fazit
- 5 Literaturverzeichnis
- 5.1 Primärliteratur
- 5.2 Sekundärliteratur und Anthologien
- 6 Textanhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit befasst sich mit der deutschen Sonettdichtung im Zeitraum von 1933 bis 1945 und untersucht die Rolle des Sonetts in den verschiedenen Strömungen der Zeit: Nationalsozialismus, Innere Emigration und Exil. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Funktionen und Tendenzen des Sonetts in diesen Kontexten zu analysieren und dabei auch auf die (Nicht-)Traditionalität der formalen Elemente einzugehen.
- Die Verwendung des Sonetts in unterschiedlichen Strömungen der Zeit von 1933 bis 1945
- Die Funktionen und Tendenzen des Sonetts in Bezug auf die verschiedenen Strömungen
- Die (Nicht-)Traditionalität des Sonetts in Bezug auf Form und Inhalt
- Die Rolle des Sonetts als literarische Form in einer Zeit großer gesellschaftlicher und politischer Umbrüche
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Bedeutung des Sonetts in der deutschen Literaturgeschichte dar und führt in die Fragestellung der Arbeit ein. Sie hebt die Relevanz des Sonetts in der Zeit von 1933 bis 1945 hervor, in der trotz der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen eine Vielzahl von Sonetten produziert wurde.
Das zweite Kapitel bietet einen theoretischen Überblick über die Sonetttradition und die verschiedenen Formen des Sonetts, insbesondere die italienische, englische und französische Form. Dabei wird auch auf die traditionellen Themen und Inhalte des Sonetts eingegangen.
Das dritte Kapitel analysiert exemplarisch Sonette aus den verschiedenen Strömungen der Zeit von 1933 bis 1945: Nationalsozialismus, Innere Emigration und Exil. Dabei werden die Funktionen und Tendenzen des Sonetts in diesen Kontexten beleuchtet, zum Beispiel die Verwendung des Sonetts als Instrument der Propaganda im Nationalsozialismus oder die Reflexion auf die Situation im Exil.
Das vierte Kapitel, das Fazit, fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und beantwortet die Forschungsfrage der Arbeit.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit dem deutschen Sonett in der Zeit von 1933 bis 1945. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind daher: Sonett, deutsche Literatur, Nationalsozialismus, Innere Emigration, Exil, Form, Inhalt, Tradition, (Nicht-)Traditionalität, Funktionen, Tendenzen, Analyse, Literaturgeschichte.
- Quote paper
- Vanessa Krauß (Author), 2016, Das deutsche Sonett in der Zeit von 1933 bis 1945, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353100