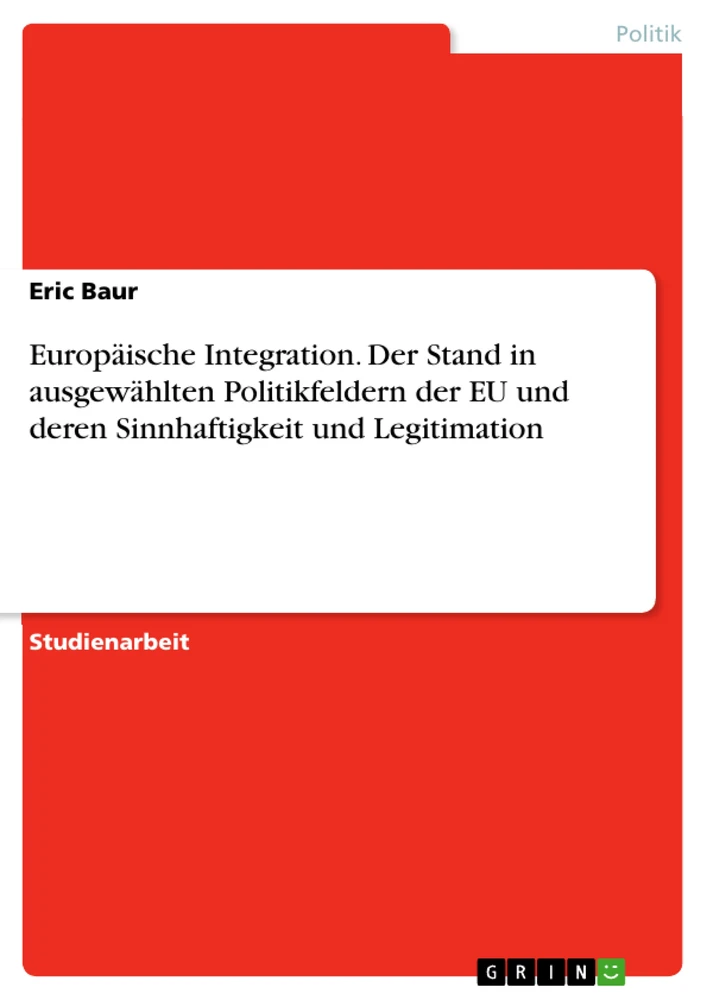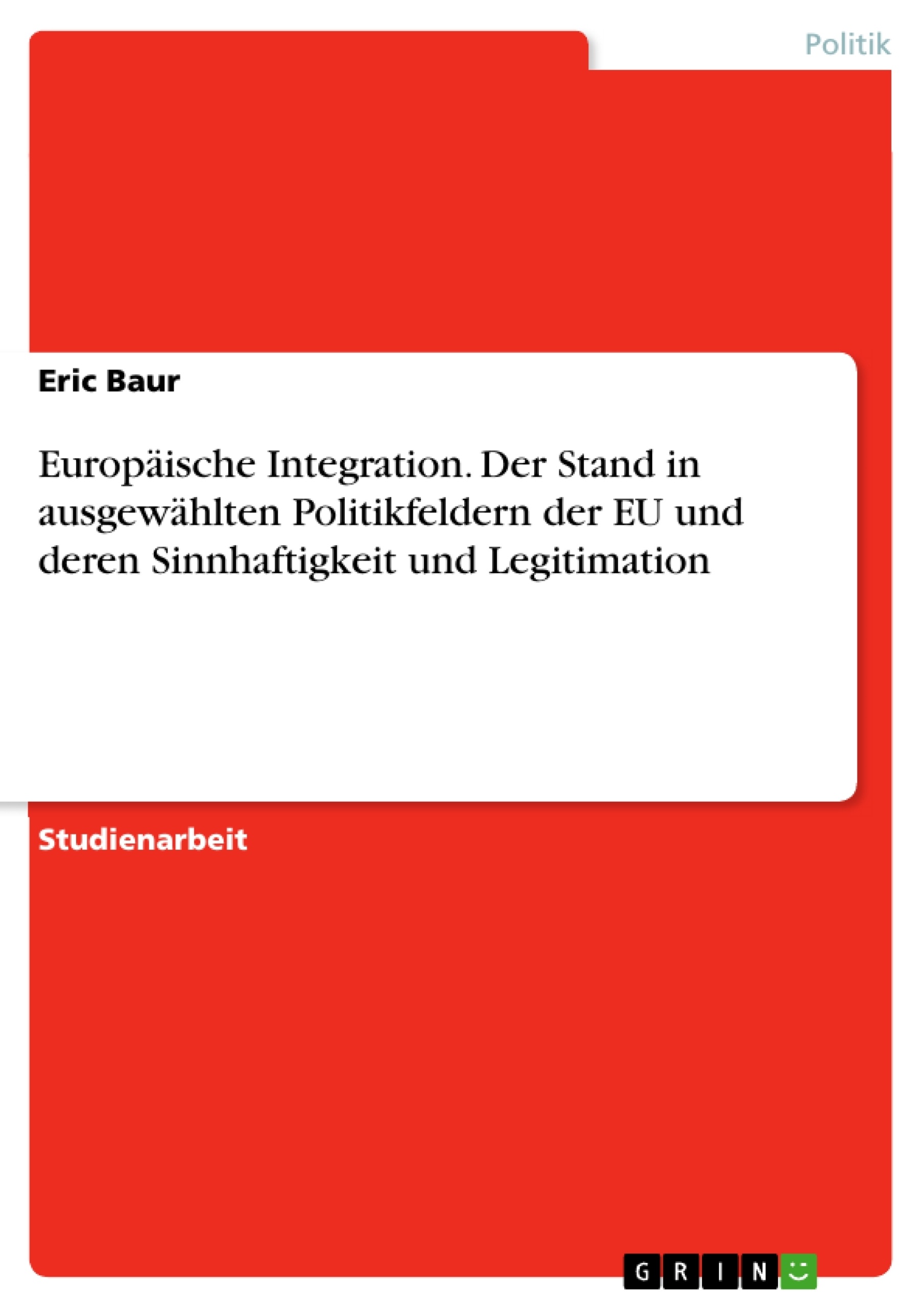Die Europäische Union, im Folgenden EU genannt, steckt in einer existenziellen Krise. Über die Bewältigung der Flüchtlingskrise sind sich die Partner nicht einig, sie befeuert den zumeist antieuropäischen Rechtspopulismus in vielen Mitgliedsstaaten, der in Großbritannien bereits zu einem Votum gegen die Mitgliedschaft des Landes in der Staatengemeinschaft geführt hat. In einigen jüngeren Demokratien des ehemaligen Warschauer Paktes, die erst seit dem Ende des Kalten Krieges in der EU sind, etablieren rechtsgerichtete Regierungen autokratische Strukturen, die den liberalen Statuten des Staatenbundes teilweise unvereinbar entgegenstehen. Zusätzlich bringt sich Russland in der ehemaligen sowjetischen Hemisphäre als aggressiver Konkurrent der EU-Osterweiterung in Stellung und buhlt um den Einfluss auf die früheren Satellitenstaaten des östlichen Militärbündnisses. Zudem ist Moskau zu einem Tabubruch bereit und missachtet, wenn nötig, bei seiner Expansionsstrategie territoriale Grenzen. Außerdem scheint es so, als vollführen die USA in Zukunft jenen Rückzug als militärische Schutzmacht Europas, den sie bereits seit Ende des Kalten Krieges angekündigt hatten. Schließlich muss sich die EU zunehmend auch interne Kritik über ihre undemokratische Ausrichtung gefallen lassen.
Dennoch hält der Staatenbund nach wie vor an Bestrebungen fest, die Integration der Union weiter voranzutreiben, sowohl vertikal bei der weiteren inneren soziopolitischen Vertiefung als auch horizontal bei der beabsichtigten geopolitischen Erweiterung, obwohl ein Festhalten an dieser althergebrachten Strategie angesichts der oben geschilderten außen- wie innenpolitischen Umstände als wenig sinnvoll erscheint. Ausgehend von den ursprünglichen Denkmodellen einer europäischen Einigung im 20. Jahrhundert beleuchtet die Arbeit den Stand der Integration in ausgewählten Politikfeldern der EU und erörtert deren Sinnhaftigkeit und Legitimation. Den Ausführungen schließt sich ein Fazit an, das einen Ausblick in die Zukunft wagt und Handlungsempfehlungen ausspricht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Churchill-Papier: Die Vereinigten Staaten von Europa
- 2.2. Die Paneuropabewegung Coudenhove-Kalergis
- 2.3. De Gaulles Europa der Vaterländer
- 3. Der Integrationsgrad der Politikfelder
- 3.1. Höchster Grad der Integration: Der EU-Binnenmarkt
- 3.2. Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik
- 3.3. Das Prinzip der Subsidiarität
- 3.4. Die EU als defizitäre und intransparente supranationale Demokratie
- 3.5. Nation-Building am Scheideweg
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die europäische Integration im Kontext aktueller Herausforderungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Erörterung des Integrationsgrads in ausgewählten Politikfeldern der Europäischen Union (EU). Dabei werden die historischen Wurzeln der europäischen Einigung betrachtet, die Relevanz der EU im 21. Jahrhundert beleuchtet und die Sinnhaftigkeit sowie Legitimation der Integration in der heutigen Zeit hinterfragt.
- Die historische Entwicklung der europäischen Integration
- Die Herausforderungen der EU im 21. Jahrhundert
- Der Integrationsgrad in verschiedenen Politikfeldern der EU
- Die Legitimität und Sinnhaftigkeit der europäischen Integration
- Zukünftige Perspektiven für die EU
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Das Kapitel beschreibt die aktuelle Krise der EU und die externen sowie internen Herausforderungen, mit denen die Union konfrontiert ist. Es werden die Hintergründe der Krise, wie beispielsweise die Flüchtlingskrise und der Aufstieg des Rechtspopulismus, erläutert. Zudem werden die Bestrebungen zur weiteren Integration der EU trotz der aktuellen Schwierigkeiten beleuchtet.
2. Theoretische Grundlagen
2.1. Churchill-Papier: Die Vereinigten Staaten von Europa
Dieses Kapitel behandelt die Vision Winston Churchills für eine „United States of Europe“ als Lösung für die Konflikte in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Es wird die Rolle Deutschlands und Frankreichs in dieser Vision betont und die Bedeutung des gemeinsamen Binnenmarktes für die aktuelle Integration der EU hervorgehoben.
2.2. Die Paneuropabewegung Coudenhove-Kalergis
Das Kapitel stellt die Paneuropabewegung von Richard von Coudenhove-Kalergi vor, der bereits in den 1920er-Jahren eine tiefgreifende Integration Europas anstrebte. Es wird die historische Situation, die Entstehung der Bewegung und die Ziele von Coudenhove-Kalergi, insbesondere die Schaffung eines föderalen europäischen Bundesstaates, beschrieben.
3. Der Integrationsgrad der Politikfelder
3.1. Höchster Grad der Integration: Der EU-Binnenmarkt
Dieses Kapitel behandelt den EU-Binnenmarkt als ein Beispiel für den höchsten Grad der Integration in der EU. Es werden die Bedeutung und die Herausforderungen des Binnenmarktes sowie die Auswirkungen auf die nationalen Wirtschaften diskutiert.
3.2. Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik
Hier werden die Herausforderungen und Fortschritte der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU beleuchtet. Es wird auf die Rolle der EU in der internationalen Sicherheitspolitik und die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten eingegangen.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Europäischen Integration, insbesondere den Herausforderungen und Chancen der EU im 21. Jahrhundert. Die Analyse umfasst den Integrationsgrad in verschiedenen Politikfeldern, die historische Entwicklung der europäischen Integration sowie die Legitimität und Sinnhaftigkeit der EU. Schlüsselbegriffe sind: Europäische Union, Integration, Binnenmarkt, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Rechtspopulismus, Flüchtlingskrise, Nation-Building, supranationale Demokratie, Churchill, Coudenhove-Kalergi.
- Quote paper
- Eric Baur (Author), 2016, Europäische Integration. Der Stand in ausgewählten Politikfeldern der EU und deren Sinnhaftigkeit und Legitimation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353073