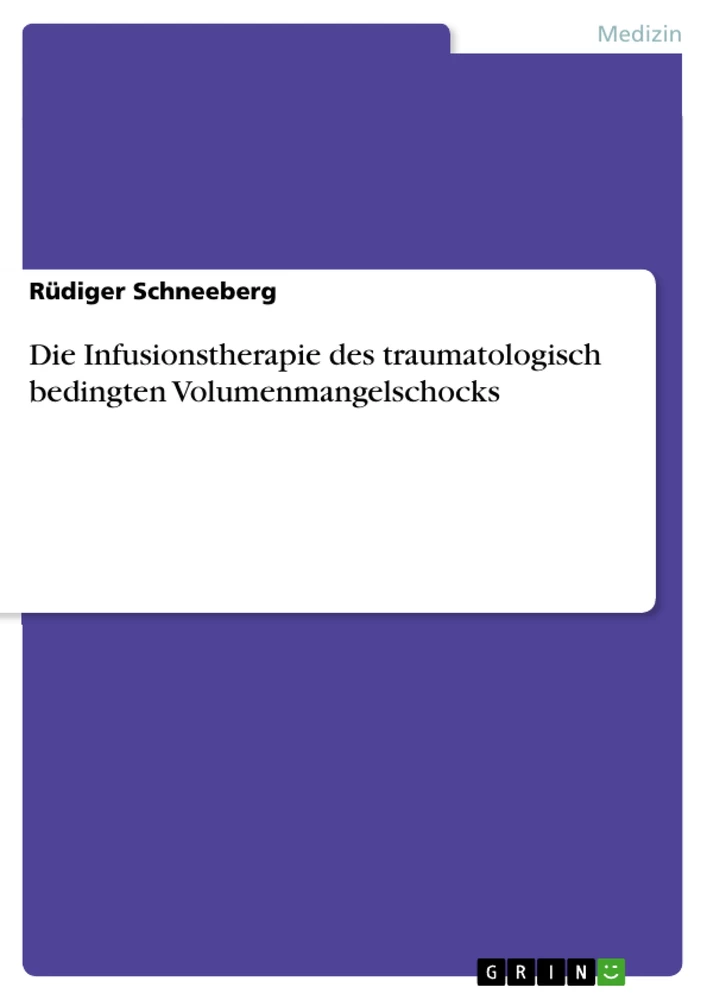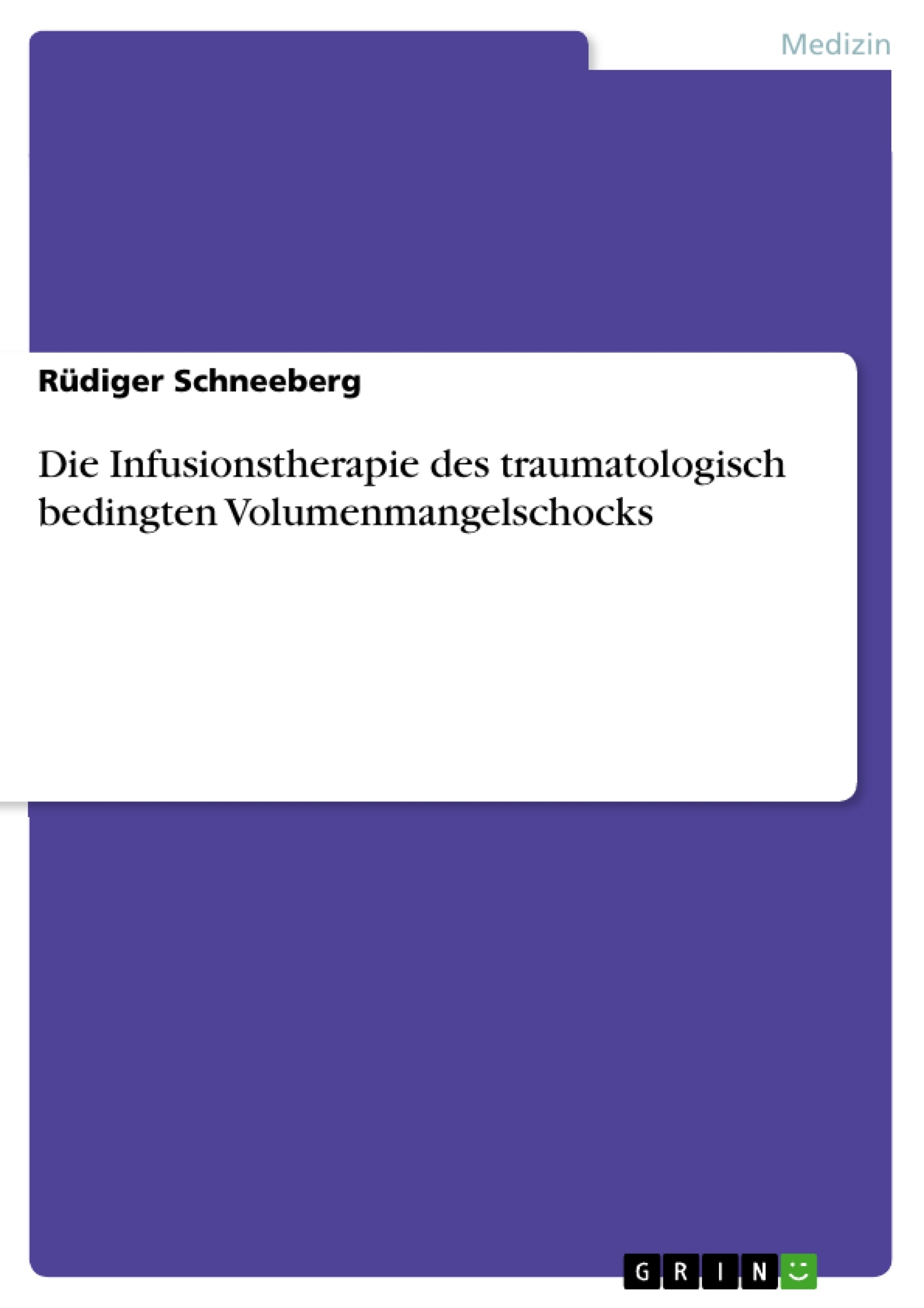Diese Arbeit befasst sich mit der zu Grunde liegenden Physiologie und Pathophysiologie des Schocks, der Frage nach dem geeigneten Volumenersatzmittel, den Strategien der Volumentherapie und zu guter letzt mit der Frage: Ist weniger wieder mehr? Der Einsatz von Small-Volume-Resuscitation Lösungen in der Präklinik.
Die traumatologisch bedingten Unfälle stellen in der Altersgruppe zwischen 20 und 44 Jahren die Haupttodesursache dar. Bis zum Jahr 2020 ist mit einem erheblichen Anstieg dieser Zahlen zu rechnen. Bis zu 60% der betroffenen Personen sterben noch vor Erreichen der Klinik, 30 % an einem hämorrhagischen Schock. Der Tod innerhalb von 24 Stunden nach diesem Ereignis ist häufig auf einen massiven Blutverlust zurückzuführen. Darüber hinaus ist die Kombination einer schweren Blutung mit begleitendem SHT die Konstellation mit der höchsten Sterblichkeit innerhalb der ersten 24 Stunden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Schock
- 2.1 Definition
- 2.2 Historie
- 2.3 Klassifikation der unterschiedlichen Schockformen
- 2.4 Hämorrhagischer Schock
- 2.5 Pathophysiologie des hämorrhagischen Schocks
- 3 Volumentherapie
- 3.1 Volumentherapie
- 3.2 Präparate der Volumensubstitution
- 3.2.1 Kristalloide Infusionen
- 3.2.1.1 Isotone Lösungen
- 3.2.1.2 Balancierte Lösungen
- 3.3 Kolloidale Infusionen
- 3.3.1 Dextrane
- 3.3.2 Albumine
- 3.3.3 Gelatine
- 3.3.4 Hydroxyethylstärke (HES)
- 3.4 Hyperosmolare/hyperonkotische Infusionen
- 3.5 Blutersatzmittel
- 3.5.1 Hämoglobinbasierende Ersatzstoffe (HBCO)
- 3.5.2 Synthetische Ersatzstoffe (PFCE)
- 3.6 Blutersatzstoffe aktuell
- 4 Volumentherapie in der Akutphase des hämorrhagischen Schocks
- 5 Aktuelle Empfehlungen der Fachgesellschaften zur Volumentherapie
- 5.1 PHTLS/ATLS
- 5.2 Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie
- 6 Fazit
- 7 Quellen
- 8 Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Infusionstherapie des traumatologisch bedingten Volumenmangelschocks. Ziel ist es, die physiologischen und pathophysiologischen Grundlagen des Schocks zu beleuchten, geeignete Volumenersatzmittel zu diskutieren und verschiedene Strategien der Volumentherapie zu analysieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage nach dem optimalen Vorgehen in der Präklinik, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz von Small-Volume-Resuscitation Lösungen.
- Physiologie und Pathophysiologie des Schocks
- Geeignete Volumenersatzmittel
- Strategien der Volumentherapie
- Small-Volume-Resuscitation in der Präklinik
- Aktuelle Empfehlungen der Fachgesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die hohe Sterblichkeitsrate bei traumatologisch bedingten Unfällen, insbesondere durch hämorrhagischen Schock, heraus. Sie betont die Notwendigkeit einer schnellen und effektiven Behandlung, um das Überleben und die Lebensqualität der Patienten zu sichern und die Folgekosten für das Gesundheitssystem zu minimieren. Die Arbeit fokussiert auf die Physiologie und Pathophysiologie des Schocks, die Wahl des Volumenersatzmittels, die Strategien der Volumentherapie und die Rolle von Small-Volume-Resuscitation in der Präklinik.
2 Schock: Dieses Kapitel definiert den Schock als Minderdurchblutung vitaler Organsysteme mit resultierender Gewebshypoxie. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Schockverständnisses, von den frühen Beschreibungen als Reaktion auf Verletzungen bis hin zum heutigen Verständnis der komplexen pathophysiologischen Prozesse. Die verschiedenen Schockformen (hypovolämisch, obstruktiv, kardiogen, distributiv) werden klassifiziert, wobei der Schwerpunkt auf dem hämorrhagischen Schock liegt.
3 Volumentherapie: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der Volumentherapie als essentieller Behandlungsmaßnahme bei Schock. Es beschreibt verschiedene Präparate der Volumensubstitution, darunter kristalloide (isotone und balancierte Lösungen) und kolloidale Infusionen (Dextrane, Albumine, Gelatine, HES), sowie hyperosmolare/hyperonkotische Infusionen und Blutersatzmittel (hämoglobinbasierend und synthetisch). Der aktuelle Stand der Blutersatzmittel wird ebenfalls diskutiert.
4 Volumentherapie in der Akutphase des hämorrhagischen Schocks: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifischen Aspekte der Volumentherapie im Kontext des akuten hämorrhagischen Schocks. Es wird detailliert auf die praktische Anwendung der im vorherigen Kapitel vorgestellten Methoden und Präparate eingegangen, unter Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse und Herausforderungen der Notfallmedizin.
5 Aktuelle Empfehlungen der Fachgesellschaften zur Volumentherapie: Dieses Kapitel präsentiert die aktuellen Leitlinien und Empfehlungen von Organisationen wie PHTLS/ATLS und der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie zur Volumentherapie bei Schock. Es analysiert die Übereinstimmungen und Unterschiede in den verschiedenen Ansätzen und bewertet deren Implikationen für die klinische Praxis.
Schlüsselwörter
Infusionstherapie, Volumenmangelschock, Hämorrhagischer Schock, Volumenersatzmittel, Kristalloide, Kolloidale Infusionen, Blutersatzmittel, Small-Volume-Resuscitation, Präklinik, PHTLS/ATLS, Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie, Pathophysiologie, Hypovolämie, Hypoxie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Infusionstherapie des traumatologisch bedingten Volumenmangelschocks"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die Infusionstherapie bei traumatologisch bedingtem Volumenmangelschock. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Physiologie und Pathophysiologie des Schocks, der Auswahl geeigneter Volumenersatzmittel, verschiedenen Strategien der Volumentherapie und der Rolle der Small-Volume-Resuscitation in der Präklinik. Aktuelle Empfehlungen von Fachgesellschaften wie PHTLS/ATLS und der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Hauptthemen: Definition und historische Entwicklung des Schocks, Klassifizierung verschiedener Schockformen (mit Schwerpunkt auf hämorrhagischem Schock), Pathophysiologie des hämorrhagischen Schocks, detaillierte Beschreibung verschiedener Volumenersatzmittel (Kristalloide, Kolloidale Infusionen, Blutersatzmittel), Strategien der Volumentherapie in der Akutphase des hämorrhagischen Schocks und aktuelle Empfehlungen von relevanten Fachgesellschaften zur Volumentherapie.
Welche Arten von Volumenersatzmitteln werden diskutiert?
Das Dokument diskutiert verschiedene Arten von Volumenersatzmitteln, darunter kristalloide Infusionen (isotone und balancierte Lösungen), kolloidale Infusionen (Dextrane, Albumine, Gelatine, HES), hyperosmolare/hyperonkotische Infusionen und Blutersatzmittel (hämoglobinbasierte und synthetische Ersatzstoffe). Der aktuelle Stand der Blutersatzmittel wird ebenfalls behandelt.
Welche Rolle spielt die Small-Volume-Resuscitation?
Ein Schwerpunkt des Dokuments liegt auf der Rolle der Small-Volume-Resuscitation in der präklinischen Versorgung von Patienten mit hämorrhagischem Schock. Die Effektivität und Anwendung dieser Methode wird im Kontext der aktuellen Erkenntnisse diskutiert.
Welche Empfehlungen von Fachgesellschaften werden berücksichtigt?
Die aktuellen Leitlinien und Empfehlungen von PHTLS/ATLS und der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie zur Volumentherapie bei Schock werden vorgestellt und analysiert. Die Übereinstimmungen und Unterschiede in den verschiedenen Ansätzen und deren Implikationen für die klinische Praxis werden beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Dokuments beschreiben, sind: Infusionstherapie, Volumenmangelschock, Hämorrhagischer Schock, Volumenersatzmittel, Kristalloide, Kolloidale Infusionen, Blutersatzmittel, Small-Volume-Resuscitation, Präklinik, PHTLS/ATLS, Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie, Pathophysiologie, Hypovolämie, Hypoxie.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Medizinstudenten, Ärzte, Pflegepersonal und alle anderen medizinischen Fachkräfte, die sich mit der Behandlung von traumatologisch bedingten Volumenmangelschocks befassen. Es ist besonders nützlich für Personen, die in der Notfallmedizin oder Unfallchirurgie tätig sind.
- Arbeit zitieren
- Rüdiger Schneeberg (Autor:in), 2012, Die Infusionstherapie des traumatologisch bedingten Volumenmangelschocks, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352958