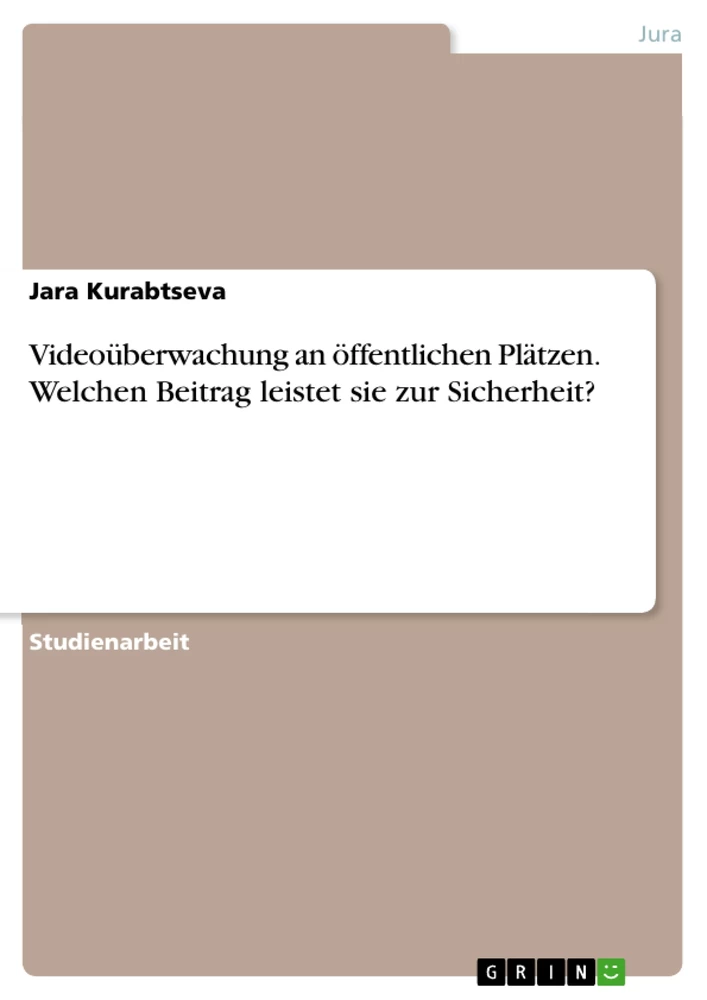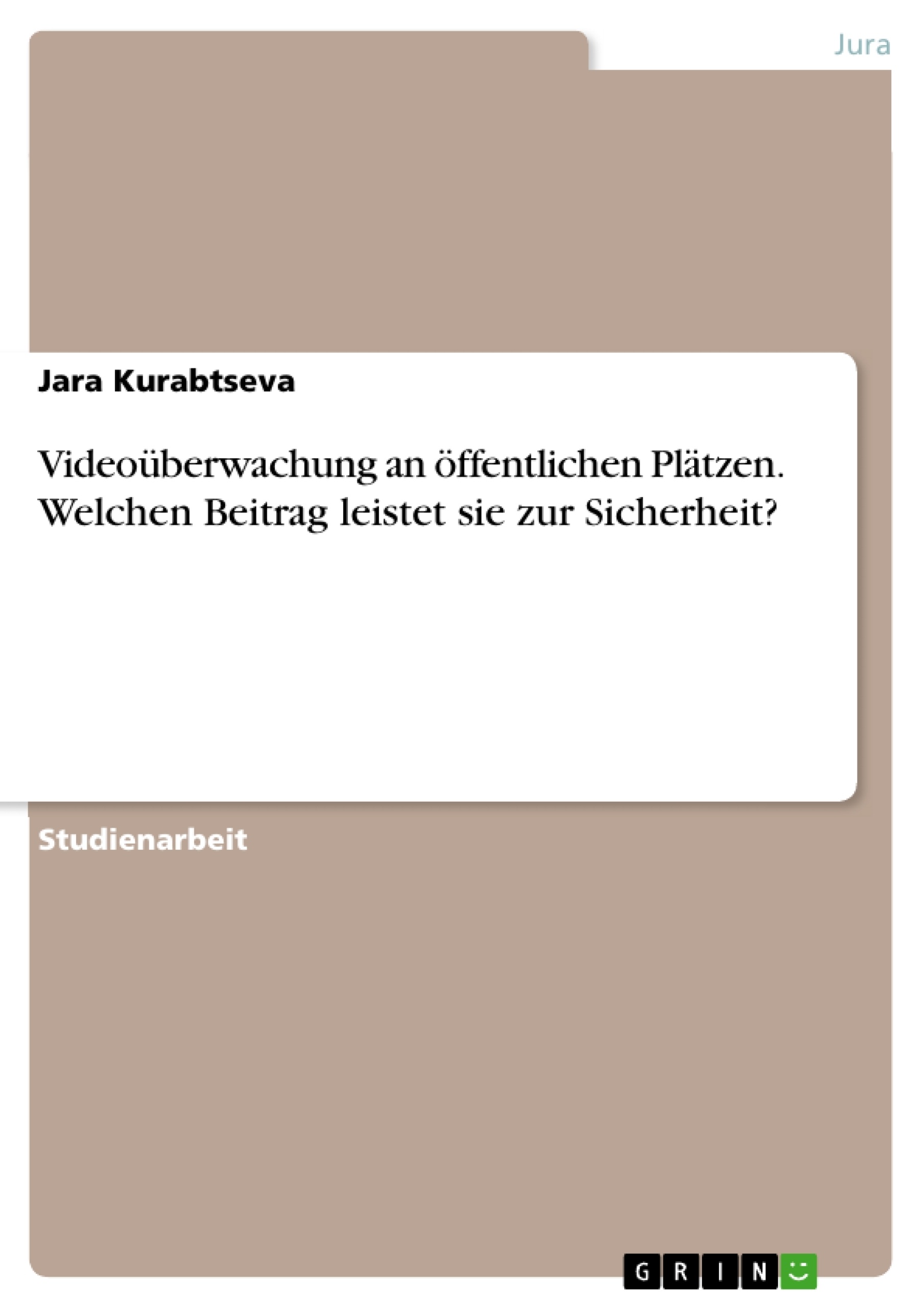Besonders in sozialen beziehungsweise von Kriminalität geprägten Brennpunkten oder unübersichtlichen und anonymen öffentlichen Plätzen sind Kameras zur Videoüberwachung keine Seltenheit mehr. Sie sollen zum einen der Prävention und zum anderen der Repression dienen. Die Kameras sollen potenzielle Täter abschrecken und mögliche Straftaten verhindern. Allein der Beobachtungsdruck soll dazu führen, dass zum Beispiel der Drogenhandel an bestimmten Plätzen nicht mehr stattfindet. Doch was passiert, wenn sich die möglichen Täter über die digitale Kontrolle bewusst sind? Mögliche Konsequenz wäre eine Verlagerung des Drogenhandels in umliegende nicht überwachte Bereiche. Doch ist eine Verlagerung der Kriminalität sinnvoll? Eine Überwachung bestimmter Plätze würde demnach einen weiteren Bedarf an Videokameras nach sich ziehen. Folglich wäre eine absolute öffentliche Überwachung unvermeidlich. Dient die Videoüberwachung nur der Strafverfolgung und Dokumentation eines Tathergangs oder ermöglicht sie ein schnelleres Eingreifen der Polizeibeamten vor Ort, um Straftaten zu verhindern?
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die Arbeit mit der öffentlichen Videoüberwachung durch den Staat und inwieweit diese das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger beeinflusst. Zunächst wird die historische Entwicklung der Videoüberwachung in Deutschland näher beleuchtet. Darauf folgt eine Erörterung der gesetzlichen Grundlagen mit besonderem Hinblick auf das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Weiterhin werden die unterschiedlichen Möglichkeiten der Kameraüberwachung dargestellt. Den Kern dieser Arbeit bilden die Ziele und Auswirkungen und die sich daraus ergebenden Vor- und Nachteile. Abschließend werden die Auswirkungen der digitalen Überwachung auf das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger dargestellt. Aufgrund der sehr geringen Datenlage zu einem zahlenmäßigen Kriminalitätsrückgang durch Videoüberwachung wird in dieser Arbeit nicht näher darauf eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historische Entwicklung
- 3. Gesetzliche Grundlagen
- 3.1 Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung Art. 2 I i.V.m. 1 I GG
- 3.2 Weitere gesetzliche Voraussetzungen
- 4. Zahlen zur Auswirkung auf die Kriminalitätsrate
- 5. Möglichkeiten der Videoüberwachung
- 5.1 Das Prinzip der Beobachtung
- 5.2 Die Aufzeichnung des Bildmaterials
- 6. Ziele und Auswirkungen
- 6.1 Prävention
- 6.2 Repression
- 7. Vor- und Nachteile
- 8. Auswirkung der Videoüberwachung auf das Sicherheitsgefühl
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die öffentliche Videoüberwachung in Deutschland, insbesondere deren Beitrag zur Sicherheit und den Einfluss auf das Sicherheitsgefühl der Bürger. Sie beleuchtet die historische Entwicklung, die gesetzlichen Grundlagen, die technischen Möglichkeiten und die Auswirkungen (Prävention und Repression) der Videoüberwachung.
- Historische Entwicklung der Videoüberwachung in Deutschland
- Gesetzliche Grundlagen und das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung
- Möglichkeiten und Grenzen der Videoüberwachungstechnik
- Auswirkungen auf Kriminalität und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung
- Abwägung von Vor- und Nachteilen der Videoüberwachung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der öffentlichen Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen ein und benennt die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Sie skizziert die Problematik der Kriminalitätsverlagerung und stellt die Frage nach dem tatsächlichen Beitrag der Videoüberwachung zur Sicherheit und zum Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Die Arbeit kündigt die Struktur an und verdeutlicht den Fokus auf die historische Entwicklung, die rechtlichen Grundlagen, die Möglichkeiten der Überwachung, die Ziele und Auswirkungen sowie die Vor- und Nachteile. Der Verzicht auf eine detaillierte quantitative Auswertung von Kriminalitätsstatistiken im Zusammenhang mit Videoüberwachung wird begründet.
2. Historische Entwicklung: Dieses Kapitel beschreibt die Anfänge der Videoüberwachung in Deutschland ab 1958, beginnend mit der Verkehrsüberwachung und der späteren gezielten Überwachung von Problemvierteln in Städten wie Hamburg und Hannover. Es zeichnet die Entwicklung hin zu einer Standardisierung der Videoüberwachung im privaten Bereich nach und beschreibt das wichtige Pilotprojekt in Leipzig 1996 als Wendepunkt hin zum Dauerbetrieb von Überwachungskameras in der öffentlichen Sphäre. Das Kapitel beleuchtet die schleichende Ausbreitung der Überwachungstechnik und deren zunehmende Verbreitung im öffentlichen Raum.
3. Gesetzliche Grundlagen: Das Kapitel behandelt die gesetzlichen Grundlagen der öffentlichen Videoüberwachung in Deutschland, mit besonderem Fokus auf das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG). Es erläutert, wie die Videoüberwachung als Eingriff in dieses Grundrecht verstanden werden kann und unter welchen Voraussetzungen ein solcher Eingriff rechtmäßig ist. Der Bezug auf das Landespolizeigesetz NRW (PolG NRW) verdeutlicht die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von optisch-technischen Mitteln der Polizei zur Kriminalitätsverhütung.
5. Möglichkeiten der Videoüberwachung: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen technischen Möglichkeiten der Videoüberwachung, differenziert zwischen Beobachtung und Aufzeichnung von Bildmaterial. Es beleuchtet die unterschiedlichen Arten von Überwachungssystemen und deren Einsatzmöglichkeiten im öffentlichen Raum. Die Ausführungen tragen zum Verständnis der technischen Rahmenbedingungen und ihrer Einsatzmöglichkeiten bei.
6. Ziele und Auswirkungen: Der Kern der Arbeit, dieses Kapitel unterscheidet zwischen den Zielen der Prävention (Abschreckung potenzieller Täter) und der Repression (Dokumentation von Straftaten und Unterstützung der Strafverfolgung). Es analysiert die Auswirkungen der Videoüberwachung auf diese beiden Bereiche und diskutiert die Komplexität der Zusammenhänge, inklusive der möglichen Verlagerung von Kriminalität in nicht überwachte Gebiete. Die Problematik einer umfassenden öffentlichen Überwachung wird angesprochen.
7. Vor- und Nachteile: In diesem Kapitel werden die Vor- und Nachteile der öffentlichen Videoüberwachung gegeneinander abgewogen. Es beleuchtet die positiven Aspekte, wie z.B. die verbesserte Gefahrenabwehr und die Unterstützung der Strafverfolgung, aber auch die negativen Konsequenzen, wie Eingriffe in die Privatsphäre und die potenzielle Abschreckung von Whistleblowern. Die Abwägung der verschiedenen Aspekte trägt zu einer differenzierten Betrachtung des Themas bei.
8. Auswirkung der Videoüberwachung auf das Sicherheitsgefühl: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der Videoüberwachung auf das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Es diskutiert die Frage, ob ein erhöhtes Sicherheitsgefühl durch die Präsenz von Kameras tatsächlich besteht und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Die Komplexität der subjektiven Wahrnehmung von Sicherheit im Kontext öffentlicher Videoüberwachung steht im Mittelpunkt.
Schlüsselwörter
Videoüberwachung, öffentliche Sicherheit, Kriminalitätsprävention, Kriminalitätsrepression, informationelle Selbstbestimmung, Datenschutz, Grundrechte, Polizeigesetz, Sicherheitsgefühl, technischer Fortschritt, Kriminalitätsverlagerung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur öffentlichen Videoüberwachung in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend die öffentliche Videoüberwachung in Deutschland. Sie beleuchtet die historische Entwicklung, die gesetzlichen Grundlagen, die technischen Möglichkeiten und die Auswirkungen (Prävention und Repression) der Videoüberwachung auf die Kriminalität und das Sicherheitsgefühl der Bürger.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die historische Entwicklung der Videoüberwachung in Deutschland, die relevanten gesetzlichen Grundlagen (insbesondere das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung), die technischen Möglichkeiten und Grenzen der Videoüberwachungstechnik, die Auswirkungen auf Kriminalität und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, sowie eine Abwägung der Vor- und Nachteile der Videoüberwachung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Historische Entwicklung, Gesetzliche Grundlagen, Zahlen zur Auswirkung auf die Kriminalitätsrate, Möglichkeiten der Videoüberwachung, Ziele und Auswirkungen, Vor- und Nachteile, Auswirkung der Videoüberwachung auf das Sicherheitsgefühl und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der öffentlichen Videoüberwachung.
Welche gesetzlichen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die gesetzlichen Grundlagen der öffentlichen Videoüberwachung in Deutschland, mit besonderem Fokus auf das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG). Es wird erläutert, wie Videoüberwachung als Eingriff in dieses Grundrecht verstanden werden kann und unter welchen Voraussetzungen ein solcher Eingriff rechtmäßig ist. Das Landespolizeigesetz NRW (PolG NRW) dient als Beispiel für die rechtlichen Rahmenbedingungen.
Welche technischen Möglichkeiten der Videoüberwachung werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene technische Möglichkeiten der Videoüberwachung, unterscheidet zwischen Beobachtung und Aufzeichnung von Bildmaterial und beleuchtet unterschiedliche Arten von Überwachungssystemen und deren Einsatzmöglichkeiten im öffentlichen Raum.
Wie werden die Ziele und Auswirkungen der Videoüberwachung bewertet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen den Zielen der Prävention (Abschreckung potenzieller Täter) und der Repression (Dokumentation von Straftaten und Unterstützung der Strafverfolgung). Sie analysiert die Auswirkungen auf diese Bereiche und diskutiert die Komplexität der Zusammenhänge, einschließlich der möglichen Kriminalitätsverlagerung. Die Problematik einer umfassenden öffentlichen Überwachung wird angesprochen.
Wie werden Vor- und Nachteile der Videoüberwachung abgewogen?
Die Arbeit wägt die Vor- und Nachteile der öffentlichen Videoüberwachung gegeneinander ab. Positive Aspekte wie verbesserte Gefahrenabwehr und Unterstützung der Strafverfolgung werden ebenso beleuchtet wie negative Konsequenzen wie Eingriffe in die Privatsphäre und die potenzielle Abschreckung von Whistleblowern.
Wie wirkt sich Videoüberwachung auf das Sicherheitsgefühl aus?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Videoüberwachung auf das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger. Sie diskutiert, ob ein erhöhtes Sicherheitsgefühl durch Kameras tatsächlich besteht und welche Faktoren eine Rolle spielen. Die Komplexität der subjektiven Wahrnehmung von Sicherheit im Kontext öffentlicher Videoüberwachung steht im Mittelpunkt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Videoüberwachung, öffentliche Sicherheit, Kriminalitätsprävention, Kriminalitätsrepression, informationelle Selbstbestimmung, Datenschutz, Grundrechte, Polizeigesetz, Sicherheitsgefühl, technischer Fortschritt, Kriminalitätsverlagerung.
- Quote paper
- Jara Kurabtseva (Author), 2015, Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen. Welchen Beitrag leistet sie zur Sicherheit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352910