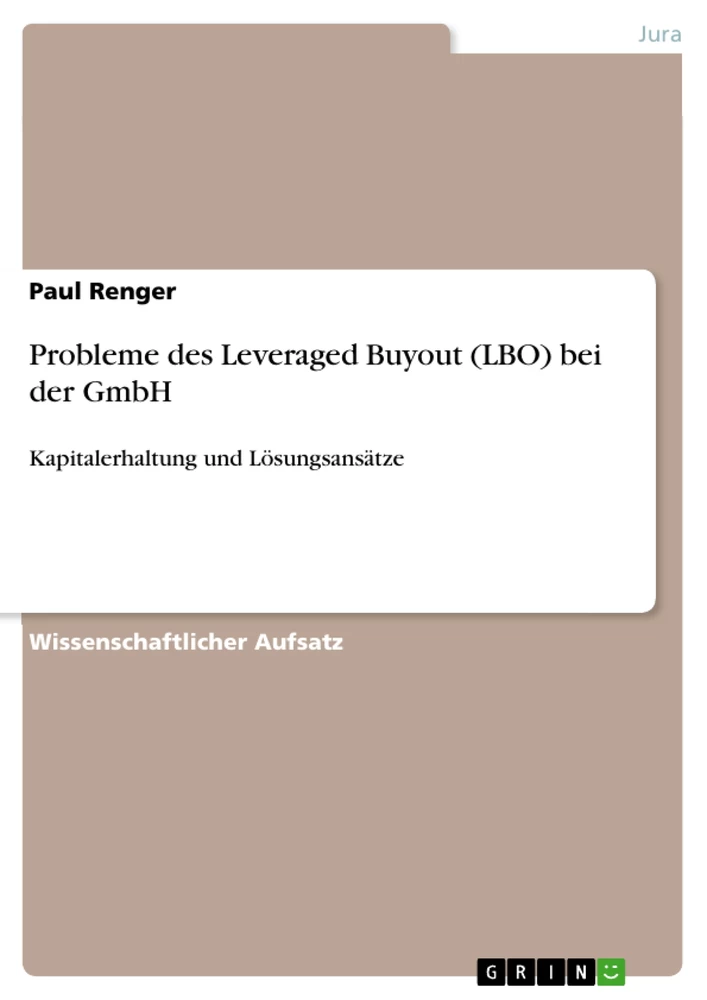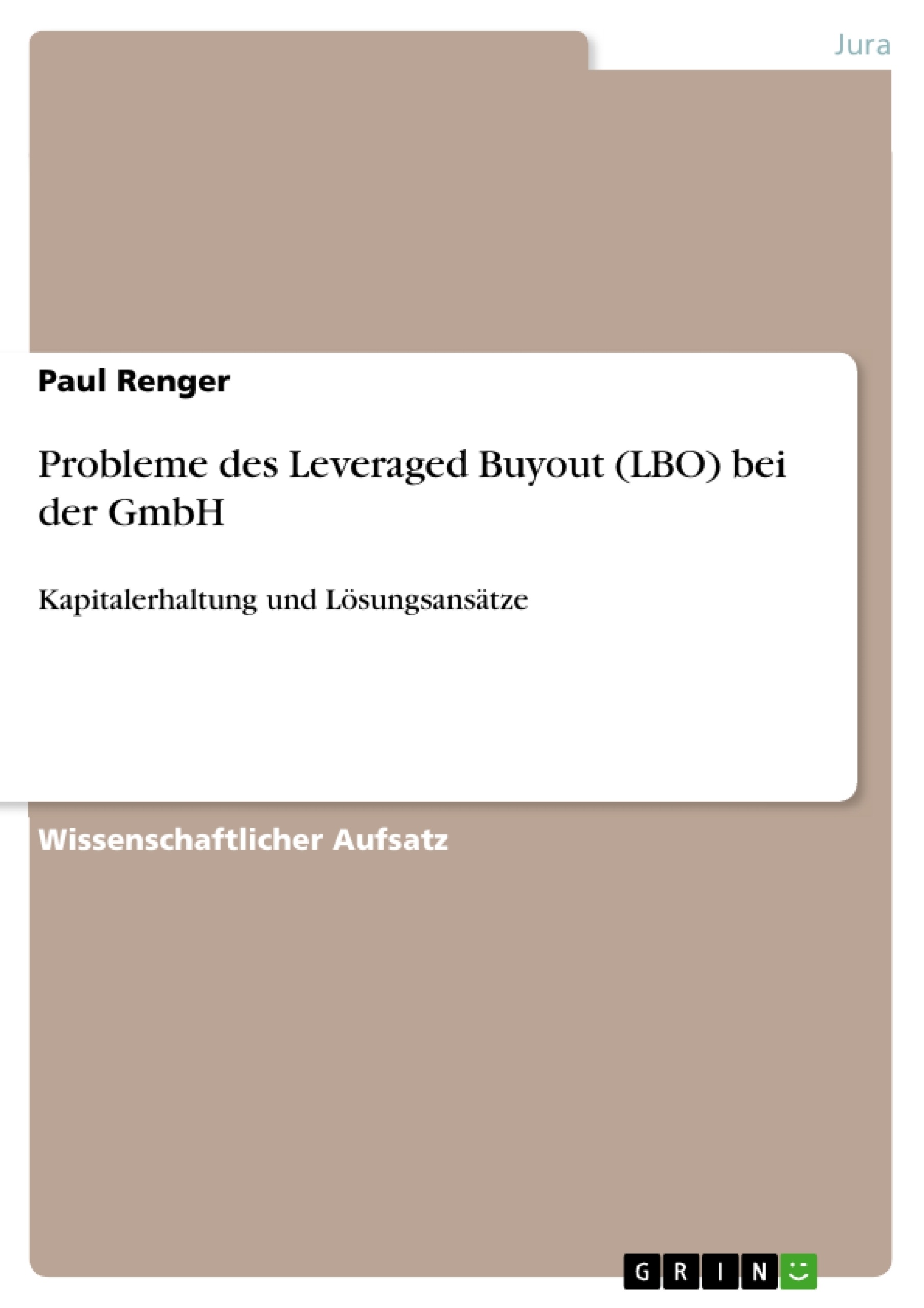Diese Prüfungsarbeit konkretisiert die wichtigsten Fragen des LBO bei der GmbH, besonderes zur Kapitalerhaltung, sowie mögliche Lösungsansätze auch mit Bezügen zum Europarecht.
Aufgrund günstiger Zinslandschaften, eines hohen Eigenkapitalzuflusses bei Finanzinvestoren und der Entwicklung neuer kapitalmarkfähiger Finanzprodukte sind Anzahl und Volumen der Leveraged Buy-out Transaktionen in den letzten Jahren stetig gestiegen. Ein Leveraged Buy-out ist in erster Linie dadurch gekennzeichnet, dass die Finanzierung eines Unternehmenserwerbs ganz überwiegend durch Fremdkapital erfolgt und Eigenkapital nur limitiert eingesetzt wird.
Trotz vereinzelter Darstellung der Problematik bei der Vorbereitung und Durchführung fremdfinanzierter Unternehmensübernahmen herrscht noch eine beträchtliche Rechtsunsicherheit. Insbesondere ist dies für den Leveraged Buy-out festzustellen, bei dem die Mittel zur Erwerbsfinanzierung von Kreditinstituten oder Investmentgesellschaften bereitgestellt und durch das Vermögen der zu erwerbenden Gesellschaft gesichert werden.
Der Leveraged Buy-out stammt ursprünglich wie viele Neuerungen im Bereich coperate finance aus den USA, hat aber über Großbritannien inzwischen auch in Kontinentaleuropa Fuß gefasst. Die hohe Verschuldung, die mit dieser Finanzierungsform einhergeht, stellt strenge Anforderungen an die Selektion geeigneter Buy-out-Kandidaten. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Leveraged Buy-out aufgrund der vielseitigen Verwendbarkeit in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird.
Die wirtschaftlichen und rechtlichen Probleme des Leveraged Buy-out stellen sich hierbei nicht als typische Problemkreise des Unternehmenskaufvertrags dar, sondern als Problemstellungen der Finanzierung durch den oder die Käufer und der Besicherung dieser Finanzierung. Aufgrund der hohen praktischen Relevanz dieser Finanzierungstechnik besteht daher Notwendigkeit, Zulässigkeit und Grenzen einer solchen Finanzierung eines Unternehmenserwerbs eingehend zu untersuchen und die bestehende Rechtsunsicherheit zu beseitigen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Der Leveraged Buy-out im Kontext von M&A Transaktionen
- 1. Begriff des Leveraged Buy-out
- 2. Der Leverage Effekt
- 3. Leverage Strukturen
- 3.1. Ablauf von LBO Transaktionen bei der GmbH
- 3.2. Struktureller Nachrang
- 3.3. Gestaltung der LBO Transaktion
- 4. Problemaufriss
- II. Grundsatz der Kapitalerhaltung im Rahmen einer LBO-Transaktion
- 1. Sicherheitenbestellung beim Leveraged Buy-out
- 2. Zeitpunkt der Sicherheitenbestellung
- 3. Sicherheitenbestellung versus Kapitalerhaltung
- 3.1. Tatbestand des § 30 I GmbHG
- 3.2. Rechtsfolge
- 4. Gestaltungsmöglichkeiten der Haftungslimitierung
- III. Existenzvernichtungshaftung
- 1. Der Existenzvernichtender Eingriff in der Rechtsprechung des BGH
- 2. Upstream - Securities und Existenzvernichtungshaftung
- 2.1. Tatbestand der Existenzvernichtungshaftung
- 2.2. Gestaltungsmöglichkeiten zur Haftungsminderung
- IV. Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Leveraged Buy-outs (LBOs) im Kontext von Mergers & Acquisitions (M&A) Transaktionen, insbesondere im Hinblick auf den Grundsatz der Kapitalerhaltung und die damit verbundene Existenzvernichtungshaftung. Die Arbeit analysiert die rechtlichen und strukturellen Aspekte von LBOs bei GmbHs und beleuchtet verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zur Haftungsminimierung.
- Der Leveraged Buy-out als Finanzierungsinstrument im Rahmen von M&A Transaktionen
- Der Grundsatz der Kapitalerhaltung nach § 30 GmbHG und seine Bedeutung für LBOs
- Die Sicherheitenbestellung im Kontext des Kapitalerhaltungsgrundsatzes
- Die Existenzvernichtungshaftung und Möglichkeiten ihrer Vermeidung
- Gestaltungsmöglichkeiten zur Limitierung der Haftung im Zusammenhang mit LBOs
Zusammenfassung der Kapitel
I. Der Leveraged Buy-out im Kontext von M&A Transaktionen: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in den Leveraged Buy-out (LBO) und seinen Platz innerhalb von M&A-Transaktionen. Es definiert den LBO, erläutert den Leverage-Effekt und verschiedene Leverage-Strukturen, wobei der Ablauf von LBO-Transaktionen bei GmbHs im Detail beschrieben wird. Der strukturelle Nachrang und die Gestaltungsmöglichkeiten der LBO-Transaktion werden ebenfalls behandelt, bevor das Kapitel mit einem Problemaufriss abschließt, der die zentralen Herausforderungen und Fragestellungen der Arbeit umreißt. Die Darstellung legt den Grundstein für die nachfolgende eingehende Analyse der Kapitalerhaltung und Haftungsfragen.
II. Grundsatz der Kapitalerhaltung im Rahmen einer LBO-Transaktion: Das Kapitel konzentriert sich auf den Grundsatz der Kapitalerhaltung im Kontext von LBOs. Es untersucht die Sicherheitenbestellung beim LBO, den relevanten Zeitpunkt der Bestellung und das Spannungsverhältnis zwischen Sicherheitenbestellung und Kapitalerhaltung, insbesondere im Hinblick auf § 30 I GmbHG. Der Fokus liegt auf der Analyse des Auszahlungsbegriffs bei der Bestellung von Upstream-Securities, unter Berücksichtigung verschiedener Auslegungsmöglichkeiten des § 30 I GmbHG (grammatikalisch, systematisch, historisch, teleologisch). Weiterhin werden die Konsequenzen für Upstream-Securities, die Unterbilanzrelevanz der Auszahlung und die Rolle der Gesellschafter als Auszahlungsempfänger diskutiert. Der Abschnitt über Gestaltungsmöglichkeiten zur Haftungslimitierung untersucht verschiedene Strategien, wie z.B. vertragliche Verwertungsbeschränkungen, Verschmelzung, Umwandlung in eine GmbH & Co. KG oder englische Limited, vertragliche Konzernierung und das Anwachsungsmodell, um die Risiken im Zusammenhang mit der Kapitalerhaltung zu minimieren.
III. Existenzvernichtungshaftung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Existenzvernichtungshaftung. Es analysiert den existenzvernichtenden Eingriff in der Rechtsprechung des BGH und dessen Relevanz für Upstream-Securities. Der Tatbestand der Existenzvernichtungshaftung wird detailliert untersucht, einschließlich des Begriffs des "planmäßigen Entzugs von Gesellschaftsvermögen", des Schädigungsvorsatzes und der Rechtsfolgen. Abschließend werden Gestaltungsmöglichkeiten zur Minderung der Haftung erläutert, um die Geschäftsführer der Zielgesellschaft vor den potenziellen Folgen zu schützen.
Schlüsselwörter
Leveraged Buy-out (LBO), Mergers & Acquisitions (M&A), Kapitalerhaltung, § 30 GmbHG, Sicherheitenbestellung, Upstream-Securities, Existenzvernichtungshaftung, Haftungsminimierung, GmbH, Gestaltungsmöglichkeiten.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Leveraged Buy-out (LBO) im Kontext von M&A Transaktionen
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Leveraged Buy-outs (LBOs) im Kontext von Mergers & Acquisitions (M&A) Transaktionen. Es konzentriert sich insbesondere auf den Grundsatz der Kapitalerhaltung nach § 30 GmbHG und die damit verbundene Existenzvernichtungshaftung bei GmbHs. Das Dokument analysiert rechtliche und strukturelle Aspekte von LBOs und beleuchtet verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zur Haftungsminimierung.
Was sind die zentralen Themen des Dokuments?
Die zentralen Themen sind der Leveraged Buy-out als Finanzierungsinstrument in M&A Transaktionen, der Grundsatz der Kapitalerhaltung nach § 30 GmbHG und seine Bedeutung für LBOs, die Sicherheitenbestellung im Kontext des Kapitalerhaltungsgrundsatzes, die Existenzvernichtungshaftung und Möglichkeiten ihrer Vermeidung sowie Gestaltungsmöglichkeiten zur Limitierung der Haftung im Zusammenhang mit LBOs.
Welche Aspekte von Leveraged Buy-outs werden behandelt?
Das Dokument behandelt den Begriff des LBO, den Leverage-Effekt, verschiedene Leverage-Strukturen, den Ablauf von LBO-Transaktionen bei GmbHs, den strukturellen Nachrang, die Gestaltungsmöglichkeiten der LBO-Transaktion, die Sicherheitenbestellung, den Zeitpunkt der Sicherheitenbestellung, das Verhältnis von Sicherheitenbestellung und Kapitalerhaltung, den Tatbestand des § 30 I GmbHG, die Rechtsfolgen, Gestaltungsmöglichkeiten der Haftungslimitierung, den existenzvernichtenden Eingriff in der Rechtsprechung des BGH, Upstream-Securities und Existenzvernichtungshaftung, den Tatbestand der Existenzvernichtungshaftung und Gestaltungsmöglichkeiten zur Haftungsminderung.
Wie wird der Grundsatz der Kapitalerhaltung behandelt?
Der Grundsatz der Kapitalerhaltung wird im Kontext von LBOs ausführlich analysiert. Das Dokument untersucht das Spannungsverhältnis zwischen Sicherheitenbestellung und Kapitalerhaltung im Hinblick auf § 30 I GmbHG, einschließlich der Auslegung des Auszahlungsbegriffs bei Upstream-Securities und der Diskussion verschiedener Auslegungsmöglichkeiten des § 30 I GmbHG (grammatikalisch, systematisch, historisch, teleologisch). Es werden auch Konsequenzen für Upstream-Securities, die Unterbilanzrelevanz der Auszahlung und die Rolle der Gesellschafter als Auszahlungsempfänger diskutiert.
Welche Gestaltungsmöglichkeiten zur Haftungsminimierung werden vorgestellt?
Das Dokument präsentiert verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zur Haftungsminimierung im Zusammenhang mit LBOs, einschließlich vertragliche Verwertungsbeschränkungen, Verschmelzung, Umwandlung in eine GmbH & Co. KG oder englische Limited, vertragliche Konzernierung und das Anwachsungsmodell. Es werden auch Strategien zur Minderung der Existenzvernichtungshaftung erläutert, um Geschäftsführer der Zielgesellschaft zu schützen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für dieses Dokument?
Die relevanten Schlüsselwörter sind Leveraged Buy-out (LBO), Mergers & Acquisitions (M&A), Kapitalerhaltung, § 30 GmbHG, Sicherheitenbestellung, Upstream-Securities, Existenzvernichtungshaftung, Haftungsminimierung, GmbH, Gestaltungsmöglichkeiten.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für alle, die sich mit Leveraged Buy-outs, Mergers & Acquisitions, Gesellschaftsrecht und der Kapitalerhaltung im Kontext von GmbHs auseinandersetzen, insbesondere Juristen, Wirtschaftsprüfer, Finanzberater und Unternehmenslenker.
- Quote paper
- Paul Renger (Author), 2016, Probleme des Leveraged Buyout (LBO) bei der GmbH, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352738