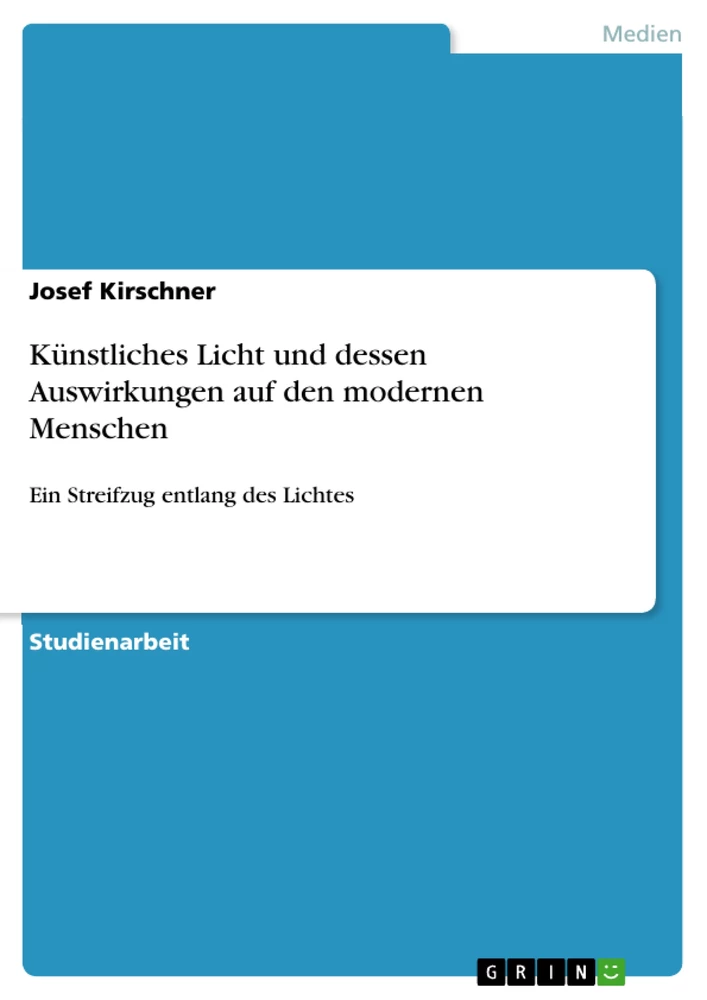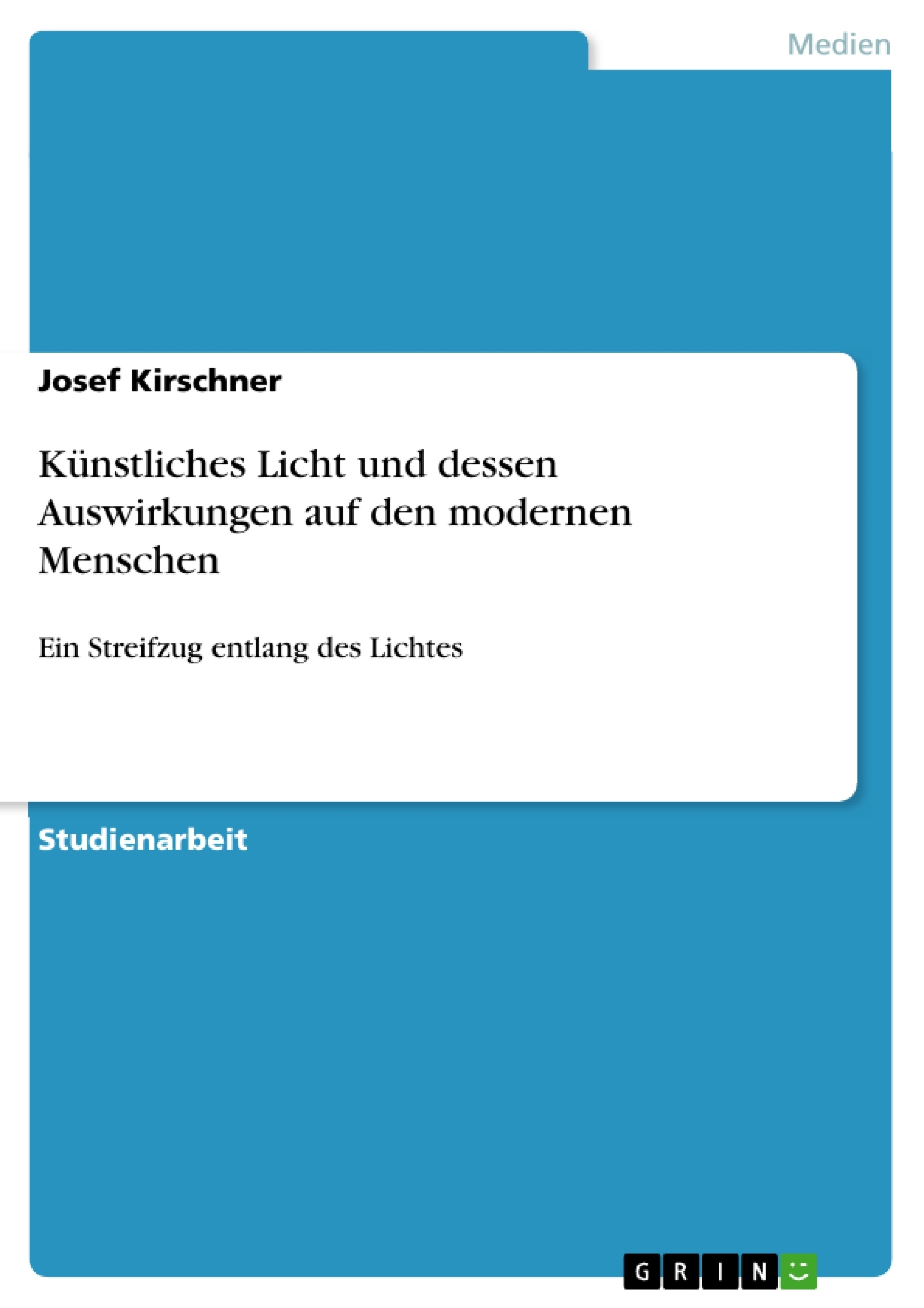Ein Licht aufgehen, Licht werden lassen, Licht ins Dunkel bringen, erleuchtet sein – all diese Redewendungen des deutschen Sprachgebrauchs werden positiv assoziiert. Diese begriffliche Verknüpfung von Licht und ‚dem Guten’ lässt sich bis zum antiken griechischen Philosophen Platon zurückführen, welcher in seinem Sonnengleichnis die Sonne mit der Idee des Guten, das Licht mit der Wahrheit gleichsetzt. Zugleich beschreibt er das eigentliche Gute des Lichts mit dem damit einhergehenden Vermögen des Erkennens. In philosophischer Hinsicht ist Licht nicht nur ein darstellendes Medium, sondern selbst schaffend, indem es „die Bilder generiert“, die als die Wirklichkeit der Welt wahrgenommen werden. Es bebildert, ja bildet unsere visuelle Wirklichkeit, unsere Vorstellung von der Wahrheit. Im Wechselspiel mit Schatten schafft es den Raum, in dem wir uns bewegen und ermöglicht uns dadurch erst unsere Umgebung optisch zu erfahren.
Abgesehen von diesen Aspekten haftet dem Licht seit hunderten von Jahren ebenso eine gesellschaftliche Funktion an: Die Wahrung von Moral und Ordnung – folglich ein Garant für Sicherheit. Licht wurde damit zum Kriterium für Sicherheit durch Kontrolle. Diese Funktion des Lichtes und seinen Erscheinungen eskaliert bis heute zu einer Form der Überwachung und Überflutung durch virtuelle, mediale Welten, wodurch als Möglichkeit der Relaxation ein Bedürfnis nach künstlerischen Reinräumen resultiert.
Das Individuum ist zur „organischen Prothese des Anorganischen geworden“, sodass der Körper im Kontext des digitalen Medienzeitalters nur als Interface zwischen Gehirn und Maschine fungiert, sonst jedoch seine Funktion verliert. Denn ‚die Bretter die die Welt bedeuten‘ sind nicht länger hölzern. In der ‚modernen Gesellschaft‘ sind Sie nur mehr diffuse Gedankenkonstrukte im digitalen Äther.
Inhaltsverzeichnis
- Der Mensch und seine Abhängigkeit vom Licht
- Licht als Garant der Sicherheit durch Kontrolle
- Kunstlicht als Äquivalent zum Tageslicht?
- Lichtflut und deren Folgen
- Leerraum als Erfahrung des Gegenwärtigen
- Emotionales Abbild
- Licht als universelles Kontroll-Medium
- Licht-Barrieren der Jetztzeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Werk befasst sich mit der Bedeutung von künstlichem Licht für den modernen Menschen. Es untersucht die Geschichte der Beleuchtungstechnik und die Auswirkungen des künstlichen Lichts auf unsere Wahrnehmung, unser Verhalten und unsere Gesellschaft.
- Die Abhängigkeit des Menschen vom Licht
- Licht als Mittel der Kontrolle und Sicherheit
- Die Entwicklung der Beleuchtungstechnik
- Die Folgen der Lichtflut für den Menschen
- Die Rolle des Lichts in der Wahrnehmung der Wirklichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Der Mensch und seine Abhängigkeit vom Licht: Dieses Kapitel beleuchtet die enge Beziehung zwischen Mensch und Licht, die sich in Sprache, Philosophie und Biologie manifestiert. Es wird die Bedeutung des Lichts für die Photosynthese und die Entstehung von Leben auf der Erde hervorgehoben.
- Kapitel 2: Licht als Garant der Sicherheit durch Kontrolle: Dieses Kapitel befasst sich mit der historischen Entwicklung der öffentlichen Beleuchtung und deren Rolle als Mittel der Kontrolle und Sicherheit. Es wird die Bedeutung des Lichts für die Wahrung von Ordnung und Moral in Städten des Mittelalters und der frühen Neuzeit beleuchtet.
- Kapitel 3: Kunstlicht als Äquivalent zum Tageslicht?: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der künstlichen Beleuchtungstechnik und den Wunsch, ein Äquivalent zum natürlichen Tageslicht zu schaffen. Es wird die Geschichte der Öllampen, Gasbeleuchtung und Elektrifizierung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Licht, Beleuchtung, Kunstlicht, Tageslicht, Kontrolle, Sicherheit, Wahrnehmung, Realität, Geschichte, Technik, Gesellschaft, Moderne, Überwachung, Kontrolle, Lichtflut, Folgen, Leerraum, Emotion, Barrieren.
- Quote paper
- Josef Kirschner (Author), 2015, Künstliches Licht und dessen Auswirkungen auf den modernen Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352477