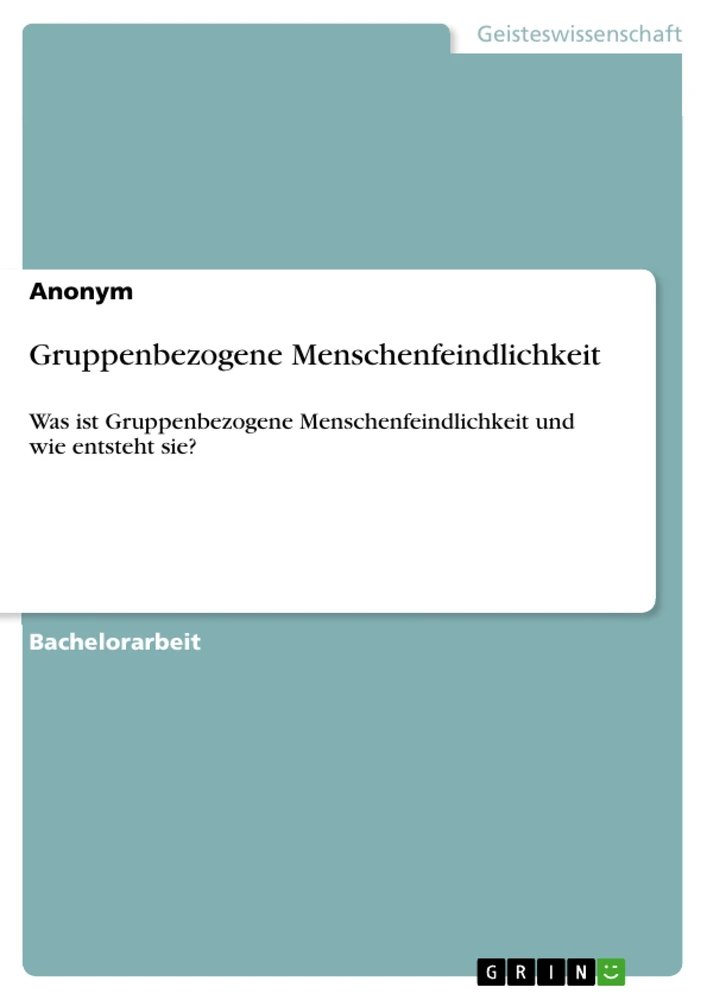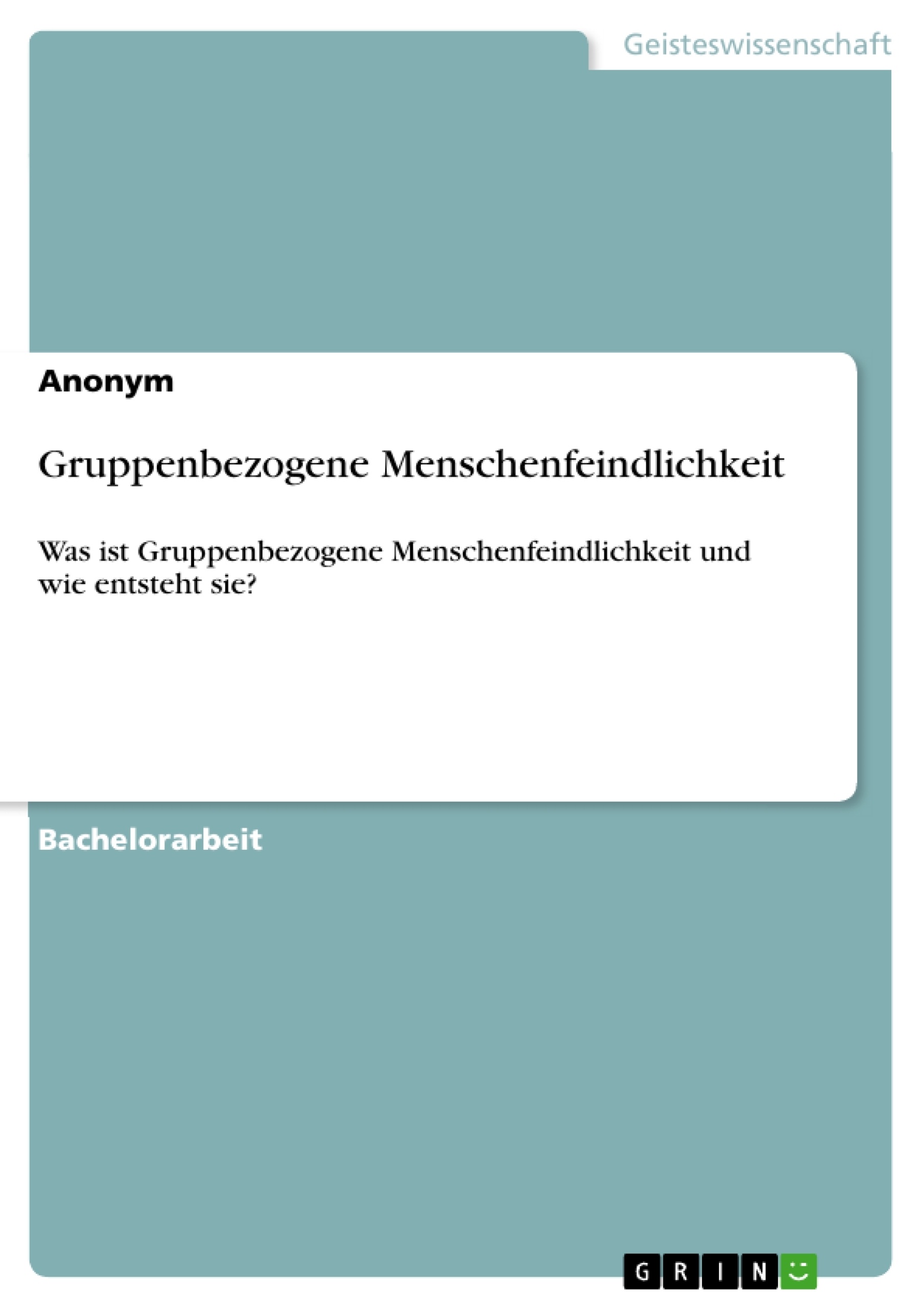„Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ (GG Artikel 3 Absatz 3), ein Artikel aus dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, der die sachgrundlose Diskriminierung von Menschen verbietet und die Gleichberechtigung aller im staatlichen Rahmen festschreibt. Ginge damit eine entsprechende Wertschätzung im gesellschaftlichen Miteinander einher, sollte ein friedliches Zusammenleben mit Menschen verschiedener Ethnien, mit verschiedenen Lebensstilen und Anschauungen möglich sein. Trotzdem werden Menschen diskriminiert und abgewertet, weil sie „anders“ scheinen. Zumeist beziehen sich diese abwertenden Einstellungen nicht auf eine Person, sondern auf eine Gruppe von Menschen. Diese Menschen werden z. B. aufgrund ihrer biologischen Verschiedenheit diskriminiert (Rassismus) oder, weil sie eine sexuelle Neigung zu gleichgeschlechtlichen Partnerinnen oder Partnern haben, ausgegrenzt (Homophobie) oder erleben geschlechterfeindliche Einstellungen (Sexismus). Die Vorurteile haben verschiedene Namen und sind an verschiedene Adressatengruppen gerichtet, denn sie beziehen sich nicht auf die Einstellung oder den Charakter eines Menschen, sondern diese unterliegen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit Diskriminierungen und Vorurteilen und werden als minderwertig angesehen. Zu fragen ist aber, wie diese Vorurteile und die abwertende Haltung der Menschen entstehen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändern.
Eine Sonderauswertung der GMF, durch die verschiedene Altersgruppen zu ihren Einstellungen gegenüber anderen Gruppen befragt wurden, zeigte, dass auch jüngere Menschen abwertende Einstellungen besitzen. Leider wurden keine weiteren Erhebungen mit Minderjährigen gemacht, obwohl mutmaßlich viele Jugendliche rechtsradikale oder -extremistische Einstellungen aufweisen, anfälliger für Gewalttaten sind und Minderheiten diskriminieren; darüber wird jedenfalls öfter in den Medien berichtet und ist im schulischen Umfeld zu sehen. Daher sollte der Frage nachgegangen werden, ob, warum und in welchem Maß Heranwachsende ohne Migrationshintergrund menschenfeindlich eingestellt sind und auch, wie diesen Einstellungen vorgebeugt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist GMF?
- Das GMF-Syndrom
- Elemente des Syndroms GMF
- Rassismus
- Fremdenfeindlichkeit
- Antisemitismus
- Etabliertenvorrechte
- Sexismus
- Islamfeindlichkeit
- Homophobie
- Abwertung von Obdachlosen
- Abwertung von Behinderten
- Abwertung von Langzeitarbeitslosen
- Abwertung von Asylbewerbern
- Abwertung von Sinti und Roma
- Zusammenhang
- GMF in sozialen Gruppen
- Entwicklung GMF seit 2002
- Jugend und GMF
- Desintegrationsängste
- GMF-Prävalenzen bei Jüngeren
- Häufigkeit
- Vergleich mit Älteren
- Zusammenhänge von Desintegrationsrisiken und GMF
- Wie Schule mit GMF umgeht
- Prävention und Intervention
- Konzept zum Umgang mit ethnischen Vorurteilen in der Schule
- Konzept der Interkulturellen Pädagogik
- Konzept der Antirassistischen Pädagogik
- Verknüpfung Interkultureller und Antirassistischer Pädagogik
- Methoden in der Sekundarstufe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF). Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung von GMF zu untersuchen, insbesondere im Hinblick auf die Prävalenz bei jungen Menschen. Die Arbeit analysiert, wie Schule mit GMF umgeht und welche Konzepte und Methoden zur Prävention und Intervention eingesetzt werden können.
- Definition und Entstehung von GMF
- Prävalenz von GMF bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
- Zusammenhang zwischen Desintegrationsängsten und GMF
- Umgang mit GMF in schulischen Kontexten
- Konzepte der Interkulturellen und Antirassistischen Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF) vor und beleuchtet die Relevanz der Thematik im Kontext des Grundgesetzes und der Gleichberechtigung.
- Was ist GMF?: Dieses Kapitel definiert GMF als Syndrom, das verschiedene Formen von Abwertung und Diskriminierung umfasst, wie z.B. Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Sexismus. Es werden die verschiedenen Elemente des GMF-Syndroms detailliert beschrieben.
- Jugend und GMF: Dieses Kapitel analysiert die Prävalenz von GMF bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es untersucht den Zusammenhang zwischen Desintegrationsängsten und GMF und beleuchtet die Bedeutung dieser Problematik im Kontext der Jugend.
- Wie Schule mit GMF umgeht: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Umgang von Schulen mit GMF. Es werden verschiedene Konzepte und Methoden zur Prävention und Intervention vorgestellt, wie z.B. Interkulturelle Pädagogik und Antirassistische Pädagogik.
Schlüsselwörter
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, GMF, Syndrom, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie, Desintegrationsängste, Jugend, Schule, Prävention, Intervention, Interkulturelle Pädagogik, Antirassistische Pädagogik.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2016, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352463