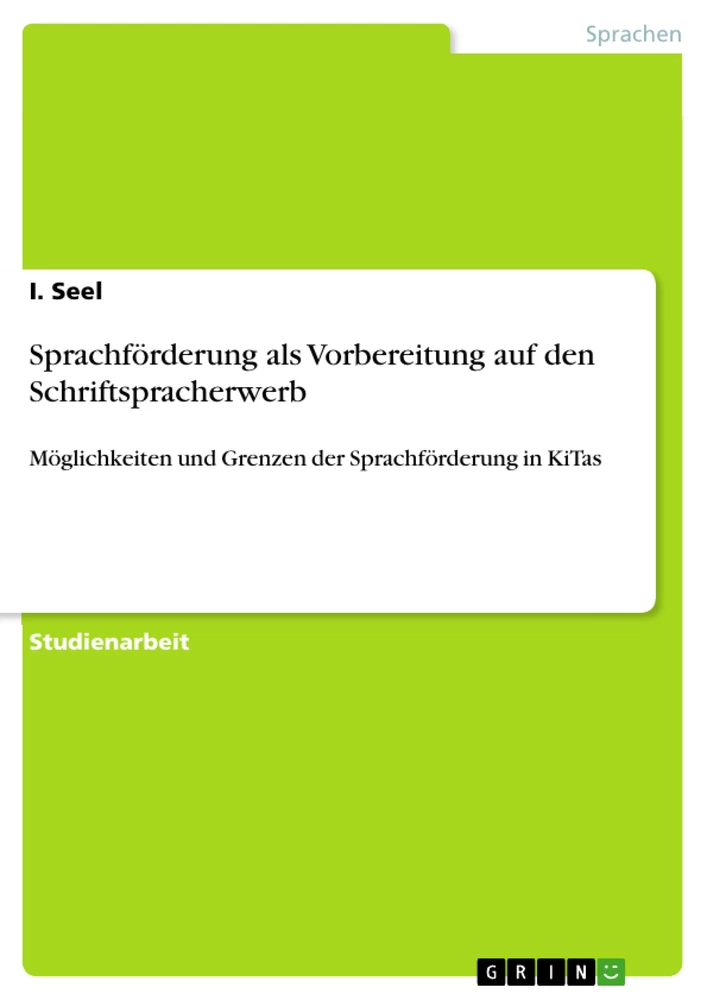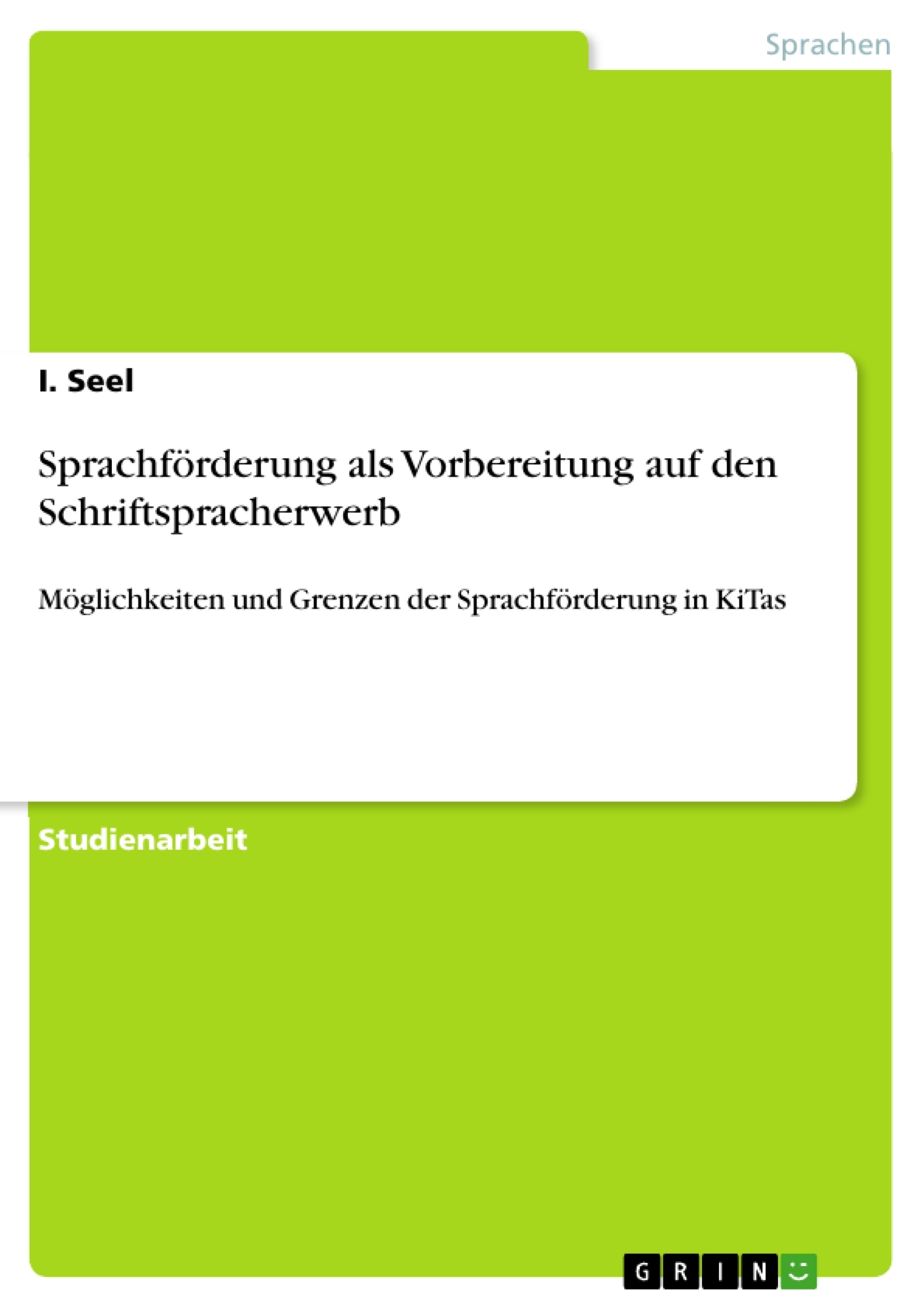Die Sprachentwicklung ist eng verbunden mit der kognitiven, motorischen, emotionalen, sensorischen und sozialen Entwicklung der Kinder. Die Sprache wird nicht regelgeleitet über Grammatik und Wortschatz erlernt, sondern mit allen Sinnen und in erster Linie als Kommunikationsmittel mit der unmittelbaren Umwelt. Für die Erklärung von Mechanismen kindlichen Spracherwerbs gibt es je nach wissenschaftlicher Position verschiedene Spracherwerbstheorien. Sie bieten teils sich widersprechende, teils sich ergänzende Erklärungsmodelle. In ihnen wird der Spracherwerbsprozess beschrieben als Nachahmung und Konditionierung (Behaviorismus), Angeborener Mechanismus (Nativismus), kognitive Gesamtentwicklung (Kognitivismus) und Umgebungseinfluss und Interaktion zwischen Bezugspersonen und Kindern (Interaktionismus).
Zum Spracherwerb nutzen die Kinder unterschiedliche Spracherwerbsstile. „Nominaler Stil“ zeichnet sich über flexiblen Wortschatzgebrauch mit überwiegendem Nomengebrauch aus. „Expressiver Stil“ ist wenig verständlich, da die Wortschatzerweiterung langsamer verläuft und überwiegend Allzweck- und Funktionswörter benutzt werden. Beide Stile führen zum Spracherwerb. Als Voraussetzung für den Schriftspracherwerb müssen Kinder im Vorschulalter grundlegende Fähigkeiten aus folgenden Bereichen erwerben: Auditive Wahrnehmung, Visuelle Analyse, Symbolverständnis und Grob- und feinmotorische Fähigkeiten. Die Wahrnehmungsleistungen sind in der Regel von der motorischen Koordination abhängig. Bei einer gestörten Wahrnehmungsleistung kommen Anpassungs-leistungen zwischen Reiz und Reaktion nicht in der erwarteten Weise zustande.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lese-Rechtschreibschwäche
- Voraussetzungen für den Sprach- und Schriftentwicklung
- Erfassung der Sprachkompetenz
- Sprachdiagnostische Hilfsmittel
- Das Bielefelder Screening (BISC)
- Münsteraner Screening (MUSC)
- Rundgang durch Hörhausen
- Sprachförderung als Vorbereitung auf den Schriftspracherwerb
- Begriffsdefinitionen der Sprachförderung
- Förderprogrammen für Kinder mit Risiko zur Ausbildung einer Lese-Rechtschreibschwäche
- Sprachliche Förderung durch Angebote aus verschiedenen Bildungsbereichen
- Möglichkeiten und Grenzen der Sprachförderung in KiTas
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Möglichkeiten der erfolgreichen Sprachförderung von Kindern mit Risiko zur Ausbildung einer Lese-Rechtschreibschwäche. Sie analysiert die Ursachen und Symptome der Lese-Rechtschreibschwäche und untersucht die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit und der Wortschatzentwicklung für den Sprach- und Schriftentwicklung. Die Arbeit beleuchtet verschiedene sprachdiagnostische Hilfsmittel, darunter Screenings und Früherkennungsprogramme. Im Hauptteil werden Sprachförderprogramme und -angebote aus verschiedenen Bildungsbereichen vorgestellt, mit besonderem Fokus auf die Förderung der phonologischen Bewusstheit und der Schriftsprachvoraussetzungen. Die Arbeit schließt mit einer Betrachtung der Möglichkeiten und Grenzen der Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen.
- Ursachen und Symptome der Lese-Rechtschreibschwäche
- Bedeutung der phonologischen Bewusstheit und der Wortschatzentwicklung für den Sprach- und Schriftentwicklung
- Sprachdiagnostische Hilfsmittel und Früherkennungsprogramme
- Sprachförderprogramme und -angebote aus verschiedenen Bildungsbereichen
- Möglichkeiten und Grenzen der Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung betont die Bedeutung von Sprache und Schrift als Schlüsselkompetenzen für Bildung und die Herausforderungen, die Kinder mit Sprachproblemen beim Erlernen von Lesen und Schreiben haben. Die Arbeit stellt die Zielsetzung dar, Möglichkeiten für die erfolgreiche Förderung von Kindern mit Risiko zur Ausbildung einer Lese-Rechtschreibschwäche zu erforschen.
2. Lese-Rechtschreibschwäche
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) und beschreibt ihre charakteristischen Merkmale. Es erläutert die vielfältigen Ursachen der LRS, wobei der Schwerpunkt auf der phonologischen Bewusstheit und der Wortschatzentwicklung liegt. Risikofaktoren, die zu LRS führen können, werden ebenfalls behandelt.
3. Voraussetzungen für den Sprach- und Schriftentwicklung
Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der frühen Erfahrungen eines Kindes mit Sprache für die Entwicklung seiner sprachlichen Fähigkeiten. Es werden wichtige Voraussetzungen für den Sprach- und Schriftentwicklung, wie phonologische Bewusstheit, grammatische Fähigkeiten, Hörvermögen und Gedächtnisleistungen, dargestellt. Verschiedene Spracherwerbstheorien und Sprach-erwerbsstile werden vorgestellt.
4. Erfassung der Sprachkompetenz
Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Sprachdiagnose in der Bildungsarbeit. Es werden verschiedene sprachdiagnostische Hilfsmittel, wie Screenings, Beobachtungsverfahren und Portfolioverfahren, vorgestellt, die zur Identifizierung von Kindern mit dem Risiko zur Sprach- und/oder Schriftsprachentwicklungsstörung eingesetzt werden können.
5. Sprachförderung als Vorbereitung auf den Schriftspracherwerb
Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Sprachförderung für die Vorbereitung auf den Schriftspracherwerb. Es definiert den Begriff der Sprachförderung und stellt verschiedene Förderprogramme vor, die sich auf die Förderung der phonologischen Bewusstheit und der Schriftsprachvoraussetzungen konzentrieren. Darüber hinaus werden Beispiele für sprachliche Förderung durch Angebote aus verschiedenen Bildungsbereichen vorgestellt. Das Kapitel endet mit einer Analyse der Möglichkeiten und Grenzen der Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen.
Schlüsselwörter
Lese-Rechtschreibschwäche (LRS), phonologische Bewusstheit, Wortschatzentwicklung, Sprachdiagnostik, Screening, Sprachförderung, Schriftspracherwerb, Kindertageseinrichtungen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Spracherwerbstheorien laut dieser Arbeit?
In der Arbeit werden der Behaviorismus (Nachahmung), Nativismus (angeborener Mechanismus), Kognitivismus (kognitive Gesamtentwicklung) und Interaktionismus (Umgebungseinfluss) als Erklärungsmodelle beschrieben.
Was versteht man unter dem "nominalen Stil" beim Spracherwerb?
Der nominale Stil zeichnet sich durch einen flexiblen Wortschatzgebrauch aus, bei dem überwiegend Nomen verwendet werden.
Welche Voraussetzungen müssen Kinder für den Schriftspracherwerb erfüllen?
Grundlegende Fähigkeiten in den Bereichen auditive Wahrnehmung, visuelle Analyse, Symbolverständnis sowie grob- und feinmotorische Fähigkeiten sind essenziell.
Welche Rolle spielt die phonologische Bewusstheit?
Die phonologische Bewusstheit gilt als eine der wichtigsten Voraussetzungen für die erfolgreiche Sprach- und Schriftentwicklung und ist ein Schwerpunkt bei der Vermeidung von Lese-Rechtschreibschwäche.
Welche diagnostischen Hilfsmittel werden in der Arbeit vorgestellt?
Es werden verschiedene Screenings wie das Bielefelder Screening (BISC), das Münsteraner Screening (MUSC) und das Programm "Rundgang durch Hörhausen" behandelt.
Was ist das Ziel der Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen?
Das Ziel ist die Vorbereitung auf den Schriftspracherwerb, insbesondere für Kinder mit einem Risiko zur Ausbildung einer Lese-Rechtschreibschwäche (LRS).
- Arbeit zitieren
- I. Seel (Autor:in), 2015, Sprachförderung als Vorbereitung auf den Schriftspracherwerb, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352260