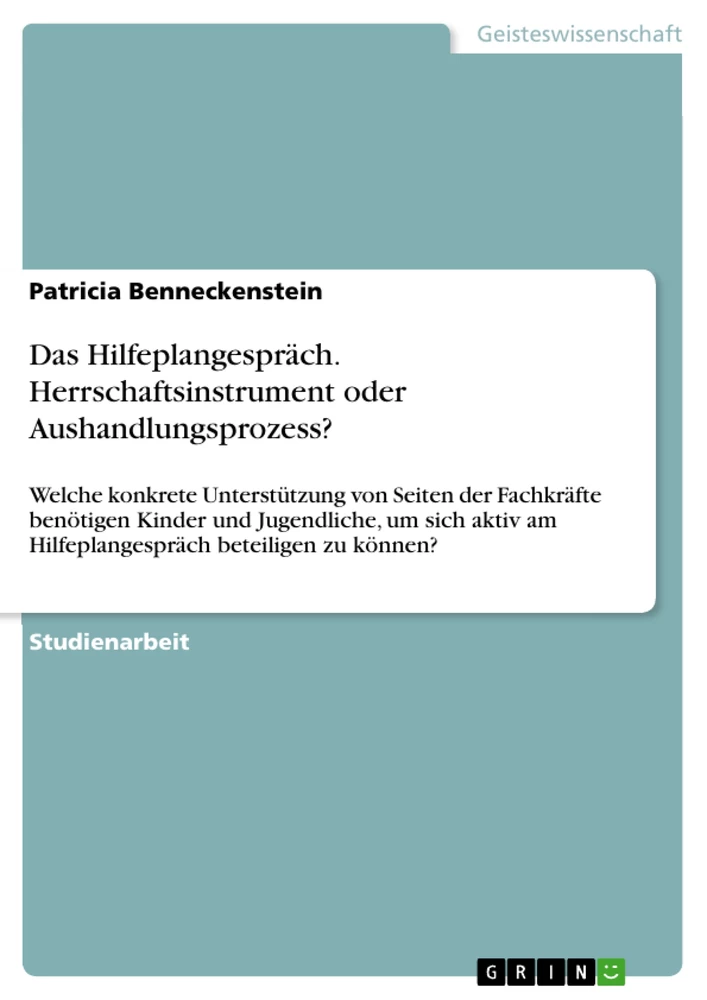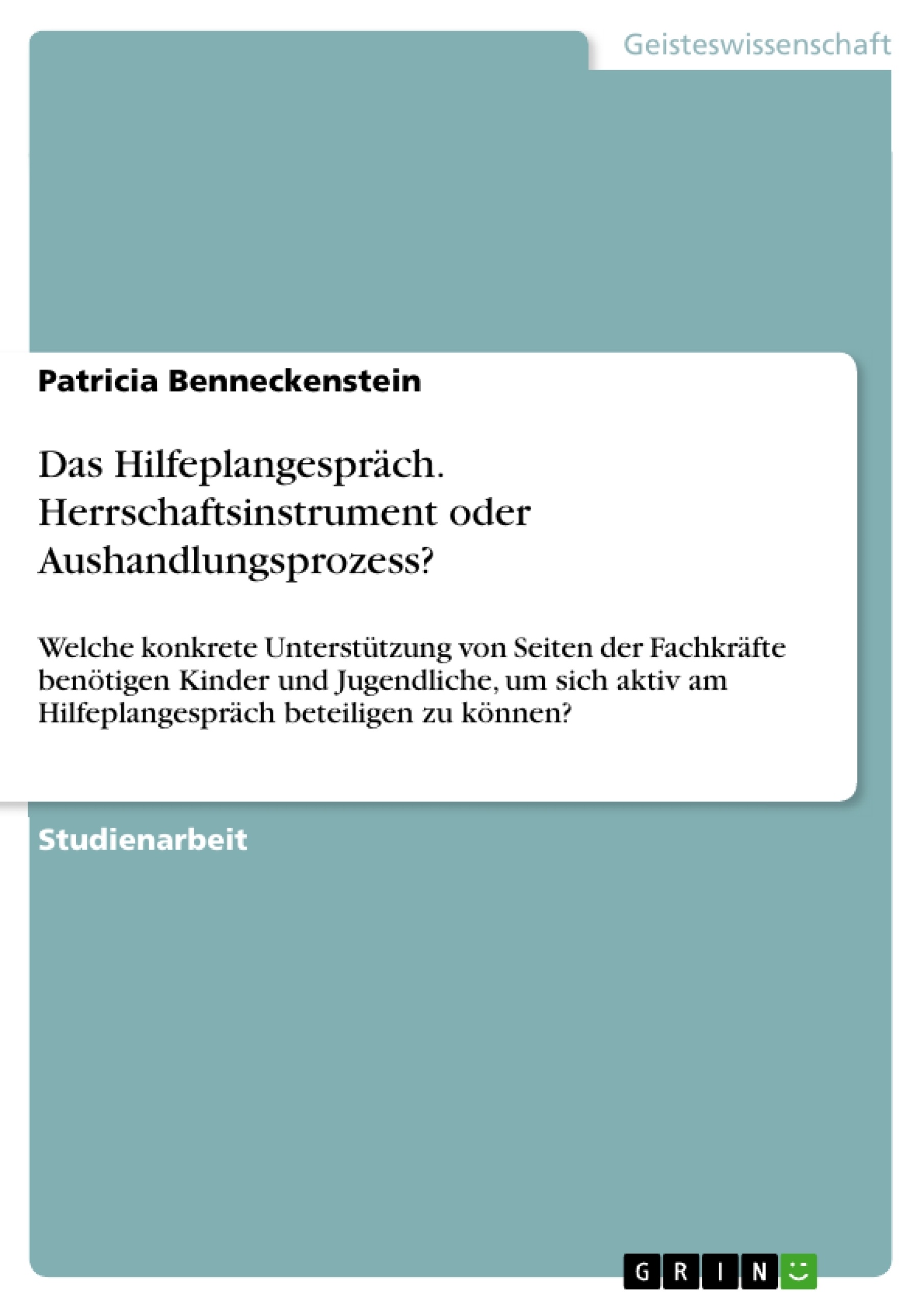Es handelt sich um eine Ausarbeitung zum Thema Hilfeplanverfahrens und zur Partizipation in den Erzieherischen Hilfen.
Die Ausführungen nehmen unter anderem Bezug auf die Fortschreibung des Hilfeplans im Setting der stationären Erziehungshilfe. Der Fortschreibung des Hilfeplans sind schon Hilfeplangespräche und die Unterbringung des Kindes/des Jugendlichen in einer Einrichtung der stationären Erziehungshilfe vorausgegangen. Daher wird zu Beginn der Arbeit kurz das Hilfeplanverfahren allgemein erläutert, um dann unter dem Gesichtspunkt der Partizipation zu klären, wie eine aktive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, durch eine von Seiten der Fachkräfte optimale Gestaltung und Vorbereitung des Hilfeplangesprächs, sichergestellt werden kann. Die Ausführungen beziehen sich insbesondere auf Fachkräfte in Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe. Diese sind, im Hinblick auf eine aktive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Hilfeplangespräch, besonders gefordert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Hilfeplanverfahren
- 2.1 Ziele und Aufgaben des Hilfeplanverfahrens
- 2.2 Das Hilfeplangespräch - ein Aushandlungsort
- 2.3 Fortschreibung des Hilfeplans
- 3. Partizipation in den Erzieherischen Hilfen
- 3.1 Partizipation als gesetzlicher Auftrag
- 3.2 Partizipation - eine Frage der Haltung?
- 3.3 Methodische Hindernisse bei der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Hilfeplangespräch
- 3.4 Methoden und Verfahren zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Hilfeplangespräch
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten der aktiven Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am Hilfeplangespräch. Ziel ist es, Wege aufzuzeigen, wie das Hilfeplangespräch von einem Herrschaftsinstrument zu einem Aushandlungsprozess umgewandelt werden kann, in dem die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt werden. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen der Partizipation und beleuchtet methodische Herausforderungen und Lösungsansätze.
- Rechtliche Grundlagen der Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Hilfeplangespräch
- Das Hilfeplangespräch als Aushandlungsprozess versus Herrschaftsinstrument
- Methodische Herausforderungen bei der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
- Methoden zur Förderung der aktiven Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
- Rolle der Fachkräfte bei der Gestaltung partizipativer Hilfeplangespräche
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung verdeutlicht die Problematik der mangelnden Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Hilfeplangesprächen, die oft als negativ behaftet und angstbesetzt erlebt werden. Sie veranschaulicht mit einem Zitat von Astrid Lindgren die Ungleichheit der Machtverhältnisse und betont die Notwendigkeit, das Hilfeplangespräch zu einem Ort der Aushandlung zu machen, an dem die Perspektiven aller Beteiligten berücksichtigt werden. Der Fokus liegt auf der Frage, wie Kinder und Jugendliche aktiv am Hilfeplangespräch teilnehmen können und wie Fachkräfte dies optimal unterstützen können. Der Bezug auf § 36 SGB VIII unterstreicht die rechtliche Verpflichtung zur Beteiligung.
2. Das Hilfeplanverfahren: Dieses Kapitel erläutert das Hilfeplanverfahren im Detail, beginnend mit den Zielen und Aufgaben der Hilfeplanung gemäß § 36 SGB VIII. Es betont die gemeinsame Erstellung des Hilfeplans mit den Personensorgeberechtigten und den Minderjährigen, um sicherzustellen, dass nicht über deren Köpfe hinweg entschieden wird. Der Abschnitt 2.2 fokussiert das Hilfeplangespräch als Aushandlungsort, in dem alle Beteiligten gleichberechtigt sind und die Perspektiven aller berücksichtigt werden sollen. Ein verändertes Hilfeverständnis wird betont, das die Selbstbestimmung der Klienten in den Mittelpunkt stellt. Der Abschnitt 2.3 schließlich befasst sich mit der regelmäßigen Überprüfung und Fortschreibung des Hilfeplans, um sicherzustellen, dass die gewählte Hilfe weiterhin geeignet und notwendig ist.
Schlüsselwörter
Hilfeplangespräch, Partizipation, Kinder, Jugendliche, Hilfeplanverfahren, § 36 SGB VIII, Aushandlungsprozess, Erziehungshilfe, Methoden, Fachkräfte, Beteiligung, Selbstbestimmung
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Partizipation im Hilfeplangespräch"
Was ist der Gegenstand des Dokuments?
Das Dokument analysiert die Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Hilfeplangespräch. Es untersucht, wie das Hilfeplangespräch von einem einseitigen Verfahren zu einem Aushandlungsprozess umgewandelt werden kann, in dem die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt werden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Grundlagen der Partizipation gemäß § 36 SGB VIII, das Hilfeplangespräch als Aushandlungsprozess im Gegensatz zu einem Herrschaftsinstrument, methodische Herausforderungen bei der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Methoden zur Förderung der aktiven Beteiligung und die Rolle der Fachkräfte bei der Gestaltung partizipativer Hilfeplangespräche. Das Dokument enthält eine Einleitung, eine detaillierte Beschreibung des Hilfeplanverfahrens, einen Abschnitt zur Partizipation und ein Fazit. Es bietet zudem eine Kapitelzusammenfassung und eine Liste mit Schlüsselbegriffen.
Wie ist das Hilfeplanverfahren beschrieben?
Das Hilfeplanverfahren wird als ein Prozess beschrieben, der die Ziele und Aufgaben der Hilfeplanung gemäß § 36 SGB VIII beinhaltet. Es betont die gemeinsame Erstellung des Hilfeplans mit den Personensorgeberechtigten und den Minderjährigen. Das Hilfeplangespräch wird als Aushandlungsort dargestellt, in dem alle Beteiligten gleichberechtigt sind und die Perspektiven aller berücksichtigt werden sollen. Die regelmäßige Überprüfung und Fortschreibung des Hilfeplans wird ebenfalls thematisiert.
Welche methodischen Herausforderungen werden angesprochen?
Das Dokument identifiziert methodische Hindernisse bei der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Hilfeplangespräch und präsentiert Lösungsansätze und Methoden zur Förderung der aktiven Beteiligung. Es betont die Notwendigkeit, das Hilfeplangespräch zu einem Ort der Aushandlung zu machen, an dem die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt stehen.
Welche Rolle spielen die Fachkräfte?
Die Rolle der Fachkräfte bei der Gestaltung partizipativer Hilfeplangespräche wird als essentiell hervorgehoben. Sie sind aufgefordert, die aktive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen und das Hilfeplangespräch zu einem Aushandlungsprozess zu gestalten.
Welche rechtlichen Grundlagen werden genannt?
Die rechtlichen Grundlagen der Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Hilfeplangespräch werden anhand von § 36 SGB VIII erläutert. Dieser Paragraf unterstreicht die rechtliche Verpflichtung zur Beteiligung der Kinder und Jugendlichen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Hilfeplangespräch, Partizipation, Kinder, Jugendliche, Hilfeplanverfahren, § 36 SGB VIII, Aushandlungsprozess, Erziehungshilfe, Methoden, Fachkräfte, Beteiligung, Selbstbestimmung.
- Citar trabajo
- Patricia Benneckenstein (Autor), 2016, Das Hilfeplangespräch. Herrschaftsinstrument oder Aushandlungsprozess?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352024