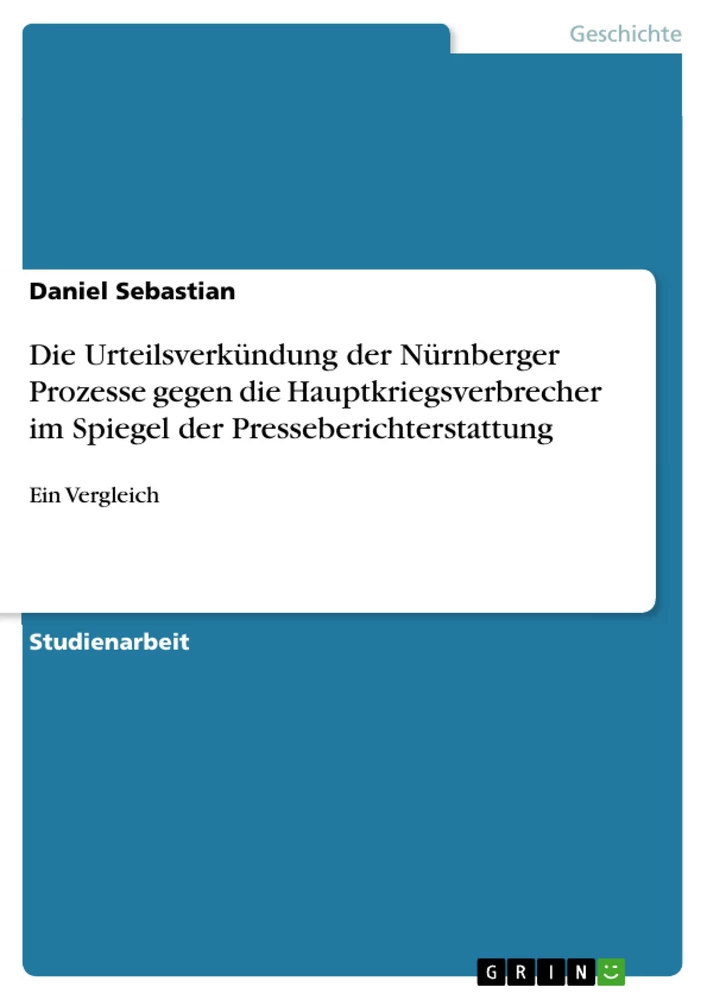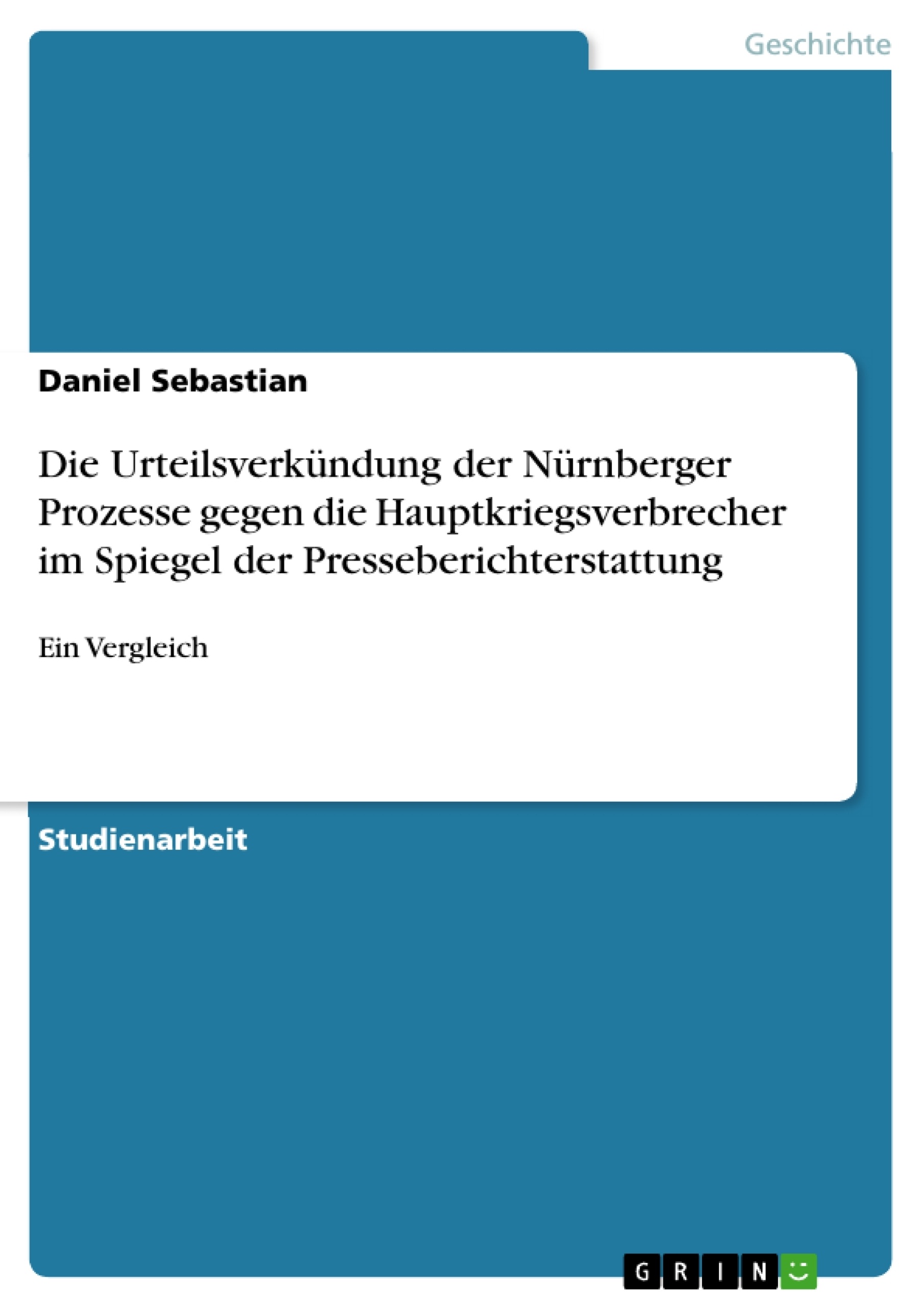Die vorliegende Arbeit thematisiert die deutsche Presseberichterstattung über die Urteilsverkündung der Nürnberger Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher des Zweiten Weltkrieges vom 30. September und 1. Oktober 1946. Die Frage hiernach ist insofern von besonderem Interesse, weil das Pressewesen als Massenmedium nach den Vorstellungen der alliierten Besatzungsmächte einen wesentlichen Beitrag zur Demokratisierung Deutschlands nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus leisten sollte.
In dieser Untersuchung wird der Frage nachgegangen, inwiefern und vor allem in welcher Intensität die Presse über die Urteilsverkündung berichtet hat. Gab es unter der Berücksichtigung der alliierten Zensur eine sachliche und unabhängige Darstellung? Sind die Artikel mit bestimmten Absichten oder einer Kritik an die Urteile versehen? Was wird positiv oder auch negativ wahrgenommen? Sind gravierende Unterschiede in der Berichterstattung vorhanden? Der Beantwortung dieser Fragen liegen als Quellen die Ausgaben der „Neuen Zeitung“ vom 2. Oktober 1946 und der „Süddeutschen Zeitung“ vom 4. Oktober 1946 zugrunde. Diese sind für einen Vergleich prädestiniert, da sie beide zum einen in München in der amerikanischen Besatzungszone herausgegeben wurden und zum anderen dort die höchsten Auflagenwerte besaßen.
Diese Arbeit gliedert sich in drei Teile: Zunächst wird der historische Kontext, konkret die Entwicklung des Pressewesen in der amerikanischen Besatzungszone von der Kapitulation Deutschlands zur selbstständigen Lizenzpresse dargestellt. Im Anschluss daran erfolgt die Quellenanalyse, bevor es schließlich zu einer kritischen Reflexion der herausgearbeiteten Erkenntnisse kommt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Pressewesen in der Nachkriegszeit
- Die Entwicklung zur Lizenzpresse
- Die Neue Zeitung
- Die Süddeutsche Zeitung
- Hausarbeit
- Die Neue Zeitung vom 2. Oktober 1946
- Die Süddeutsche Zeitung vom 4. Oktober 1946
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Berichterstattung der deutschen Presse über das Urteil im Nürnberger Prozess gegen Hauptkriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs im September/Oktober 1946. Im Fokus steht die Frage nach der Objektivität und Unabhängigkeit der Berichterstattung unter Berücksichtigung der alliierten Zensur, sowie die Identifizierung möglicher Intentionen und Bewertungen der Urteile in den Artikeln. Die Analyse konzentriert sich auf die "Neue Zeitung" und die "Süddeutsche Zeitung" aufgrund ihrer hohen Auflagen in München.
- Entwicklung des deutschen Pressewesens in der amerikanischen Besatzungszone nach dem Zweiten Weltkrieg
- Analyse der Berichterstattung der "Neuen Zeitung" und der "Süddeutschen Zeitung" über die Nürnberger Prozesse
- Bewertung der Objektivität und der Intentionen in der Berichterstattung unter Berücksichtigung der alliierten Zensur
- Vergleich der Berichterstattung beider Zeitungen
- Einfluss der alliierten Pressepolitik auf den Wiederaufbau der deutschen Presse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit analysiert die Berichterstattung über das Urteil im Nürnberger Prozess in deutschen Zeitungen im Herbst 1946. Sie untersucht die Objektivität und Intentionen der Berichterstattung unter dem Einfluss der alliierten Zensur, wobei die "Neue Zeitung" und die "Süddeutsche Zeitung" als Fallstudien dienen. Die Einleitung begründet die Relevanz des Themas im Kontext der Demokratisierung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg und skizziert den Forschungsstand.
Das Pressewesen in der Nachkriegszeit: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des deutschen Pressewesens in der amerikanischen Besatzungszone nach dem Zweiten Weltkrieg. Es beleuchtet die Ziele der alliierten Pressepolitik im Rahmen der Entnazifizierung und Umerziehung, die Herausforderungen beim Wiederaufbau eines demokratischen und unabhängigen Pressewesens und die verschiedenen Phasen dieses Prozesses – vom "Blackout" über die Heeresgruppenzeitungen bis hin zur Lizenzpresse. Die unterschiedlichen Ansätze innerhalb der alliierten Militärregierung und die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Lizenzierungsrichtlinien werden ebenfalls erörtert. Der Fokus liegt auf der Entstehung einer pluralistischen Presselandschaft unter den schwierigen Bedingungen der unmittelbaren Nachkriegszeit.
Die Neue Zeitung: Dieses Kapitel befasst sich mit der "Neuen Zeitung", einer amerikanischen Zeitung für die deutsche Bevölkerung. Es beschreibt die Entstehung, den Aufbau und die enorme Verbreitung der Zeitung. Die Rolle der Mitherausgeber und die Zusammensetzung der Redaktion aus Emigranten werden hervorgehoben. Der Beitrag analysiert die anfängliche, breite Berichterstattung über die Nürnberger Prozesse, die von der Redaktion als Chance für eine deutsch-amerikanische Versöhnung betrachtet wurde. Das Kapitel beleuchtet den Spagat der Zeitung zwischen ihrer Funktion als offizielles Organ der amerikanischen Behörden und ihrem Anspruch, als Vermittler zwischen Besatzungsmacht und Bevölkerung zu fungieren.
Schlüsselwörter
Pressewesen, Nachkriegszeit, amerikanische Besatzungszone, Lizenzpresse, Nürnberger Prozesse, "Neue Zeitung", "Süddeutsche Zeitung", Berichterstattung, Zensur, Demokratisierung, Umerziehung, Objektivität, Intentionen, Propaganda, Medienpolitik.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse der deutschen Presseberichterstattung über die Nürnberger Prozesse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Berichterstattung der deutschen Presse über das Urteil im Nürnberger Prozess gegen Hauptkriegsverbrecher im September/Oktober 1946. Der Fokus liegt auf der Objektivität und Unabhängigkeit der Berichterstattung unter dem Einfluss der alliierten Zensur und der Identifizierung möglicher Intentionen und Bewertungen in den Artikeln der "Neuen Zeitung" und der "Süddeutschen Zeitung".
Welche Zeitungen werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf die "Neue Zeitung" und die "Süddeutsche Zeitung", aufgrund ihrer hohen Auflagen in München zu dieser Zeit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des deutschen Pressewesens in der amerikanischen Besatzungszone nach dem Zweiten Weltkrieg, die Analyse der Berichterstattung beider Zeitungen über die Nürnberger Prozesse, die Bewertung der Objektivität und Intentionen in der Berichterstattung unter Berücksichtigung der alliierten Zensur, einen Vergleich der Berichterstattung beider Zeitungen und den Einfluss der alliierten Pressepolitik auf den Wiederaufbau der deutschen Presse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Pressewesen in der Nachkriegszeit, Kapitel zu den einzelnen Zeitungen ("Neue Zeitung" und "Süddeutsche Zeitung") und ein Fazit. Sie enthält zudem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Berichterstattung über die Nürnberger Prozesse in ausgewählten deutschen Zeitungen zu untersuchen und die Faktoren zu analysieren, die diese Berichterstattung beeinflusst haben, insbesondere die alliierte Zensur und die politischen Rahmenbedingungen der Nachkriegszeit.
Welche Rolle spielt die alliierte Zensur?
Die alliierte Zensur spielt eine zentrale Rolle in der Analyse. Die Arbeit untersucht, wie sich die Zensur auf die Objektivität und die Intentionen der Berichterstattung ausgewirkt hat und wie die Zeitungen mit den Beschränkungen umgegangen sind.
Wie werden die "Neue Zeitung" und die "Süddeutsche Zeitung" verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Berichterstattung beider Zeitungen, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten in ihrer Darstellung der Nürnberger Prozesse aufzuzeigen und um mögliche unterschiedliche Intentionen oder Perspektiven zu identifizieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pressewesen, Nachkriegszeit, amerikanische Besatzungszone, Lizenzpresse, Nürnberger Prozesse, "Neue Zeitung", "Süddeutsche Zeitung", Berichterstattung, Zensur, Demokratisierung, Umerziehung, Objektivität, Intentionen, Propaganda, Medienpolitik.
Welche Bedeutung hat diese Analyse im Kontext der Nachkriegsgeschichte?
Die Analyse ist relevant, um das Verständnis des Wiederaufbaus des deutschen Pressewesens nach dem Zweiten Weltkrieg und den Herausforderungen bei der Etablierung eines freien und unabhängigen Journalismus unter den Bedingungen der alliierten Besatzung zu vertiefen. Sie beleuchtet auch die Schwierigkeiten bei der Objektivität in einer Zeit politischer Umbrüche und Einflussnahme.
- Quote paper
- Daniel Sebastian (Author), 2016, Die Urteilsverkündung der Nürnberger Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher im Spiegel der Presseberichterstattung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351613