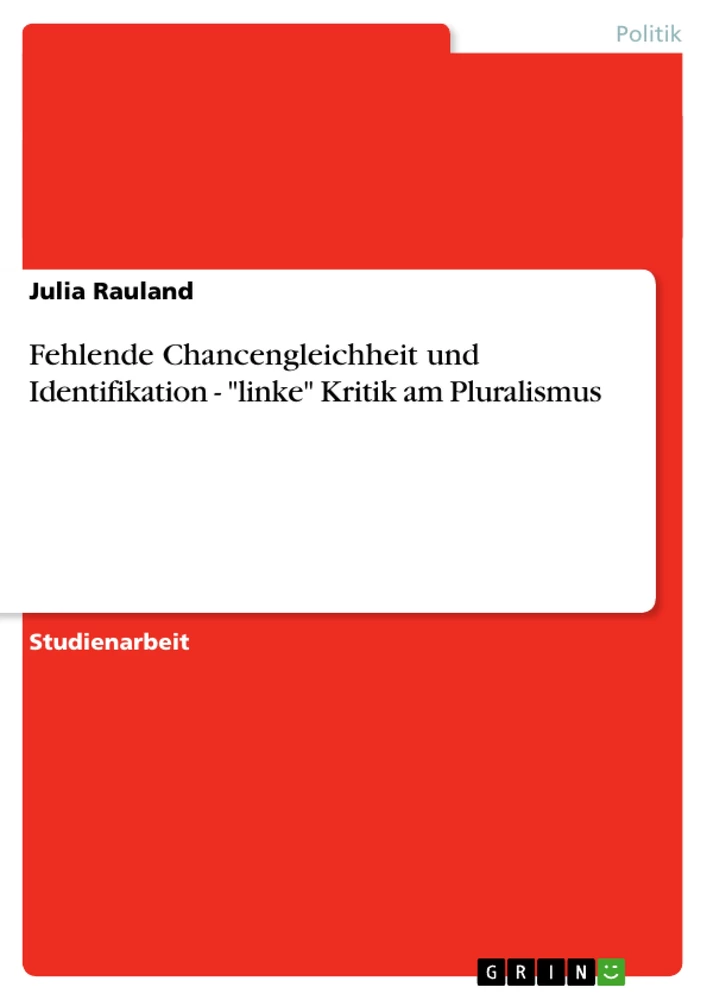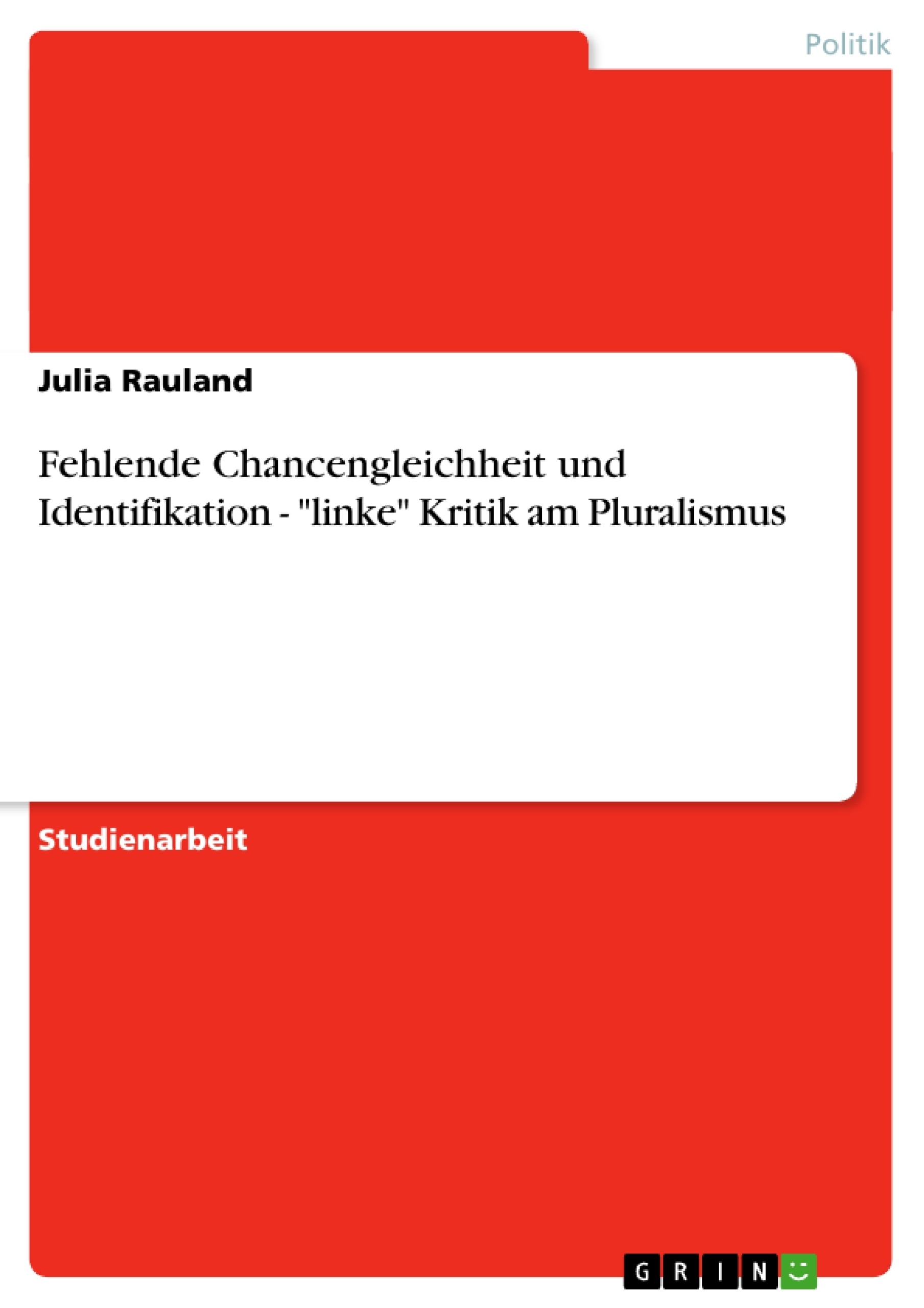Das System in dem wir leben, das der Bundesrepublik Deutschland, wird gewöhnlich als
pluralistische Demokratie bezeichnet. Pluralismus, im Gegensatz zu Monismus oder
Totalitarismus enthält für den Großteil der Menschen positive Konnotationen; er wird
assoziiert mit Freiheit, Opposition, Vielfalt der Meinungen und der Möglichkeit der
Einflussnahme aller Bürger. Nichtsdestotrotz wurde, verstärkt in den Siebziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts durch die Generation der Neuen Linken, Kritik laut an diesem Konzept
der Toleranz. Die Ansatzpunkte der Kritiker waren zahlreich und reichten vom Vorwurf der
Elitenherrschaft und der Oligarchisierung bis zu einer Diskreditierung des Pluralismus als
Instrument zur Verschleierung der Kapitalherrschaft.1 Viele dieser Ansätze sind heute
entweder nicht mehr in der Diskussion, widerlegt oder von der Wirklichkeit eingeholt
worden. Einige Kritikpunkte sind jedoch heute noch aktuell und sollten auch im modernen
Diskurs nicht ignoriert werden. Der wichtigste und stichhaltigste unter ihnen ist der Vorwurf
der mangelnden Chancengleichheit der Interessen, dem ich mich in dieser Arbeit widmen
werde. Noch heute haben im pluralistischen System der Willensbildung nicht alle Interessen
die gleichen Chancen, Berücksichtigung zu finden, noch immer sind es
Minderheiteninteressen am Rande der Gesellschaft, wie die Bedürfnisse Arbeitsloser, oder
allgemeine Interessen, wie Gesundheit oder Umweltschutz, die in den Mühlen der politischen
Entscheidungsfindung untergehen und in der Auseinandersetzung mit den
Interessenvertretungen der organisierten Großindustrie den Kürzeren ziehen. Insofern ist es
auch dreißig Jahre nach Formulierung der Kritik noch sinnvoll, sich mit diesem Thema
auseinanderzusetzen. In diesem Zusammenhang werde ich mich schwerpunktmäßig mit der
Kritik des deutschen Theoretikers Claus Offe beschäftigen, aber auch die Pluralismuskritik
des amerikanischen Philosophen Robert Paul Wolff in die Analyse mit einbeziehen. Das
Thema füllt insofern einen wichtigen Platz im Kontext einer Veranstaltung über
Repräsentationstheorien aus, als die pluralistische Vertretung durch Interessengruppen die
wichtigste Form der Repräsentation gesellschaftlicher Interessen im politischen Prozess
darstellt. [...]
1 Vgl. zum Elitenvorwurf: Bachrach, Peter/ Baratz, Morton S. (1970), Power and Poverty, Theory and Practice,
New York u. a., zu Verschwörungstheorien: Agnoli, Johannes/ Brückner, Peter (1986), Die Transformation der
Demokratie, Frankfurt a. M.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Hauptteil
- Ansätze linker Pluralismuskritik
- Die Kritik Claus Offes.
- Die Kritik Robert Paul Wolffs.
- Positionen der Gegenkritik.
- Klassiker der Pluralismustheorie
- Die Konzeption Ernst Fraenkels.
- Die Konzeption David B. Trumans.
- Ansätze linker Pluralismuskritik
- Konklusion.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der linken Kritik am Pluralismus, insbesondere mit dem Argument der mangelnden Chancengleichheit von Interessen im politischen System. Die Analyse fokussiert auf die Theorien von Claus Offe und Robert Paul Wolff und untersucht, inwieweit diese Kritikpunkte auch heute noch relevant sind.
- Kritik am Pluralismus als Instrument der Kapitalherrschaft.
- Ungleichheit in der Befriedigung von Lebensbedürfnissen im Spätkapitalismus.
- Filtermechanismen im politischen System, die bestimmte Interessen benachteiligen.
- Chancengleichheit als utopische Kategorie oder Zielvorstellung für die Demokratie.
- Relevanz der Pluralismuskritik für die Theorie der politischen Repräsentation.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der linken Pluralismuskritik ein und erläutert den Kontext der Arbeit. Sie stellt den Vorwurf der mangelnden Chancengleichheit als zentralen Kritikpunkt heraus und benennt die zentralen Figuren der Analyse: Claus Offe und Robert Paul Wolff. Die Einleitung verdeutlicht die Relevanz des Themas für die Theorie der politischen Repräsentation.
- Ansätze linker Pluralismuskritik: Dieses Kapitel widmet sich der Kritik am Pluralismus aus linker Perspektive. Es beleuchtet insbesondere Claus Offes Konzept der Disparität der Lebensbereiche, das die Ungleichheiten bei der Befriedigung von Bedürfnissen in der spätkapitalistischen Gesellschaft thematisiert. Offes Argumentation basiert auf der Annahme, dass politische Entscheidungen die Befriedigung von wichtigen Lebensbedürfnissen beeinflussen, während bestimmte Interessen in den politischen Entscheidungsprozessen unterrepräsentiert bleiben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der politischen Theorie, wie Pluralismus, Chancengleichheit, Interessenvertretung, Repräsentation und Lebensbedürfnisse. Darüber hinaus werden die Theorien von Claus Offe, Robert Paul Wolff und Kurt Sontheimer im Kontext der linken Kritik am Pluralismus untersucht.
- Citar trabajo
- Julia Rauland (Autor), 2004, Fehlende Chancengleichheit und Identifikation - "linke" Kritik am Pluralismus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35152