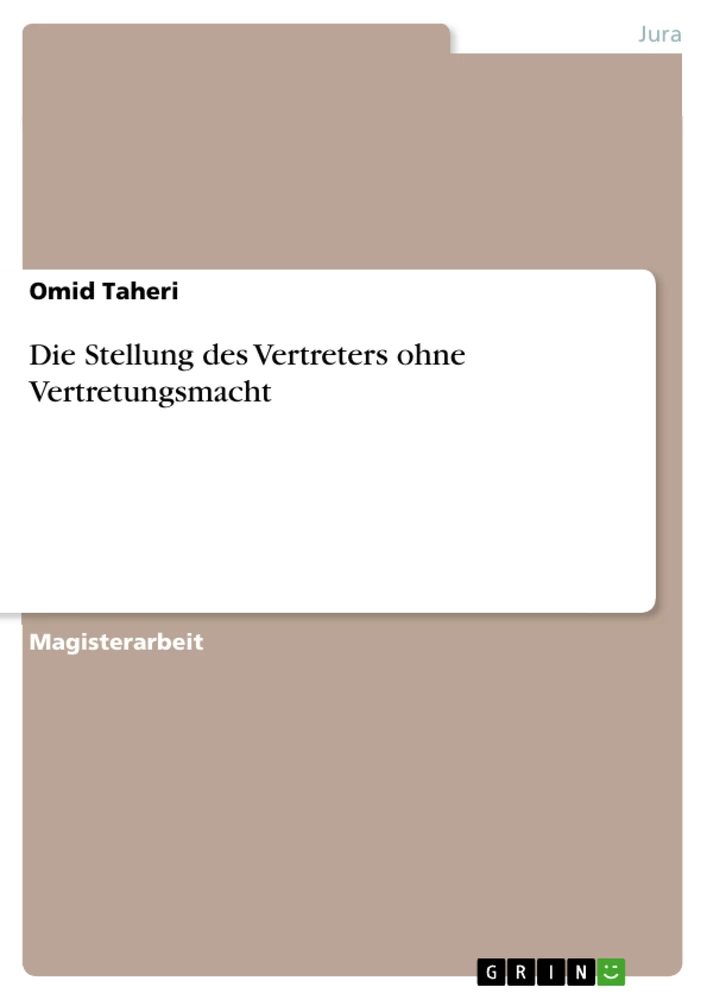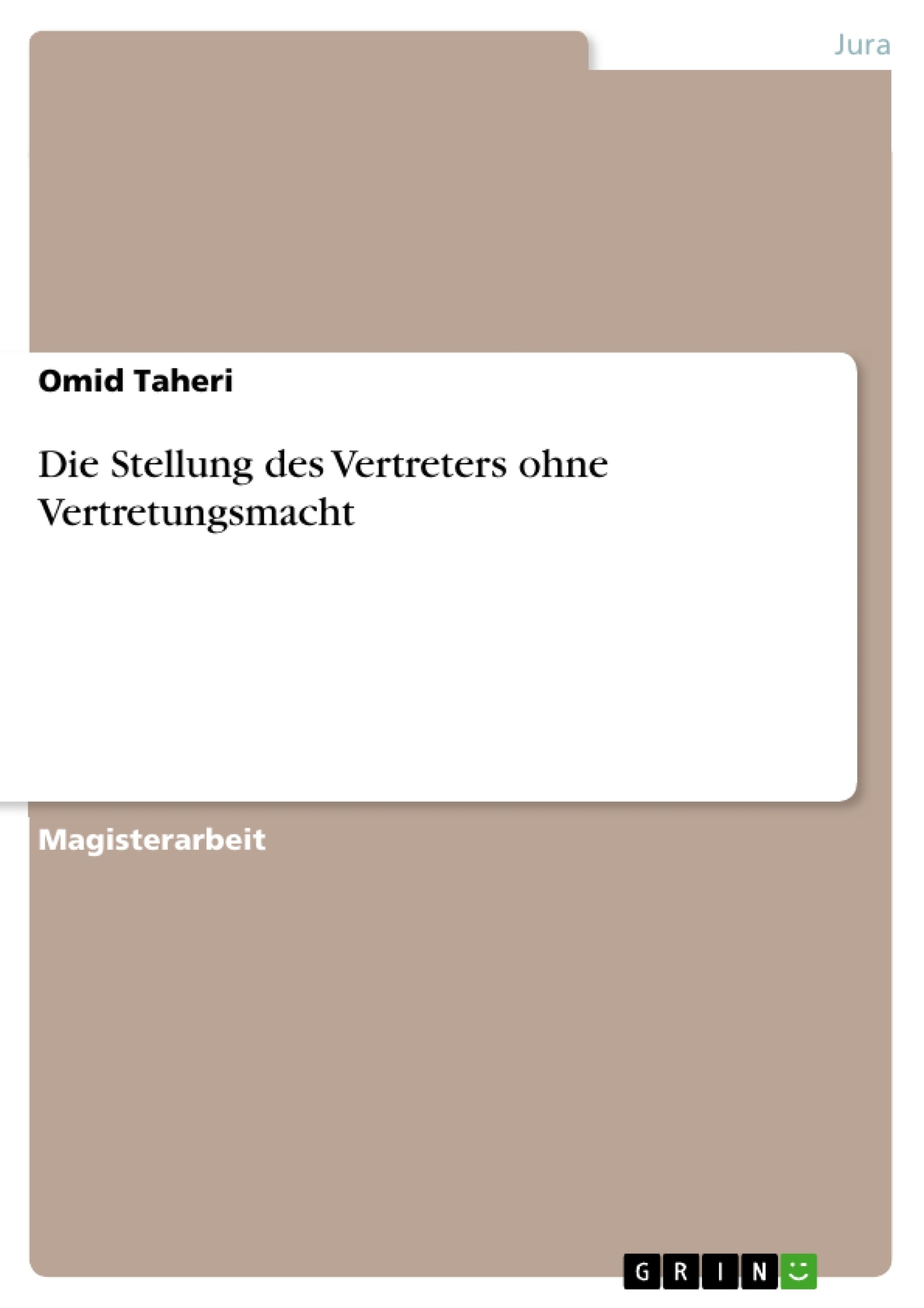Durch Stellvertretung ist es möglich, dass eine oder mehrere Personen (der Vertreter bzw. die Vertreter) im Namen einer anderen Person (der Vertretene) rechtsgeschäftlich handelt. Die Rechtsfolgen der Handlungen des Vertreters jedoch treffen den Vertretenen. Der Vertretene soll jedoch sicher sein, dass der Vertreter innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht handelt. Das bedeutet, dass der Vertretene nicht haftbar gemacht werden kann für getätigte Geschäfte ohne Vertretungsmacht. In dieser Magisterarbeit geht es genau um das Thema „die Stellung des Vertreters ohne Vertretungsmacht“ (§§ 177 ff. BGB).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Die Arten der Vertretungsmacht
- 1. Die gewillkürte Vertretungsmacht
- 2. Die gesetzliche Vertretungsmacht
- 3. Die organschaftliche Vertretungsmacht
- II. Der Vertreter mit Vertretungsmacht
- 1. Die Voraussetzungen der Stellvertretung
- 2. Die Rechtsfolge der Stellvertretung
- III. Der Vertreter ohne Vertretungsmacht
- 1. Definitionen
- 2. Die Voraussetzungen der Vertretung ohne Vertretungsmacht
- 3. Der Bote ohne Botenmacht
- IV. Die Stellung des Vertreters ohne Vertretungsmacht
- 1. Die Stellung des ohne Vertretungsmacht geschlossenen Vertrags
- 2. Die Stellung des Vertreters ohne Vertretungsmacht
- 3. Die mehrstufige Vertretung
- 4. Missbrauch der Vertretungsmacht
- 5. Der Anspruch gegen den falsus procurator im Verhältnis zu anderen Haftungsansprüchen
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Rechtslage des Vertreters ohne Vertretungsmacht im deutschen Recht. Ziel ist es, die verschiedenen Konstellationen und Rechtsfolgen dieser Situation umfassend zu analysieren und die Haftungsfragen zu klären.
- Arten der Vertretungsmacht
- Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Stellvertretung
- Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht
- Mehrstufige Vertretung und deren Problematiken
- Abgrenzung zu ähnlichen Rechtsinstituten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Stellvertretung ein und betont die zunehmende Bedeutung im modernen Leben, in dem die Erledigung von Aufgaben durch Dritte immer wichtiger wird. Sie verweist auf die Notwendigkeit der rechtlichen Regelung dieser Konstellationen, besonders im Hinblick auf Geschäftsunfähigkeit und die Notwendigkeit der Stellvertretung, wie sie im BGB geregelt ist. Die Einleitung bildet eine Brücke zum Hauptteil der Arbeit, indem sie die Relevanz des Themas im Kontext des modernen Lebens und des BGB hervorhebt.
I. Die Arten der Vertretungsmacht: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Arten der Vertretungsmacht, darunter die gewillkürte, die gesetzliche und die organschaftliche Vertretungsmacht. Es differenziert zwischen den verschiedenen Grundlagen und Voraussetzungen jeder Form der Vertretungsmacht und legt den Grundstein für das Verständnis der komplexen Rechtslage, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt wird. Die Unterscheidung dieser Arten ist fundamental, um die unterschiedlichen Rechtsfolgen und Haftungsregelungen zu verstehen, welche im Falle des Handelns ohne Vertretungsmacht relevant werden.
II. Der Vertreter mit Vertretungsmacht: Dieses Kapitel analysiert die Voraussetzungen für eine wirksame Stellvertretung und die daraus resultierenden Rechtsfolgen. Es beleuchtet die Bedeutung von Zulässigkeit, der eigenen Willenserklärung des Vertreters, der Offenkundigkeit und der tatsächlichen Vertretungsmacht. Die Unterscheidung zwischen Innen- und Außenvollmacht wird detailliert dargestellt, um das Verständnis für die Komplexität der Rechtslage zu fördern. Das Kapitel bildet einen wichtigen Kontrast zum folgenden Kapitel über den Vertreter ohne Vertretungsmacht, indem es die notwendigen Voraussetzungen für eine wirksame Vertretung herausarbeitet.
III. Der Vertreter ohne Vertretungsmacht: Dieses Kapitel definiert den "falsus procurator" und die Vertretung ohne Vertretungsmacht. Es analysiert die Voraussetzungen dafür, dass trotz fehlender Vertretungsmacht eine wirksame Vertretung entstehen kann, beispielsweise durch Duldungs- oder Anscheinsvollmacht. Die Abgrenzung zum Boten wird ebenfalls behandelt. Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und legt die Grundlage für die anschließende Untersuchung der Rechtsfolgen.
IV. Die Stellung des Vertreters ohne Vertretungsmacht: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Rechtslage des ohne Vertretungsmacht geschlossenen Vertrags, der schwebend unwirksamen Situation und der möglichen Genehmigung oder Verweigerung der Genehmigung durch den Vertretenen. Es analysiert die verschiedenen Haftungsregelungen nach § 179 BGB (Haftung des Vertreters, Haftungsausschlüsse) und untersucht die Problematik der mehrstufigen Vertretung, des Missbrauchs der Vertretungsmacht und die Beziehungen zwischen den verschiedenen Haftungsansprüchen (Vertretener, Vertreter, Geschäftsgegner).
Schlüsselwörter
Stellvertretung, Vertretungsmacht, falsus procurator, § 179 BGB, Haftung, Genehmigung, Duldungsvollmacht, Anscheinsvollmacht, mehrstufige Vertretung, Innenvollmacht, Außenvollmacht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Der Vertreter ohne Vertretungsmacht
Was ist der Gegenstand der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht umfassend die Rechtslage des Vertreters ohne Vertretungsmacht (falsus procurator) im deutschen Recht. Der Fokus liegt auf der Analyse verschiedener Konstellationen, der daraus resultierenden Rechtsfolgen und der Klärung der damit verbundenen Haftungsfragen.
Welche Arten der Vertretungsmacht werden behandelt?
Die Arbeit differenziert zwischen verschiedenen Arten der Vertretungsmacht: gewillkürte, gesetzliche und organschaftliche Vertretungsmacht. Diese Unterscheidung ist essentiell für das Verständnis der Rechtsfolgen im Kontext des Handelns ohne Vertretungsmacht.
Welche Voraussetzungen müssen für eine wirksame Stellvertretung erfüllt sein?
Die Arbeit beleuchtet die Voraussetzungen für eine wirksame Stellvertretung, einschließlich Zulässigkeit, eigener Willenserklärung des Vertreters, Offenkundigkeit und tatsächlicher Vertretungsmacht. Die Unterscheidung zwischen Innen- und Außenvollmacht wird detailliert dargestellt.
Was ist ein „falsus procurator“ und welche Voraussetzungen kennzeichnen die Vertretung ohne Vertretungsmacht?
Die Arbeit definiert den „falsus procurator“ und analysiert die Voraussetzungen, unter denen trotz fehlender Vertretungsmacht eine wirksame Vertretung entstehen kann (z.B. Duldungs- oder Anscheinsvollmacht). Die Abgrenzung zum Boten wird ebenfalls thematisiert.
Welche Rechtsfolgen ergeben sich aus einem Vertrag, der ohne Vertretungsmacht geschlossen wurde?
Die Arbeit behandelt die Rechtslage des ohne Vertretungsmacht geschlossenen Vertrags, die schwebend unwirksame Situation und die Möglichkeiten der Genehmigung oder Verweigerung der Genehmigung durch den Vertretenen.
Wie sieht die Haftungsregelung für den Vertreter ohne Vertretungsmacht aus?
Die Arbeit analysiert die verschiedenen Haftungsregelungen nach § 179 BGB (Haftung des Vertreters, Haftungsausschlüsse). Die Problematik der mehrstufigen Vertretung und des Missbrauchs der Vertretungsmacht sowie die Beziehungen zwischen den verschiedenen Haftungsansprüchen (Vertretener, Vertreter, Geschäftsgegner) werden untersucht.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für das Verständnis der Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Stellvertretung, Vertretungsmacht, falsus procurator, § 179 BGB, Haftung, Genehmigung, Duldungsvollmacht, Anscheinsvollmacht, mehrstufige Vertretung, Innenvollmacht und Außenvollmacht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, vier Hauptkapitel (I. Die Arten der Vertretungsmacht; II. Der Vertreter mit Vertretungsmacht; III. Der Vertreter ohne Vertretungsmacht; IV. Die Stellung des Vertreters ohne Vertretungsmacht) und ein Kapitel mit Zusammenfassung und Schlüsselbegriffen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Magisterarbeit?
Ziel der Arbeit ist die umfassende Analyse der Rechtslage des Vertreters ohne Vertretungsmacht, die Klärung der Haftungsfragen und das Verständnis der verschiedenen Konstellationen in diesem Bereich des Rechts.
- Citar trabajo
- Omid Taheri (Autor), 2013, Die Stellung des Vertreters ohne Vertretungsmacht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351410