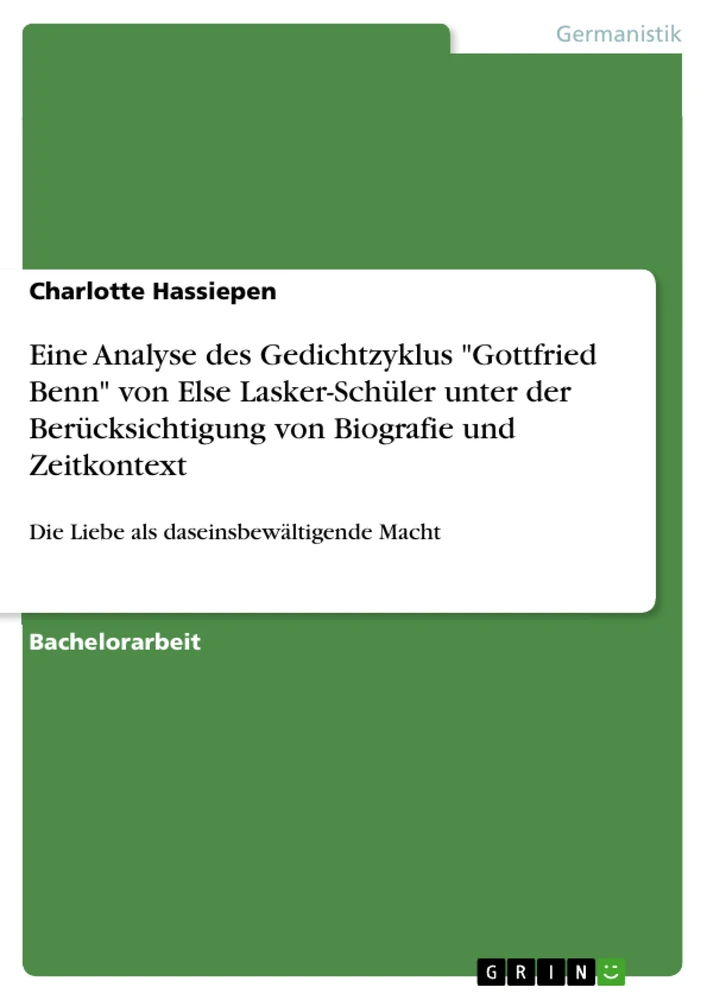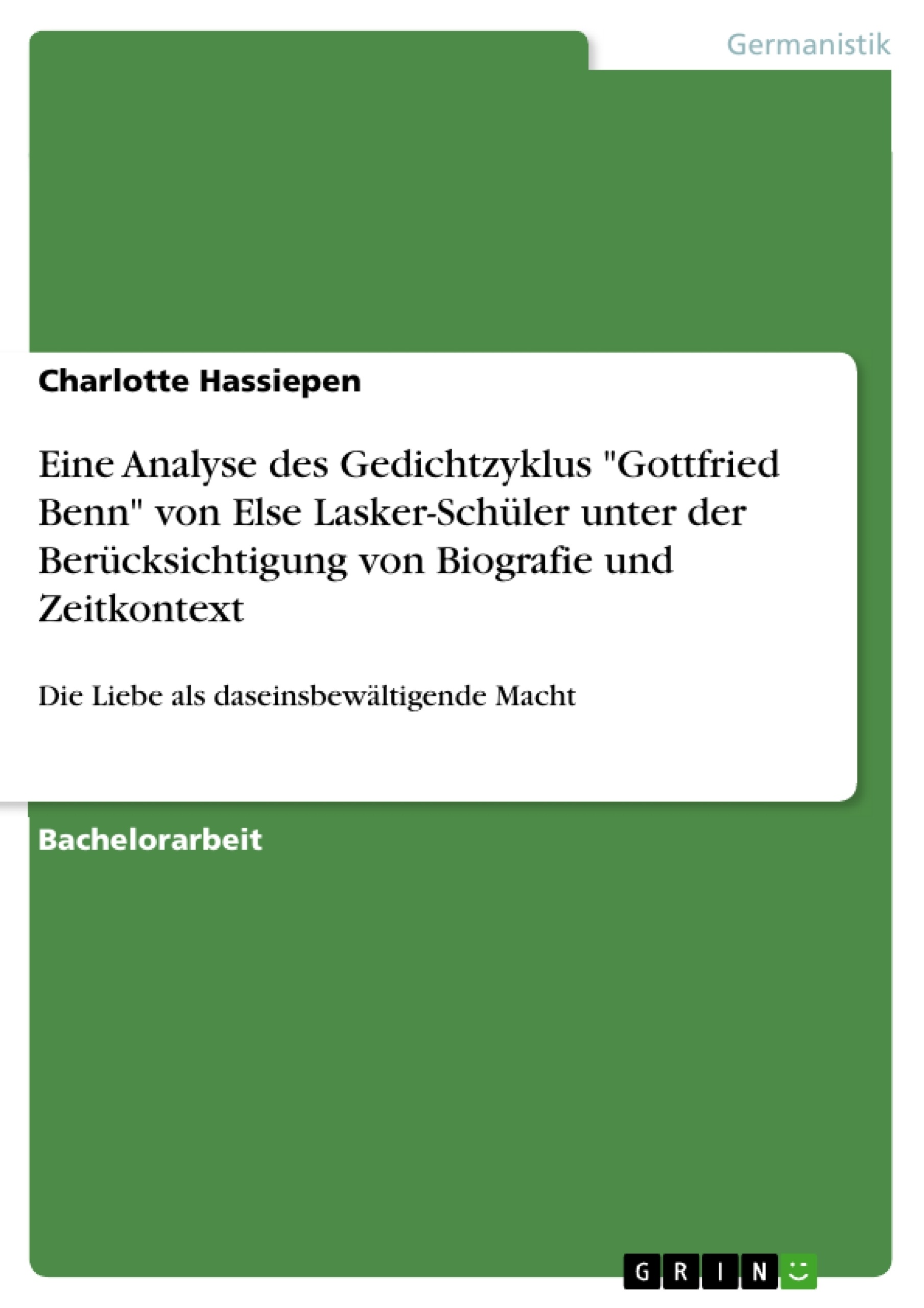"Ich bin in Theben (Ägypten) geboren, wenn ich auch in Elberfeld zur Welt kam im Rheinland. Ich ging bis 11 Jahre zur Schule, wurde Robinson, lebte fünf Jahre im Morgenlande, und seitdem vegetiere ich." In diesem Zitat der deutsch-jüdischen Lyrikerin Else Lasker-Schüler offenbart sich bereits die Problematik, die sich aus der Auseinandersetzung mit ihrem Leben und Werk ergibt. So tendiert sie dazu, Fakten über ihr Leben entweder gänzlich zu verschweigen oder sie in ihrem Werk und der vorgenommenen Selbstmystifizierung so stark zu poetisieren, dass die Frage nach einer Dokumentation der Realität erhebliche Schwierigkeiten aufwirft. Dieser enorme Drang nach Poetisierung und Mystifizierung ihres Lebens ist im Wesentlichen in dem Unvermögen begründet, sich in der Realität zurechtzufinden. Lediglich ihre grenzenlose Fantasie und die daraus resultierende Lyrik helfen Lasker-Schüler, den Alltag zu überstehen: „Ich sterbe am Leben und atme im Bilde wieder auf.“ Diese Tendenz konfrontiert jedoch einen jeden, der sich mit ihrem Werk auseinandersetzt, mit der Herausforderung eines nahezu grenzenlosen Übergangs zwischen Realität und Fiktion sowie Werk und Autorin.
Die vorherrschende Deutung der Forschung fokussiert sich überwiegend auf die autobiografischen Elemente ihres Werkes und interpretiert dieses als Spiegel ihres Lebens. Auch bei ihrem Gedichtzyklus Gottfried Benn, der im Zentrum dieser Arbeit steht, dominiert die Lesart, die 1917 erstmals veröffentlichten Gedichte als Dokumentation einer vermeintlichen Liebesbeziehung zwischen Lasker-Schüler und dem Dichter Gottfried Benn zu deuten. Obwohl die offenkundige Nennung Benns im Titel diese Deutung zunächst nahelegen mag, scheint mir die – in der Sekundärliteratur weniger vertretene – Vorgehensweise angemessener, verstärkt zwischen Werk und Biografie der Lasker-Schüler zu differenzieren und insbesondere bei Rückschlüssen von der Lyrik auf ihr Leben Vorsicht walten zu lassen. Dieser Ansatz sieht sich auch durch de Mans Aufsatz Autobiographie als Maskenspiel bestärkt: Ihm zufolge sei eine Unterscheidung zwischen Fiktion und Autobiografie „keine Frage von Entweder-Oder […], sondern unentscheidbar.“ Denn während jede Fiktion allein durch ihre Autorenschaft persönlich geprägt sei, gehe es in der Autobiografie umgekehrt wie bei jedem fiktionalen Buch „um das Geben und Nehmen von Gesichtern, um Maskierung und Demaskierung, Figur, Figuration und Defiguration.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Leben und Selbstmystifizierung der Lasker-Schüler
- Die Kindheit als verlorenes Paradies
- Abkehr vom bürgerlichen Leben
- Der ‚Spielgefährte‘ Gottfried Benn
- Mystische Welten: Die Lyrikerin in ihrem Verhältnis zur Religion
- Einbettung der Lyrik Lasker-Schülers im Zeitkontext
- Gattungsmerkmale und Lebensgefühl des Expressionismus
- Lasker-Schüler – eine expressionistische Lyrikerin?
- Das einseitige Gespräch des lyrischen Ichs mit dem lyrischen Du
- Überwindung der Einsamkeit und Verlorenheit
- „Der kühle Tag“: Ablehnung des irdischen Daseins
- Gegenwelt zur Realität: auf der Suche nach dem verlorenen Paradies
- Himmlische Bildbereiche als mystische Symbole
- Die Bedeutung der Farbmetaphorik
- Blau und Gold: die Farben des Himmlischen
- Schwarz und Weiß: die Farben der irdischen Welt
- ‚Bunt‘: die Farbe des lyrischen Ichs
- Rot: die Farbe des Lebens und der Liebe
- Die Liebe als Maske für die Gottessuche
- Daseinsbewältigung reflektiert in der Naturbeschreibung
- Das Spiel mit dem lyrischen Du als Daseinsüberwindung
- Das erotische Liebesspiel
- Kindliches Spiel als Eskapismus
- Die Liebe als daseinsbewältigende Macht? Die paradoxe Beziehung zum lyrischen Du
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Gedichtzyklus „Gottfried Benn“ von Else Lasker-Schüler und analysiert die Bedeutung der Liebe in diesem Werk. Das zentrale Ziel ist es, die Liebe als daseinsbewältigende Macht zu verstehen und die paradoxen Beziehungen zwischen dem lyrischen Ich und Du sowie zwischen Realität und Gegenwelt zu beleuchten.
- Die Liebe als Vehikel für die Bewältigung des irdischen Daseins
- Das Erstreben von Transzendenz durch die Macht der Liebe
- Die Bedeutung von Natur und Spiel für das lyrische Ich
- Die Rolle der Selbsterfindung und Maskierung in Lasker-Schülers Werk
- Die Verbindung von Liebe, Tod und Mystik in den Gedichten
Zusammenfassung der Kapitel
Der Gedichtzyklus „Gottfried Benn“ zeichnet das Bild eines lyrischen Ichs, das sich nach Liebe sehnt, um der trostlosen Realität zu entkommen. Die Gedichte sind geprägt von einer starken Sehnsucht nach Geborgenheit und einem verlorenen Paradies. Die Liebe dient als ein Mittel, um das irdische Dasein zu überwinden und sich in eine mystische Gegenwelt zu entgrenzen.
Die Gedichte thematisieren die Einsamkeit und Verlorenheit des Ichs, das in der Realität keinen Halt findet. Der „kühle Tag“ verkörpert die unerträgliche Leblosigkeit und Todessymbolik der Welt. Die Liebe zum lyrischen Du erscheint als Flucht in eine himmlische und göttliche Gegenwelt. Die Liebe wird zu einer Maske für die Suche nach Transzendenz und Gottesnähe. Die Natur und das Spiel mit dem Du dienen als Werkzeuge, um sich von der Realität zu befreien und in eine Welt voller Leben und Schönheit zu gelangen.
Trotz der Hoffnung auf Erlösung durch die Liebe, bleibt die Frage der Erfüllung offen. Das lyrische Ich sieht sich mit der Paradoxie konfrontiert, dass die Liebe als daseinsbewältigende Macht nur in der Fantasie existiert. Die Gedichte offenbaren die schmerzliche Unmöglichkeit einer dauerhaften Liebe und die damit verbundene Desillusionierung.
Der Gedichtzyklus bietet einen tiefgründigen Einblick in Lasker-Schülers Liebesverständnis und die Sehnsucht nach Transzendenz. Die Liebe fungiert als ein ständiges Suchen und Finden und zugleich als ein permanentes Verpassen und Scheitern. Die Gedichte hinterlassen einen melancholischen Eindruck, der gleichzeitig die unbezwingbare Kraft der Hoffnung und den unaufhaltsamen Drang nach Liebe und Geborgenheit widerspiegelt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieses Gedichtzyklus sind Liebe, Daseinsbewältigung, Transzendenz, Mystik, Realität, Gegenwelt, Natur, Spiel, Hoffnung, Desillusionierung. Der Text beleuchtet die komplexe Beziehung zwischen Liebe und Realität und stellt das Erstreben von Erfüllung und Glück in der Liebe gegenüber der unerbittlichen Konfrontation mit dem irdischen Dasein.
- Citar trabajo
- Charlotte Hassiepen (Autor), 2014, Eine Analyse des Gedichtzyklus "Gottfried Benn" von Else Lasker-Schüler unter der Berücksichtigung von Biografie und Zeitkontext, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351185