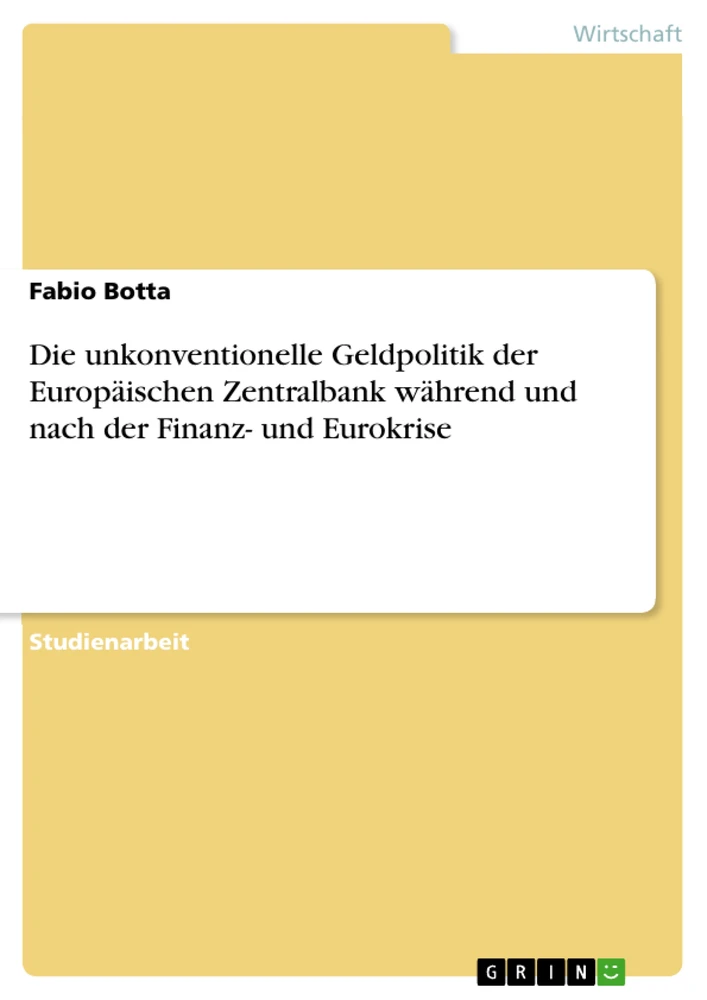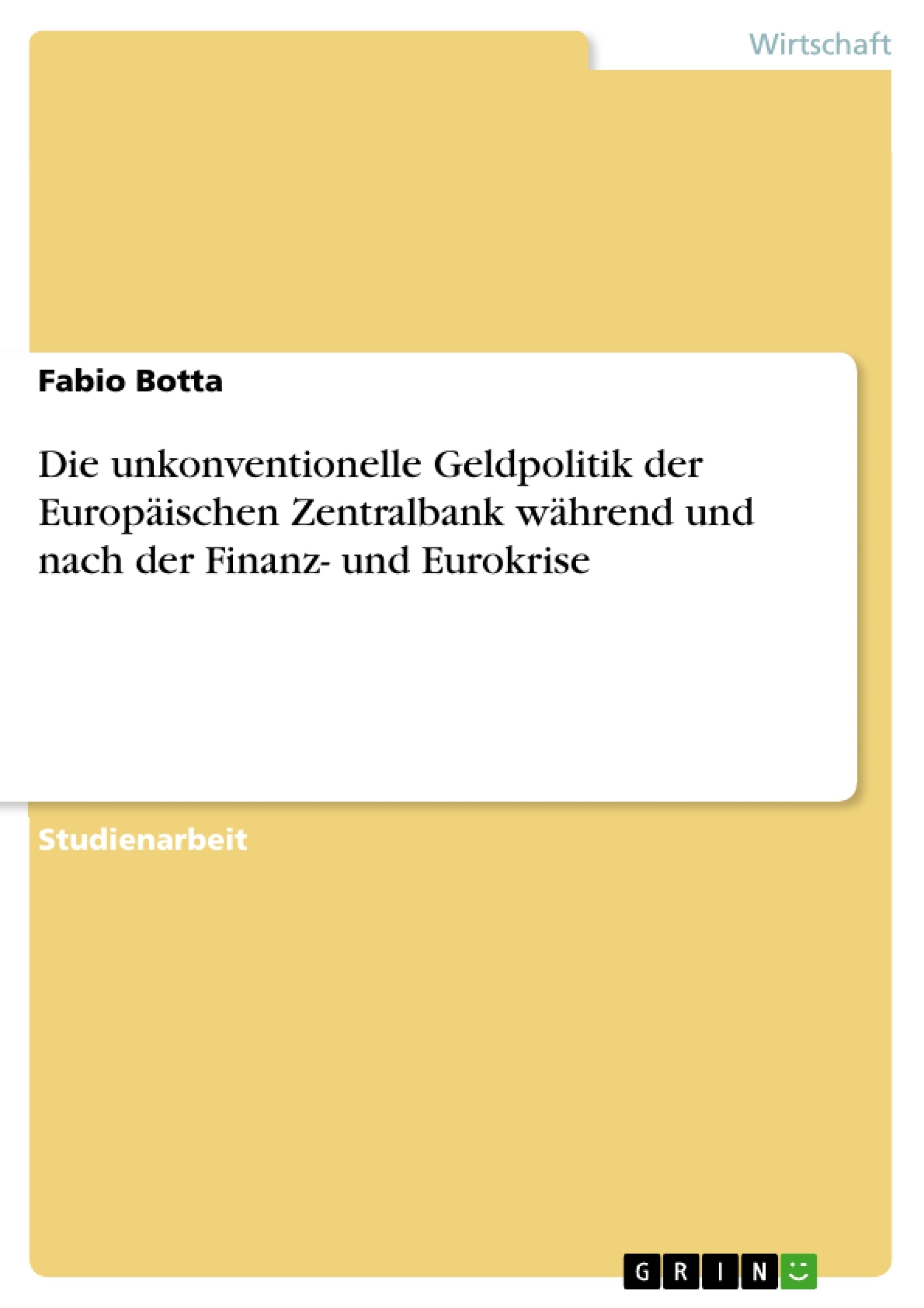Die Europäische Zentralbank (EZB) ergriff im Zuge der Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise diverse geldpolitische Maßnahmen. Hierzu gehörten auch ungewöhnliche geldpolitische Maßnahmen, die Gegenstand der vorliegenden Ausarbeitung sind.
Im Sommer 2007 hatte eine US-Immobilienkrise zu weltweiten Turbulenzen auf Finanz- und Bankenmärkten geführt. Spätestens nach Zusammenbruch der Investment Bank Lehman Brothers im September 2008 und dem fast nahtlosen Übergang der Weltwirtschaftskrise in die Eurokrise 2010 ergriff die EZB im Zuge der Krisenfolgen zunehmend sogenannte „unkonventionelle Maßnahmen“. In der öffentlichen Debatte um die Wirksamkeit der unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen gab es große Kontroversen. Während viele Experten auf internationaler Ebene die Vorgehensweise der EZB als unvermeidlich ansahen, rief die Geldpolitik der EZB auch vielfach Kritik – insbesondere aus Deutschland – hervor. Die vorliegende Arbeit befasst sich deshalb mit den unkonventionellen Maßnahmen im Einzelnen und in der Gesamtheit und zeigt die Erfolge und Risiken der angewandten Geldpolitik auf.
Nach einer allgemeinen Einführung in die Geldpolitik beschreibt die Arbeit die grundsätzliche Struktur der EZB und des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB). Dabei behandelt sie Aufgaben und Ziele, sowie die Instrumente der konventionellen Geldpolitik. Anschließend wird die konventionelle Geldpolitik in der Eurokrise mit einer kurzen Betrachtung ihrer beschränkten Wirksamkeit thematisiert. Schwerpunkt der Arbeit ist ein Überblick über Maßnahmen der unkonventionellen Geldpolitik sowie deren Erfolge und Risiken.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Einführung zur Geldpolitik: Konventionelle und unkonventionelle Geldpolitik
- 3 Die Europäische Zentralbank
- 3.1 Geldpolitische Ziele und Aufgaben des ESZB
- 3.2 Konventionelle Geldpolitik der EZB und ihre geldpolitischen Instrumente
- 3.2.1 Offenmarktgeschäfte
- 3.2.2 Ständige Fazilitäten
- 3.2.3 Mindestreserven
- 4 Konventionelle Geldpolitik der EZB in der Eurokrise und das (Nicht-)Funktionieren der Transmissionskanäle
- 4.1 Der Zinskanal
- 4.2 Der Bankkreditkanal
- 4.3 Grenzen Konventioneller Geldpolitik: Ein Zwischenfazit
- 5 Unkonventionelle Geldpolitik der EZB in der Eurokrise
- 6 Bewertung der unkonventionellen Geldpolitik der EZB
- 6.1 Erfolge
- 6.2 Kritik und Risiken unkonventioneller Maßnahmen
- 7 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die unkonventionelle Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) während und nach der Finanz- und Eurokrise. Ziel ist es, die angewandten Maßnahmen im Detail zu analysieren und deren Erfolge sowie Risiken zu bewerten. Die Arbeit beleuchtet die Kontroversen in der öffentlichen Debatte um die Wirksamkeit dieser Maßnahmen.
- Analyse der konventionellen und unkonventionellen Geldpolitik im Allgemeinen
- Beschreibung der Struktur und Aufgaben der EZB und des ESZB
- Bewertung der Wirksamkeit konventioneller Geldpolitik in der Eurokrise
- Detaillierte Untersuchung der unkonventionellen Maßnahmen der EZB
- Bewertung der Erfolge und Risiken der unkonventionellen Geldpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der unkonventionellen Geldpolitik der EZB während der Finanz- und Eurokrise ein. Sie beschreibt den Kontext der Krise, die Entstehung der unkonventionellen Maßnahmen und die Kontroversen um deren Wirksamkeit. Die Arbeit kündigt die Struktur und den Fokus der folgenden Kapitel an, die sich mit den Grundlagen der Geldpolitik, der Struktur der EZB, den konventionellen und schließlich den unkonventionellen Maßnahmen befassen.
2 Einführung zur Geldpolitik: Konventionelle und unkonventionelle Geldpolitik: Dieses Kapitel definiert Geldpolitik und unterscheidet zwischen konventioneller und unkonventioneller Geldpolitik. Konventionelle Geldpolitik konzentriert sich auf die Steuerung des Leitzinses zur Beeinflussung der Geldmenge und der Realwirtschaft. Unkonventionelle Maßnahmen werden als Reaktion auf Krisen und die Grenzen konventioneller Politik ergriffen, wenn beispielsweise der Leitzins bereits bei null liegt und die Transmissionsmechanismen gestört sind.
3 Die Europäische Zentralbank: Dieses Kapitel beschreibt die Struktur und die Aufgaben der Europäischen Zentralbank (EZB) und des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB). Es erläutert die geldpolitischen Ziele, insbesondere die Preisstabilität, und die Instrumente der konventionellen Geldpolitik, wie Offenmarktgeschäfte, ständige Fazilitäten und Mindestreserven. Die Unabhängigkeit der EZB und ihre Rolle im Eurosystem werden ebenfalls thematisiert.
4 Konventionelle Geldpolitik der EZB in der Eurokrise und das (Nicht-)Funktionieren der Transmissionskanäle: Dieses Kapitel analysiert die Anwendung konventioneller geldpolitischer Instrumente der EZB während der Eurokrise. Es untersucht die Effektivität der Transmissionskanäle (Zinskanal, Bankkreditkanal) und zeigt deren Limitationen auf. Die Ineffektivität traditioneller Maßnahmen aufgrund von Marktschwierigkeiten und der Notwendigkeit unkonventioneller Strategien wird deutlich herausgearbeitet. Das Kapitel legt den Grundstein für die anschließende Diskussion der unkonventionellen Maßnahmen.
5 Unkonventionelle Geldpolitik der EZB in der Eurokrise: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die verschiedenen unkonventionellen Maßnahmen, die die EZB während der Eurokrise ergriffen hat. Es beschreibt die spezifischen Instrumente und deren Zielsetzungen. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den einzelnen Maßnahmen und deren Begründung im Kontext der Krise steht im Vordergrund. Die Kapitel verdeutlicht, wie die EZB auf die außergewöhnlichen Umstände reagierte, um die Stabilität des Eurosystems zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Europäische Zentralbank (EZB), Europäisches System der Zentralbanken (ESZB), Geldpolitik, konventionelle Geldpolitik, unkonventionelle Geldpolitik, Leitzins, Transmissionsmechanismen, Eurokrise, Finanzkrise, Preisstabilität, Inflation, Deflation, Offenmarktgeschäfte, ständige Fazilitäten, Mindestreserven.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Unkonventionelle Geldpolitik der EZB in der Eurokrise
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die unkonventionelle Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) während und nach der Finanz- und Eurokrise. Sie untersucht detailliert die angewandten Maßnahmen, bewertet deren Erfolge und Risiken und beleuchtet die Kontroversen in der öffentlichen Debatte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Analyse der konventionellen und unkonventionellen Geldpolitik im Allgemeinen, eine Beschreibung der Struktur und Aufgaben der EZB und des ESZB, eine Bewertung der Wirksamkeit konventioneller Geldpolitik in der Eurokrise, eine detaillierte Untersuchung der unkonventionellen Maßnahmen der EZB und eine abschließende Bewertung der Erfolge und Risiken dieser Maßnahmen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein. Kapitel 2 erklärt konventionelle und unkonventionelle Geldpolitik. Kapitel 3 beschreibt die EZB und das ESZB. Kapitel 4 analysiert die konventionelle Geldpolitik der EZB in der Eurokrise und das Funktionieren der Transmissionskanäle. Kapitel 5 behandelt die unkonventionellen Maßnahmen der EZB. Kapitel 6 bewertet die unkonventionelle Geldpolitik, und Kapitel 7 bietet ein Fazit und Ausblick.
Welche konventionellen geldpolitischen Instrumente der EZB werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Offenmarktgeschäfte, ständige Fazilitäten und Mindestreserven als konventionelle geldpolitische Instrumente der EZB.
Welche Transmissionskanäle werden im Kontext der Eurokrise untersucht?
Die Arbeit untersucht den Zinskanal und den Bankkreditkanal als Transmissionskanäle der Geldpolitik in der Eurokrise.
Welche unkonventionellen Maßnahmen der EZB werden analysiert?
Die Arbeit gibt einen Überblick über die verschiedenen unkonventionellen Maßnahmen der EZB während der Eurokrise, ohne die konkreten Maßnahmen explizit zu nennen. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den einzelnen Maßnahmen findet im entsprechenden Kapitel statt.
Welche Erfolge und Risiken der unkonventionellen Geldpolitik werden diskutiert?
Die Arbeit bewertet sowohl die Erfolge als auch die Risiken der unkonventionellen Geldpolitik der EZB. Sowohl positive Aspekte als auch Kritikpunkte und potenzielle Gefahren werden beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Europäische Zentralbank (EZB), Europäisches System der Zentralbanken (ESZB), Geldpolitik, konventionelle Geldpolitik, unkonventionelle Geldpolitik, Leitzins, Transmissionsmechanismen, Eurokrise, Finanzkrise, Preisstabilität, Inflation, Deflation, Offenmarktgeschäfte, ständige Fazilitäten, Mindestreserven.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht, insbesondere für Leser, die sich für Geldpolitik, die EZB und die Eurokrise interessieren. Sie dient der Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise.
- Citation du texte
- Fabio Botta (Auteur), 2016, Die unkonventionelle Geldpolitik der Europäischen Zentralbank während und nach der Finanz- und Eurokrise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350889