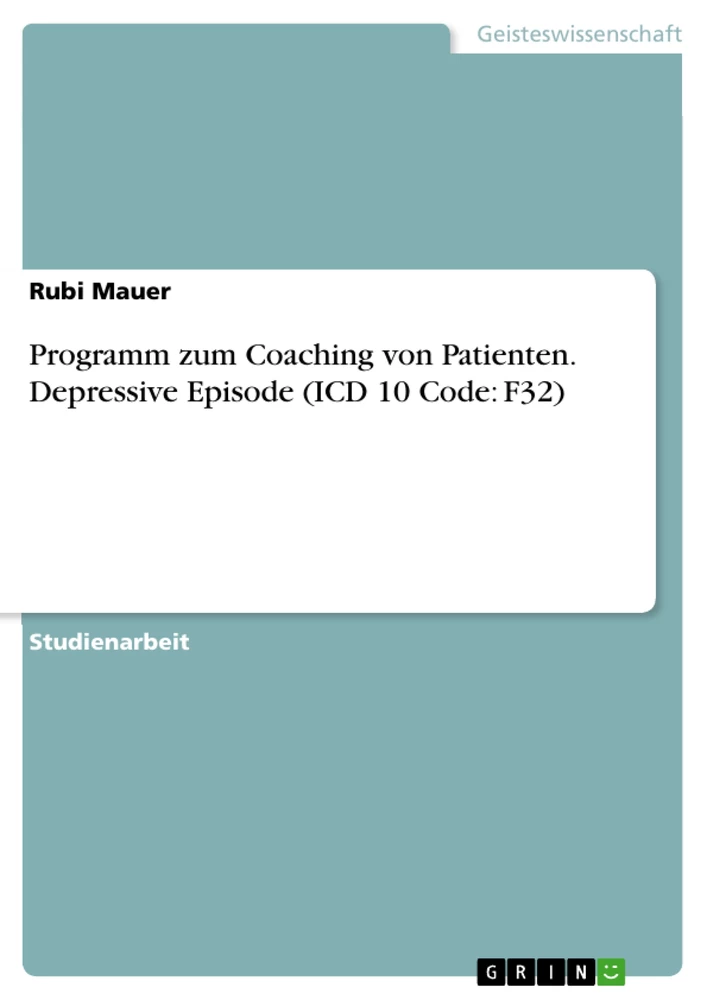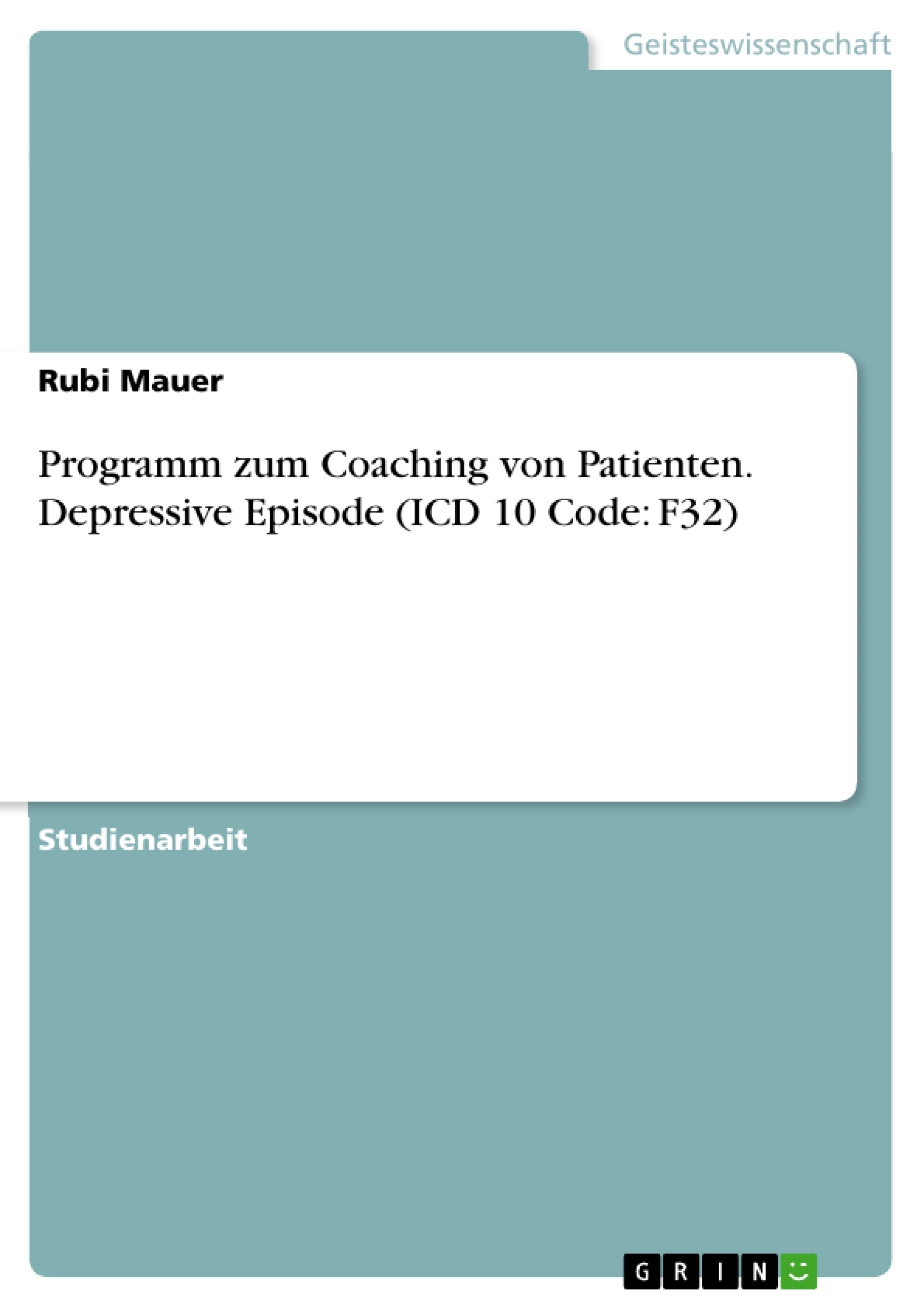In dieser Hausarbeit wird ein Konzept für ein Programm zum Coaching von Patienten am Beispiel der Erkrankung Depressive Episode (ICD10 Code: F32) entwickelt.
Dafür wird die Depression als Erkrankung erst einmal im Sinne einer medizinischen Grundlage für ein Coaching mit ihren Symptomen und Schweregraden beschrieben. Die Häufigkeit des Auftretens wird untersucht, wobei zwischen der Prävalenzrate und der Inzidenzrate unterschieden wird. Wichtig ist die wirtschaftliche Sicht auf den Einsatz von Mitteln der Solidargemeinschaft für Maßnahmen innerhalb eines Patientencoachings, sofern es von der Krankenkasse finanziert wird. Private Unternehmen, welche von Krankenkassen eingekauft werden, streben das Formalziel der Wirtschaftlichkeit ebenfalls an. Die finanzielle Sinnhaftigkeit, ein solches Konzept zu entwerfen, muss im Vorfeld geklärt werden. Deshalb widmet sich den Fehltagen durch Arbeitsunfähigkeit ein gesonderter Abschnitt des ersten Teils der vorliegenden Arbeit. Unter anderem anhand dieser Daten lässt sich ein Einsparungspotential durch Verhinderung eben dieser Fehltage berechnen. Im Konzept selbst finden sich die Einkreisung der Zielgruppe, die rechtlichen Grundlagen und auch Erläuterungen zum Datenschutz. Der Finanzierungsaspekt muss aus Platzgründen eher kurz gehalten werden, findet aber als fester Bestandteil eines solchen Programms Erwähnung.
Dafür bekommen die Teilnehmeridentifikation und Einschreibung mehr Raum, da dieses Thema doch sehr komplex ist. Hierbei und auch beim nächsten Punkt, den Kennzahlen und der Evaluation, wurde versucht möglichst vollständig, aber nicht ausschweifend zu beschreiben, wie die Schritte der Identifikation und Einschreibung ablaufen. Es wird klar argumentiert, warum diese Kennzahlen gewählt wurden. Die Entscheidung fiel auf die Einschreibequote als quantitativen Aspekt und auf die Teilnehmerzufriedenheit als qualitativen Aspekt. Im Anschluss wurden drei typische Interventionsformen eines Patientencoachings ausgewählt und zur besseren Anschaulichkeit an bereits bestehenden Beispielen aus der Praxis beschrieben. Der Patientencoach arbeitet nicht ganz für sich allein, sondern unterhält Kontakte zu anderen Akteuren des Gesundheitswesens. Als Schnittstellen findet der Leser beispielhaft den Arzt, die Krankenkasse und zusätzlich, als neue und interessante Schnittstelle, die Apotheke.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Depression
- 2.1 Depressive Episode
- 2.2 Depressive Episoden und Fehltage
- 3 Konzept für ein Patientencoaching
- 3.1 Rechtliche Grundlagen
- 3.2 Datenschutz
- 3.3 Finanzierung
- 3.4 Teilnehmeridentifikation und Einschreibung
- 3.5 Zwei Kennzahlen und Evaluation
- 3.6 Drei Interventionsformen
- 3.6.1 Laufende telefonische Betreuung
- 3.6.2 Online Projekt mit integriertem Diskussionsforum
- 3.6.3 Online-Unterstützungsprogramm als Selbsthilfe
- 4 Zwei Schnittstellen in andere Sektoren
- 5 Patientencoaching/Fallmanagement
- 6 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit entwickelt ein Coaching-Programm für Patienten mit depressiven Episoden (F32 nach ICD-10). Ziel ist die Beschreibung eines umfassenden Konzepts, welches rechtliche, datenschutzrechtliche und finanzielle Aspekte berücksichtigt. Die Arbeit evaluiert verschiedene Interventionsformen und zeigt mögliche Schnittstellen zu anderen Sektoren auf.
- Entwicklung eines Patientencoaching-Programms für depressive Episoden
- Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen des Coachings
- Verschiedene Interventionsstrategien im Coaching
- Integration des Programms in bestehende Gesundheitssysteme
- Evaluierung des Coaching-Programms
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der depressiven Erkrankung und in die Notwendigkeit eines patientenzentrierten Coaching-Programms ein. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die Forschungsfragen.
2 Depression: Dieses Kapitel beschreibt die depressive Episode (F32) nach ICD-10 und beleuchtet den Zusammenhang zwischen depressiven Episoden und Fehlzeiten am Arbeitsplatz. Es liefert eine fundierte Basis für das Verständnis der Erkrankung und deren Auswirkungen auf das berufliche und private Leben Betroffener. Die Darstellung der Krankheitsbilder dient als Grundlage für die Entwicklung des späteren Coaching-Konzepts.
3 Konzept für ein Patientencoaching: Dieser zentrale Abschnitt präsentiert ein detailliertes Konzept für ein Patientencoaching-Programm. Es werden die rechtlichen Grundlagen, Datenschutzbestimmungen und Finanzierungsmodelle erläutert. Die Teilnehmeridentifikation und -einschreibung, Evaluationsmethoden und drei verschiedene Interventionsformen (telefonische Betreuung, Online-Projekt mit Forum, Online-Selbsthilfe-Programm) werden ausführlich beschrieben und deren jeweilige Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen. Das Kapitel bildet den Kern der Arbeit und präsentiert das neu entwickelte Coaching-Konzept.
4 Zwei Schnittstellen in andere Sektoren: Hier werden die Schnittstellen des Coaching-Programms zu anderen Bereichen des Gesundheitssystems aufgezeigt, um die Integration und den Erfolg des Programms zu fördern. Es geht um die Vernetzung und den Informationsaustausch mit anderen Akteuren im Gesundheitswesen.
5 Patientencoaching/Fallmanagement: Dieses Kapitel vergleicht das entwickelte Patientencoaching-Konzept mit dem Case Management und hebt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Ansätze hervor. Die Analyse dient dazu, die spezifischen Vorteile und die Positionierung des Coaching-Programms im Kontext anderer Interventionsmethoden zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Depressive Episode, ICD-10, F32, Patientencoaching, Coaching-Konzept, Interventionsformen, Online-Intervention, Telefonische Betreuung, Selbsthilfe, Datenschutz, Rechtliche Grundlagen, Finanzierung, Evaluation, Gesundheitssystem, Fallmanagement, Fehltage, Arbeitsunfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Patientencoaching bei depressiven Episoden
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit entwickelt ein umfassendes Coaching-Programm für Patienten mit depressiven Episoden (F32 nach ICD-10). Der Fokus liegt auf der Beschreibung eines Konzepts, das rechtliche, datenschutzrechtliche und finanzielle Aspekte berücksichtigt und verschiedene Interventionsformen evaluiert. Zusätzlich werden mögliche Schnittstellen zu anderen Sektoren des Gesundheitssystems beleuchtet.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein praxistaugliches Patientencoaching-Programm für depressive Episoden zu entwickeln und zu beschreiben. Dies beinhaltet die Definition der rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen, die Vorstellung verschiedener Interventionsstrategien, die Integration des Programms in bestehende Gesundheitssysteme und die Evaluierung seiner Wirksamkeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein; Kapitel 2 (Depression) beschreibt die depressive Episode (F32) nach ICD-10 und deren Auswirkungen; Kapitel 3 (Konzept für ein Patientencoaching) präsentiert das detaillierte Coaching-Konzept inklusive rechtlicher Grundlagen, Datenschutz, Finanzierung, Interventionsformen (telefonische Betreuung, Online-Projekt mit Forum, Online-Selbsthilfe-Programm) und Evaluation; Kapitel 4 (Schnittstellen zu anderen Sektoren) zeigt die Integration in das Gesundheitssystem auf; Kapitel 5 (Patientencoaching/Fallmanagement) vergleicht das Konzept mit Case Management; und Kapitel 6 (Fazit und Ausblick) fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche Interventionsformen werden im Coaching-Konzept vorgestellt?
Das Konzept umfasst drei Interventionsformen: laufende telefonische Betreuung, ein Online-Projekt mit integriertem Diskussionsforum und ein Online-Unterstützungsprogramm als Selbsthilfe. Die Vor- und Nachteile jeder Form werden gegeneinander abgewogen.
Welche rechtlichen und ethischen Aspekte werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt ausführlich die rechtlichen Grundlagen, insbesondere Datenschutzbestimmungen, die für ein solches Coaching-Programm relevant sind. Ethische Aspekte werden im Kontext des Datenschutzes und der Teilnehmerrechte behandelt.
Wie wird das Coaching-Konzept evaluiert?
Die Arbeit beschreibt Methoden zur Evaluation des Coaching-Programms. Konkrete Kennzahlen und Evaluationsstrategien werden im Kapitel zum Coaching-Konzept vorgestellt.
Wie wird das Coaching-Konzept in bestehende Gesundheitssysteme integriert?
Das Kapitel zu den Schnittstellen in andere Sektoren beschreibt Möglichkeiten der Integration des Coaching-Programms in das bestehende Gesundheitssystem. Es geht um die Vernetzung und den Informationsaustausch mit anderen Akteuren im Gesundheitswesen.
Wie unterscheidet sich das Patientencoaching von Fallmanagement?
Die Arbeit vergleicht das entwickelte Patientencoaching-Konzept mit dem Case Management und hebt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Ansätze hervor. Dies verdeutlicht die spezifischen Vorteile und die Positionierung des Coaching-Programms im Kontext anderer Interventionsmethoden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Depressive Episode, ICD-10, F32, Patientencoaching, Coaching-Konzept, Interventionsformen, Online-Intervention, Telefonische Betreuung, Selbsthilfe, Datenschutz, Rechtliche Grundlagen, Finanzierung, Evaluation, Gesundheitssystem, Fallmanagement, Fehltage, Arbeitsunfähigkeit.
- Quote paper
- Rubi Mauer (Author), 2016, Programm zum Coaching von Patienten. Depressive Episode (ICD 10 Code: F32), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350878