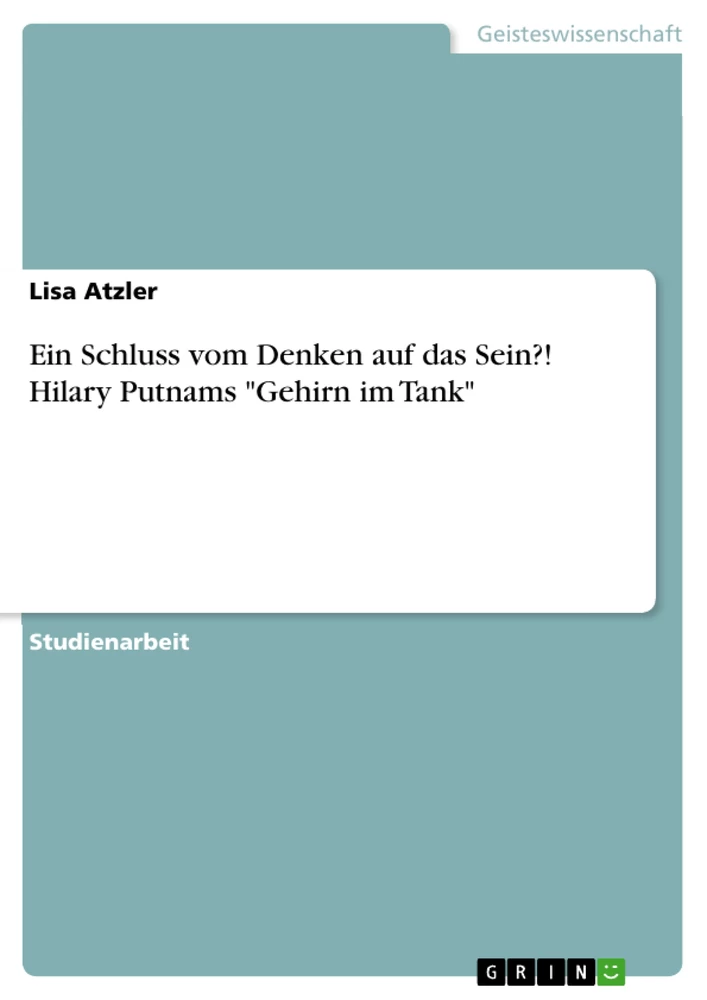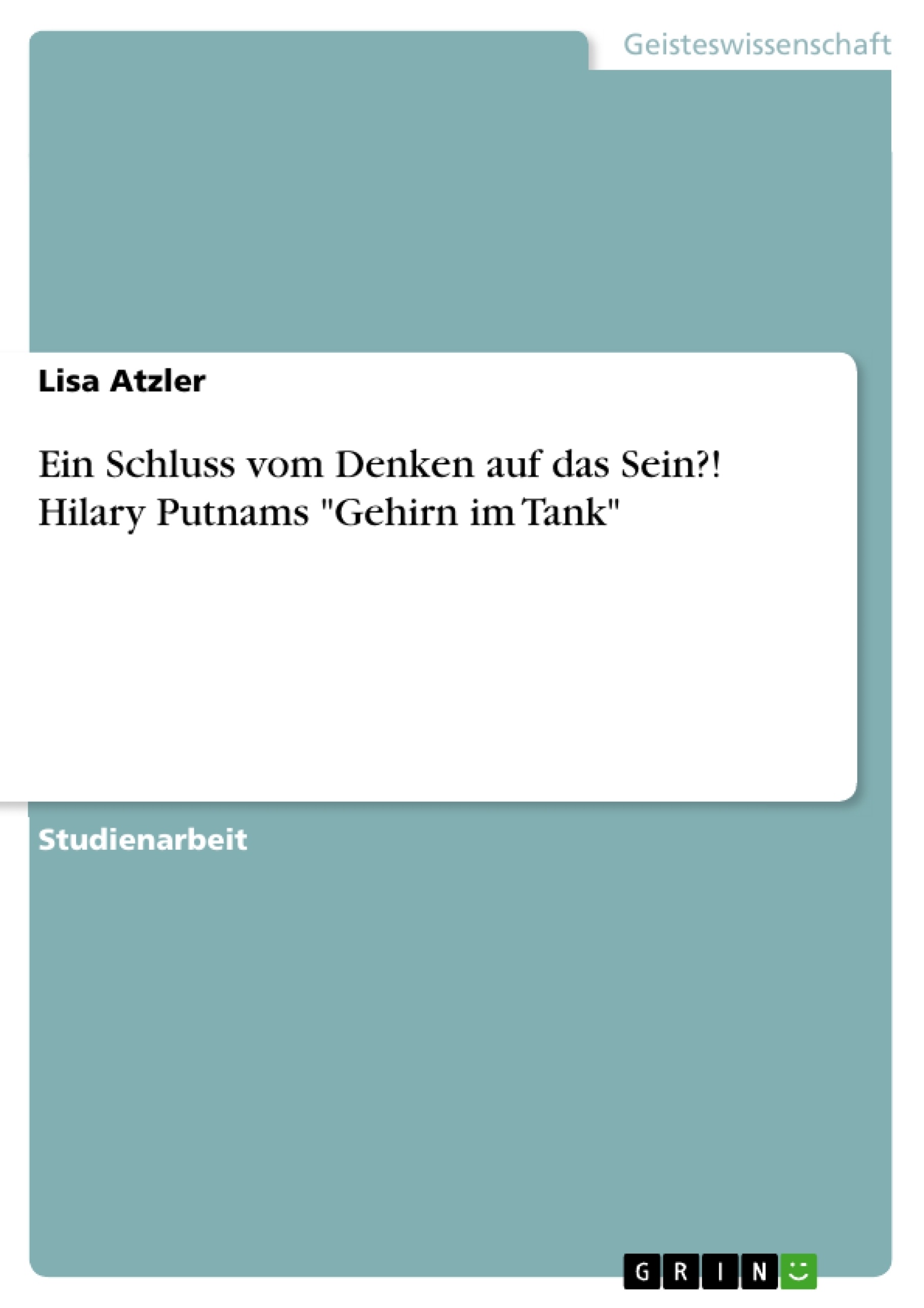Inwiefern ist Hilary Putnams sprachphilosophischer Einwand dem Solipsismus des Gehirne-im-Tank-Gedankenexperiments gewachsen - kurz: Stecken wir in der Matrix oder nicht?
„Wer recht erkennen will, muss zuvor in richtiger Weise gezweifelt haben.“ Dieses Zitat, das Aristoteles nachgesagt wird, betont den Wert des Zweifels für die Erkenntnis. Der Zweifel ist demnach nicht seiner selbst wegen sinnvoll, sondern vielmehr aufgrund seines Mitwirkens im Erkenntnisprozess. Skeptiker zweifeln nicht an unserer Wahrnehmung oder unserer Erkenntnisfähigkeit, um diese tatsächlich grundsätzlich zu verneinen, sie nutzen die Skepsis als epistemologische Methode, um Altbekanntes erneut zur Diskussion zu stellen und somit neues Wissen oder neue Perspektiven zu generieren. Dieses Vorgehen trägt der griechischen Übersetzung – ,sképsisʻ als „Betrachtung, Untersuchung, Prüfung“ – Rechnung, die allein den Moment der berechtigten, kritischen Nachfrage in sich trägt.
In diese Tradition der methodischen Skepsis reihen sich u.a. René Descartes und Hilary Putnam ein, deren Vorgehen ich im Folgenden betrachten möchte. Die Vorstellung Descartes soll hierbei jedoch eher als Ausgangspunkt für Putnams Gedankenexperiment 'Gehirn im Tank' (GiT) dienen, das in dieser Arbeit ausführlich besprochen werden soll. Hierfür möchte ich eine kurze Einordnung des GiT in die philosophische Debatte vornehmen, um anschließend das argumentative Vorgehen Putnams genauer darzulegen. Es folgen aus der Literatur entnommene und eigene Kritikpunkte an Putnams Konsequenzen.
Inhaltsverzeichnis
- Versuch der Einordnung des GiT
- Von Descartes zum Außenweltskeptizismus
- Monismus und der Wandel der Fragestellung in der Philosophie des Geistes
- Das Gehirn im Tank
- Voraussetzungen: Zwillingserde
- Vorgehen
- Konsequenzen
- Einwände gegen und Kritik an Putnams Konsequenzen aus dem GiT
- Einwände gegen die Grundlage, den semantischen Externalismus
- Einwände gegen das Schlussverfahren
- Kritik an der Reichweite des Arguments
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, Putnams Gedankenexperiment „Gehirn im Tank“ (GiT) zu analysieren und dessen Bedeutung für die philosophische Debatte um Realismus, Skeptizismus und das Verhältnis von Geist und Körper zu beleuchten.
- Das Gedankenexperiment des GiT
- Der semantische Externalismus und seine Rolle in Putnams Argumentation
- Die Kritik an Putnams Schlussverfahren und dessen Reichweite
- Die Auswirkungen des GiT auf die Frage nach der Existenz einer Außenwelt
- Die Relevanz des GiT für die Philosophie des Geistes
Zusammenfassung der Kapitel
-
Versuch der Einordnung des GiT
Dieses Kapitel führt in das Gedankenexperiment „Gehirn im Tank“ (GiT) ein und ordnet es in die philosophische Debatte um Realismus, Skeptizismus und das Verhältnis von Geist und Körper ein. Es werden zentrale Begriffe wie Realismus, Internalismus/Externalismus, Geist und Körper erläutert.
-
Das Gehirn im Tank
Dieses Kapitel erläutert die Voraussetzungen, das Vorgehen und die Konsequenzen des GiT. Es beleuchtet die Frage, ob es möglich ist, dass wir uns in einem simulierten Umfeld befinden und unser vermeintliches Wissen über die Realität getäuscht ist.
-
Einwände gegen und Kritik an Putnams Konsequenzen aus dem GiT
Dieses Kapitel diskutiert die Einwände gegen Putnams Argumentation und analysiert die Kritik an den Konsequenzen, die aus dem GiT gezogen werden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Gehirn im Tank, Realismus, Skeptizismus, semantischer Externalismus, Körper/Geist-Problem, Philosophie des Geistes, Gedankenexperiment, Außenweltskeptizismus, Simulation.
- Quote paper
- Lisa Atzler (Author), 2011, Ein Schluss vom Denken auf das Sein?! Hilary Putnams "Gehirn im Tank", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350720