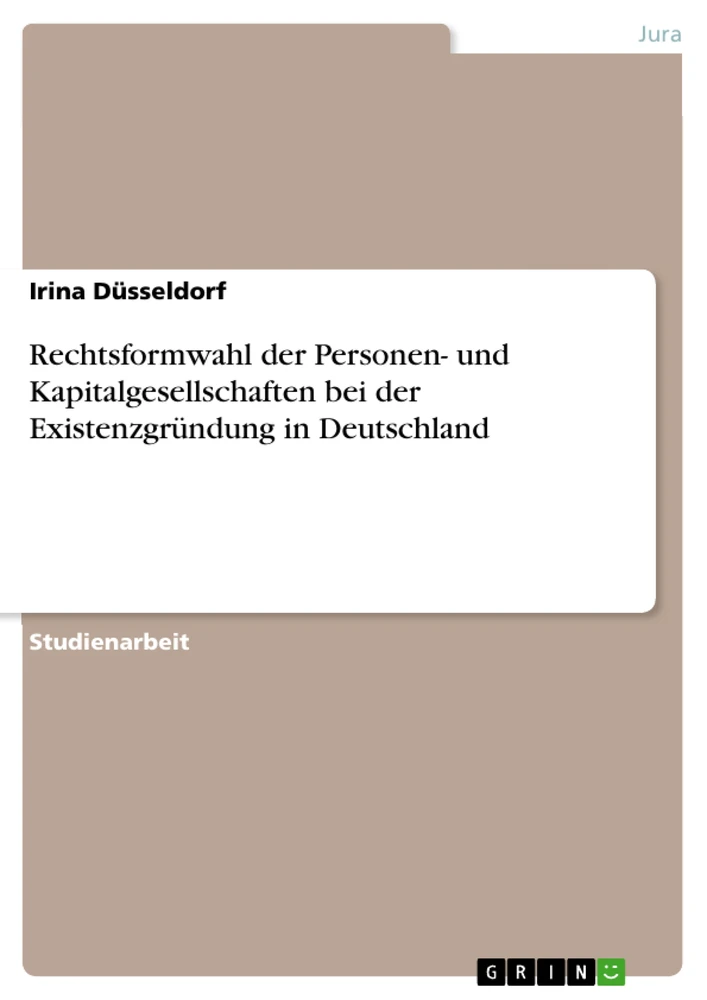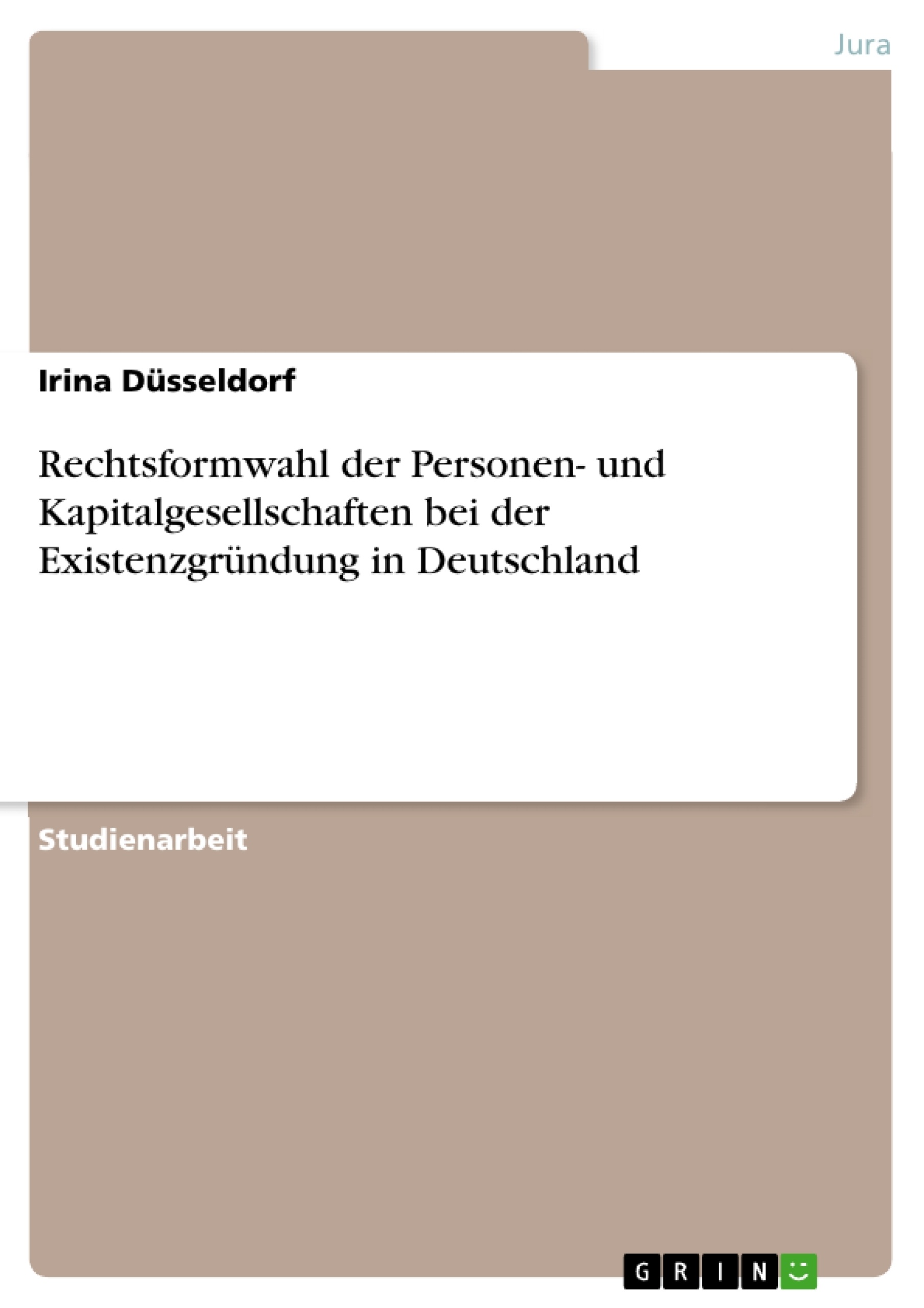Im Rahmen dieser Arbeit werden privatwirtschaftlich organisierte Gesellschaftsformen bei originären Gründungen mit Gewinnerzielungs- und Wachstumsabsicht beschrieben, Derivate Gründungen, wie beispielsweise die Unternehmensübernahme, der Einstieg in ein bereits bestehendes Unternehmen in Form einer Beteiligung oder Partnerschaft und Franchising, werden im Rahmen dieser Arbeit nicht analysiert.
Das Existenzgründungsgeschehen spielt für die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland eine große Rolle. Neugründungen bringen Innovationen hervor, schaffen Arbeitsplätze und fördern so den Wettbewerbsgedanken. Es gibt unzählige Motivationsgründe für eine Existenzgründung: Die meisten Deutschen gründen, weil sie eine Geschäftsidee realisieren wollen, andere aufgrund fehlender Erwerbsalternativen. Für eine erfolgreiche Gründung sollte man unbedingt fachliche und persönliche Motivationen mitbringen.
Wichtig für die erfolgreiche Gründung ist auch die Wahl des passenden Gründungstandorts. Laut dem Länderbericht Deutschland 2014 des Global Entrepreneurship Monitors (GEM) sind viele Rahmenbedingungen für Gründer in der BRD ausgesprochen gut. Besondere Stärken liegen vor allem in einer guten physischen Infrastruktur, öffentlichen Förderprogrammen und dem Schutz von geistigem Eigentum, z.B. Patente.
Bereits in der Anfangsphase der Gründung einer Gesellschaft bedarf es einer genauen Analyse der Gesellschaftsrechtsformen. Viele Existenzgründer scheitern nämlich genau daran: Sie wählen die falsche Rechtsform. In dieser Arbeit sollen dafür die Vor- und Nachteile der einzelnen Gesellschaftsrechtsformen aufgezeigt werden, um bei der Wahl der Rechtsform die richtige Entscheidung treffen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE EXISTENZGRÜNDUNGSPHASE
- DIE FORMEN
- DIE GRÜNDER
- DER BUSINESSPLAN
- DIE RECHTSFORMEN PRIVATER BETRIEBE
- DIE PERSONENGESELLSCHAFTEN
- OHG
- KG
- DIE KAPITALGESELLSCHAFTEN
- GmbH/UGgGmbH und gUG
- GmbH & Co. KG
- (kleine) AG
- DIE PERSONENGESELLSCHAFTEN
- DIE VOR- UND NACHTEILE DER GESELLSCHAFTSRECHTSFORMEN BEI DER EXISTENZGRÜNDUNG
- DIE PERSONENGESELLSCHAFTEN BEI DER EXISTENZGRÜNDUNG
- DIE KAPITALGESELLSCHAFTEN BEI DER EXISTENZGRÜNDUNG
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Wahl der Rechtsform für Personen- und Kapitalgesellschaften bei der Existenzgründung in Deutschland. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Gesellschaftsrechtsformen aufzuzeigen und somit eine fundierte Entscheidungshilfe für Gründer zu bieten.
- Analyse der verschiedenen Rechtsformen für Personen- und Kapitalgesellschaften
- Bewertung der Vor- und Nachteile der jeweiligen Rechtsformen im Kontext der Existenzgründung
- Bedeutung der Rechtsformwahl für die Gründungsphase und die spätere Entwicklung des Unternehmens
- Sicht auf die relevanten Aspekte für die Rechtsformwahl, wie z.B. Haftung, Kapitalbedarf, Steuerbelastung, Unternehmensführung und -kontrolle
- Praxisbezogene Betrachtung der Rechtsformwahl im deutschen Gründungslandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Existenzgründung in Deutschland ein und beleuchtet die Bedeutung der Rechtsformwahl für den Gründungserfolg. Das zweite Kapitel beschreibt die verschiedenen Phasen der Existenzgründung und beleuchtet insbesondere die Bedeutung der Wahl der richtigen Rechtsform. Im dritten Kapitel werden die verschiedenen Rechtsformen privater Betriebe im Detail vorgestellt und erläutert. Hierbei werden sowohl Personen- als auch Kapitalgesellschaften betrachtet. Das vierte Kapitel befasst sich mit den Vor- und Nachteilen der jeweiligen Rechtsformen im Hinblick auf die Existenzgründung.
Schlüsselwörter
Existenzgründung, Rechtsformwahl, Personen- und Kapitalgesellschaften, OHG, KG, GmbH, UG, AG, Haftung, Kapitalbedarf, Steuerbelastung, Unternehmensführung, Gründungsphase, Gründungserfolg.
- Quote paper
- Irina Düsseldorf (Author), 2016, Rechtsformwahl der Personen- und Kapitalgesellschaften bei der Existenzgründung in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350011