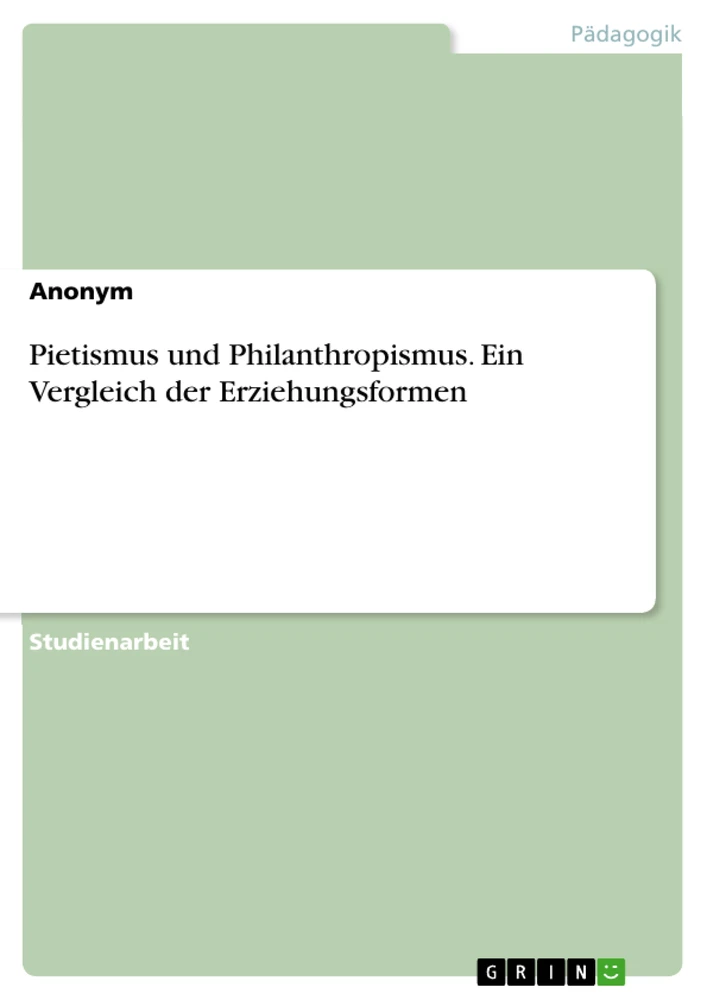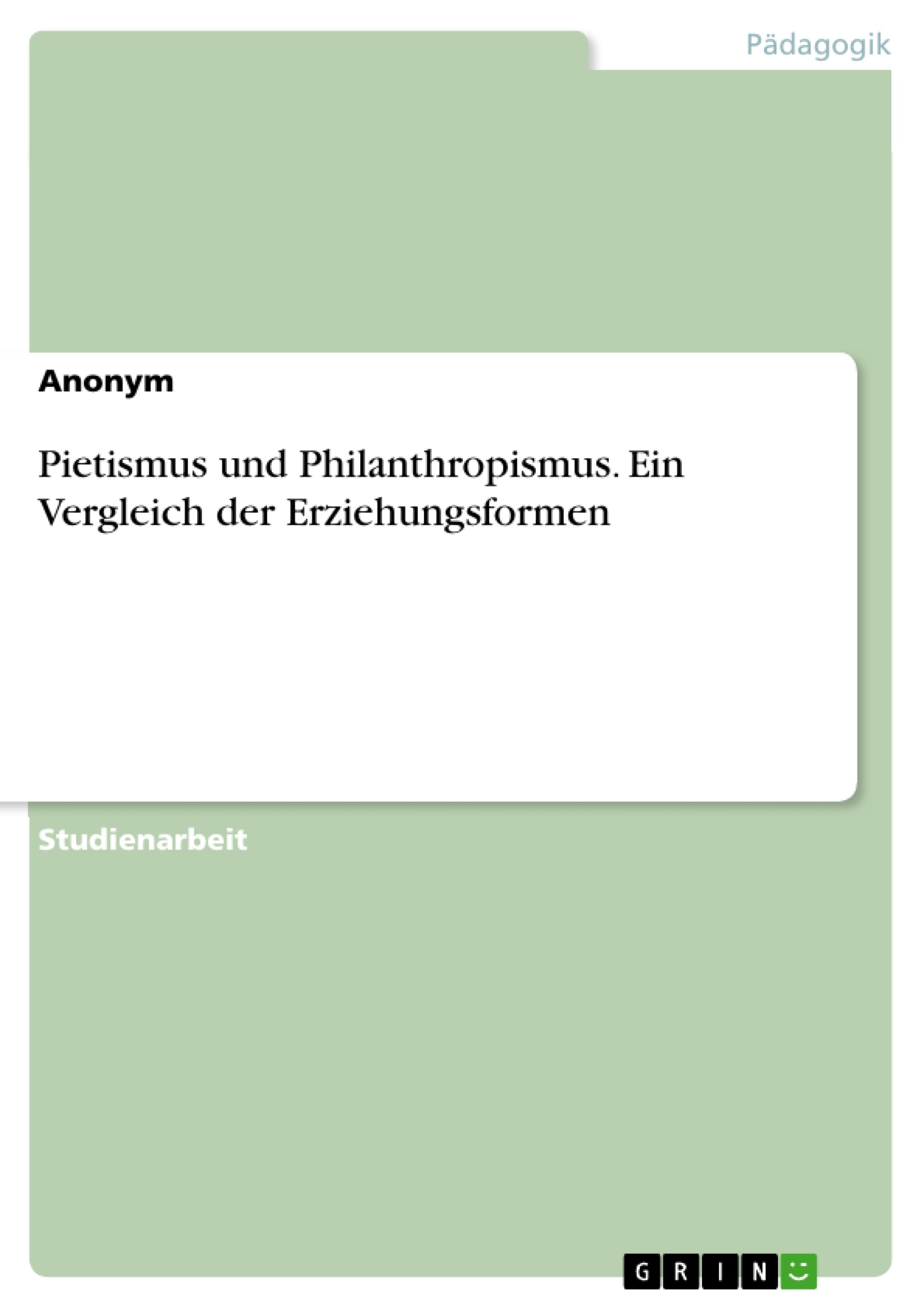In der vorliegenden Arbeit wird genauer auf die beiden Erziehungsformen Philantropismus und Pietismus eingegangen. Anschließend beschäftigen wir uns mit der Frage, was die wesentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Pietismus und Philanthropismus sind. Worin lagen die Gründe dafür, dass sich aus dem Pietismus der Philanthropismus entwickeln musste? Findet man heute noch Spuren von diesen Erziehungsformen?
In Europa wurden im siebzehnten Jahrhundert mehr als 20 Kriege geführt. Für den deutschen Protestantismus lag der traurige Höhepunkt im Dreißigjährigen Krieg, in dem das Volk vernichtende Niederlagen erleiden musste. Das Grauen der Kriegsverwüstungen zwang viele, aus Elend und Hunger, in eine andere Stadt zu fliehen. In dieser schrecklichen Zeit wuchs der junge Philipp Jakob Spener, der später einer der bekanntesten Vertreter des Pietismus werden sollte, in einer von Flüchtlingen bevölkerten Stadt auf und musste all das Elend als tiefgehende Erfahrung seiner Generation ansehen. Nach diesen Ereignissen entwickelte sich in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts der Pietismus in Deutschland. Im nahezu parallelen Aufbruch der neuen Frömmigkeitsbewegung in England, den Niederlanden und Deutschland wird erst die Dimension des Phänomens Pietismus sichtbar. In der pädagogischen Geschichte wurde der Pietismus, der religiöse Wurzeln hat, bisher nicht eindeutig eingeordnet. Es ist noch unklar, ob man den Pietismus der Aufklärungsepoche schlicht ein- oder unterordnet. Im Gegensatz dazu lässt sich der Philanthropismus eindeutig der Zeit der Aufklärung zuordnen. Er löste den Pietismus gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts ab und machte sich frei von religiösen Deutungen. Er wird als die Lehre von der Erziehung zur Natürlichkeit und Vernunft bezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erziehungsformen
- Pietismus
- Philanthropismus
- Fazit: Vergleich zwischen Pietismus und Philanthropismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die Erziehungsformen des Pietismus und des Philanthropismus. Ziel ist es, die wesentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Ansätze herauszuarbeiten und die Gründe für die Entwicklung des Philanthropismus aus dem Pietismus zu beleuchten. Die Arbeit untersucht auch, ob heutige Spuren dieser Erziehungsformen nachweisbar sind.
- Vergleich der Erziehungsziele von Pietismus und Philanthropismus
- Analyse der Unterschiede in den Methoden der Erziehung
- Untersuchung der religiösen und weltanschaulichen Grundlagen beider Erziehungsformen
- Bewertung des Einflusses beider Erziehungsformen auf die Gesellschaft
- Relevanz des Pietismus und Philanthropismus für die heutige Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den historischen Kontext des Pietismus und des Philanthropismus dar, beginnend mit den Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges auf die deutsche Gesellschaft und den Aufstieg des Pietismus als Reaktion auf die damaligen gesellschaftlichen und religiösen Zustände. Sie hebt den Unterschied zwischen dem religiös geprägten Pietismus und dem säkularen Philanthropismus hervor und skizziert die Forschungsfragen der Arbeit.
Erziehungsformen: Dieses Kapitel unterteilt sich in zwei Abschnitte, die sich mit dem Pietismus und dem Philanthropismus auseinandersetzen. Der Abschnitt zum Pietismus definiert den Begriff, beschreibt verschiedene Strömungen innerhalb des Pietismus und analysiert die pädagogischen Ansätze von August Hermann Francke, wie die Betonung christlicher Frömmigkeit, Gehorsam und die Abwendung von weltlichen Gütern. Er betont die Bedeutung der Bekehrungserfahrung und die Rolle der "Zucht" in der Erziehung. Der Philanthropismus wird als Gegenbewegung zum Pietismus im Kontext der Aufklärung dargestellt, charakterisiert durch Vernunft und Natürlichkeit als zentrale Erziehungsziele.
Schlüsselwörter
Pietismus, Philanthropismus, Aufklärung, Erziehung, Frömmigkeit, Vernunft, Natürlichkeit, August Hermann Francke, religiöse Erziehung, weltliche Erziehung, Gehorsam, Bekehrung, Dreißigjähriger Krieg.
Häufig gestellte Fragen zu: Vergleich Pietismus und Philanthropismus
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Erziehungsformen des Pietismus und des Philanthropismus. Sie untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Ansätze, beleuchtet die Entwicklung des Philanthropismus aus dem Pietismus und prüft die heutige Relevanz beider Erziehungsformen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleich der Erziehungsziele, Analyse der Unterschiede in den Erziehungsmethoden, Untersuchung der religiösen und weltanschaulichen Grundlagen, Bewertung des gesellschaftlichen Einflusses und die Relevanz für die heutige Pädagogik. Der historische Kontext, insbesondere die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges und der Aufstieg des Pietismus, wird ebenfalls betrachtet.
Welche Erziehungsformen werden verglichen?
Im Mittelpunkt stehen der Pietismus und der Philanthropismus. Der Pietismus wird als religiös geprägte Erziehungsform mit Betonung auf christlicher Frömmigkeit, Gehorsam und Abwendung von weltlichen Gütern beschrieben. Der Philanthropismus wird als säkulare Gegenbewegung im Kontext der Aufklärung dargestellt, die Vernunft und Natürlichkeit in den Mittelpunkt stellt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu den Erziehungsformen (Pietismus und Philanthropismus), und ein Fazit, welches einen Vergleich zwischen beiden Erziehungsformen vornimmt. Zusätzlich gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und eine Liste mit Schlüsselbegriffen.
Wer ist August Hermann Francke und welche Rolle spielt er?
August Hermann Francke wird im Kapitel über den Pietismus als bedeutende Persönlichkeit erwähnt. Seine pädagogischen Ansätze, wie die Betonung christlicher Frömmigkeit, Gehorsam und die Abwendung von weltlichen Gütern, werden analysiert. Seine Rolle im Pietismus und seine Bedeutung für die Entwicklung der pietistischen Erziehung werden hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pietismus, Philanthropismus, Aufklärung, Erziehung, Frömmigkeit, Vernunft, Natürlichkeit, August Hermann Francke, religiöse Erziehung, weltliche Erziehung, Gehorsam, Bekehrung, Dreißigjähriger Krieg.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit zieht einen Vergleich zwischen Pietismus und Philanthropismus und bewertet den Einfluss beider Erziehungsformen auf die Gesellschaft und die heutige Pädagogik. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Text der Arbeit selbst nachzulesen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Personen gedacht, die sich für die Geschichte der Pädagogik, den Pietismus und den Philanthropismus sowie deren Einfluss auf die Gesellschaft interessieren. Sie eignet sich insbesondere für akademische Zwecke, z.B. im Rahmen von Studienarbeiten.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Pietismus und Philanthropismus. Ein Vergleich der Erziehungsformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350005