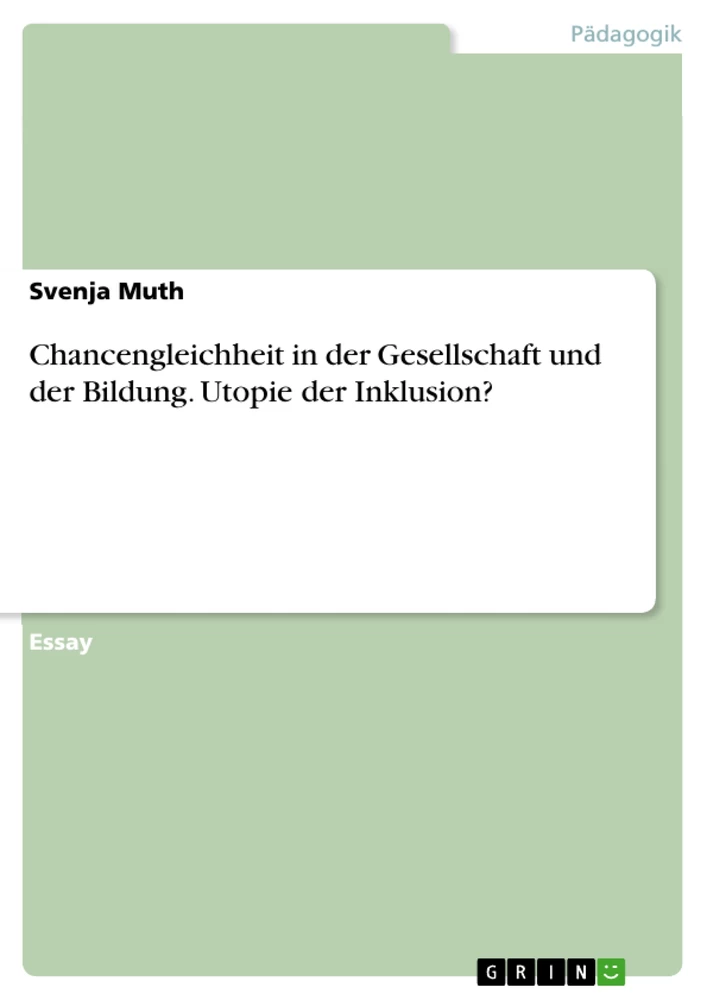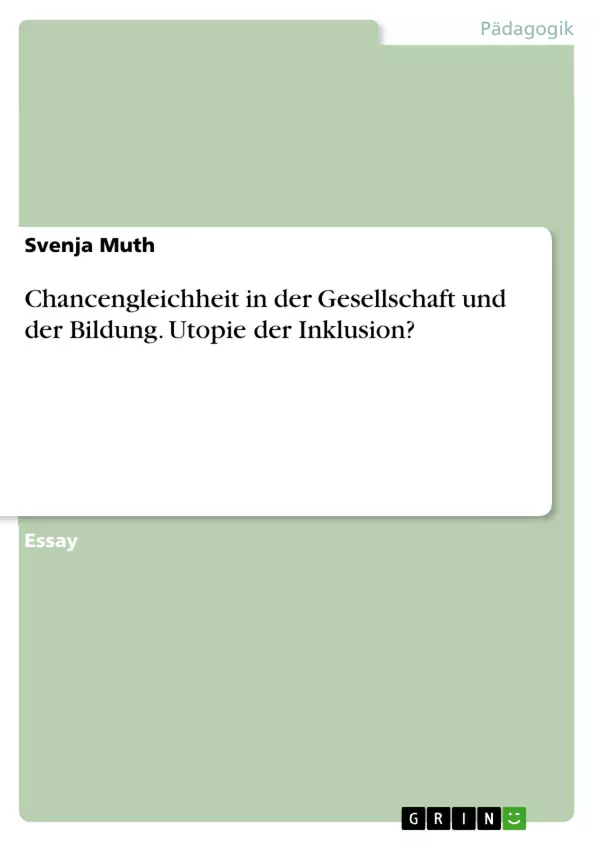Nach der UN-Konvention von 2006 ist Inklusion keine Utopie, sondern beschlossene Sache. Menschen mit Behinderung haben das Recht gleichberechtigt bzw. chancengleich an der Gesellschaft zu partizipieren, auch und vor allem an Bildung. Dazu gehört die Bereitstellung aller unterstützenden Mittel, um bedürfnisangemessen eine inklusive Beschulung zu ermöglichen. Dies haben die EU-Staaten schon 2006 vertraglich zugesichert. Jetzt-9 Jahre später, sind wir von einer gelungenen Umsetzung vielleicht weiter entfernt denn je.
Inhaltsverzeichnis
- Inklusion-eine Utopie?
- Schule und Gesellschaft
- Partizipation und Akzeptanz
- Die Umsetzung in der Schule
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Umsetzung des Inklusionsgedankens in der Schule. Ziel ist es, die Herausforderungen und Probleme aufzuzeigen, die mit der Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Bildung verbunden sind.
- Die Rolle der Schule in der Gesellschaft
- Die Bedeutung von Partizipation und Akzeptanz für die Inklusion
- Die Herausforderungen für Lehrer bei der Umsetzung von Inklusion
- Die Notwendigkeit einer langfristigen und reflektierten Inklusionspädagogik
- Die Bedeutung von sozialer Anerkennung und Wertschätzung für Menschen mit Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
Inklusion-eine Utopie?
Der Text stellt die Frage, ob Inklusion eine Utopie ist oder eine realistische Vision. Er betont die Bedeutung der UN-Konvention von 2006, die das Recht auf gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft festhält.
Schule und Gesellschaft
Der Abschnitt beleuchtet das Verhältnis von Schule und Gesellschaft. Er argumentiert, dass die Schule neben ihrer persönlichkeitsfördernden Funktion auch eine gesellschaftliche Funktion hat, die mit der Inklusion kollidiert.
Partizipation und Akzeptanz
Dieser Abschnitt betont die Bedeutung von Partizipation und Akzeptanz für eine gelingende Inklusion. Er argumentiert, dass mehr reale Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft notwendig ist, um eine selbstverständliche Begegnung und Akzeptanz zu ermöglichen.
Die Umsetzung in der Schule
Der Text analysiert die Herausforderungen für Lehrer bei der Umsetzung von Inklusion in der Schule. Er kritisiert die unzureichende Vorbereitung der Lehrer und die fehlende Unterstützung durch Förderschullehrer.
Schlüsselwörter
Inklusion, Behinderung, Bildung, Schule, Gesellschaft, Partizipation, Akzeptanz, Lehrer, Förderschule, UN-Konvention, Leistung, Selektion, Soziales, Anerkennung, Diversity, Differenz, Utopie, Realisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die rechtliche Basis für schulische Inklusion?
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen aus dem Jahr 2006 verpflichtet die Unterzeichnerstaaten zur Gewährleistung eines inklusiven Bildungssystems.
Warum wird Inklusion oft als „Utopie“ bezeichnet?
Weil die praktische Umsetzung oft an mangelnden Ressourcen, unzureichender Vorbereitung der Lehrkräfte und gesellschaftlichen Barrieren scheitert.
Welches Problem ergibt sich aus der Selektionsfunktion der Schule?
Das traditionelle Leistungsprinzip und die Einteilung in verschiedene Schulformen (Selektion) stehen im Widerspruch zum Inklusionsgedanken der gemeinsamen Beschulung aller Kinder.
Welche Rolle spielt die soziale Anerkennung bei der Inklusion?
Gelingende Inklusion setzt voraus, dass Vielfalt (Diversity) als Bereicherung wahrgenommen wird und Menschen mit Behinderung echte Partizipation und Wertschätzung erfahren.
Wie bewertet der Text die Vorbereitung der Lehrer auf Inklusion?
Der Text kritisiert eine unzureichende Vorbereitung und die oft fehlende Unterstützung durch spezialisierte Förderschullehrer im Regelschulbetrieb.
- Citar trabajo
- Svenja Muth (Autor), 2012, Chancengleichheit in der Gesellschaft und der Bildung. Utopie der Inklusion?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/349964