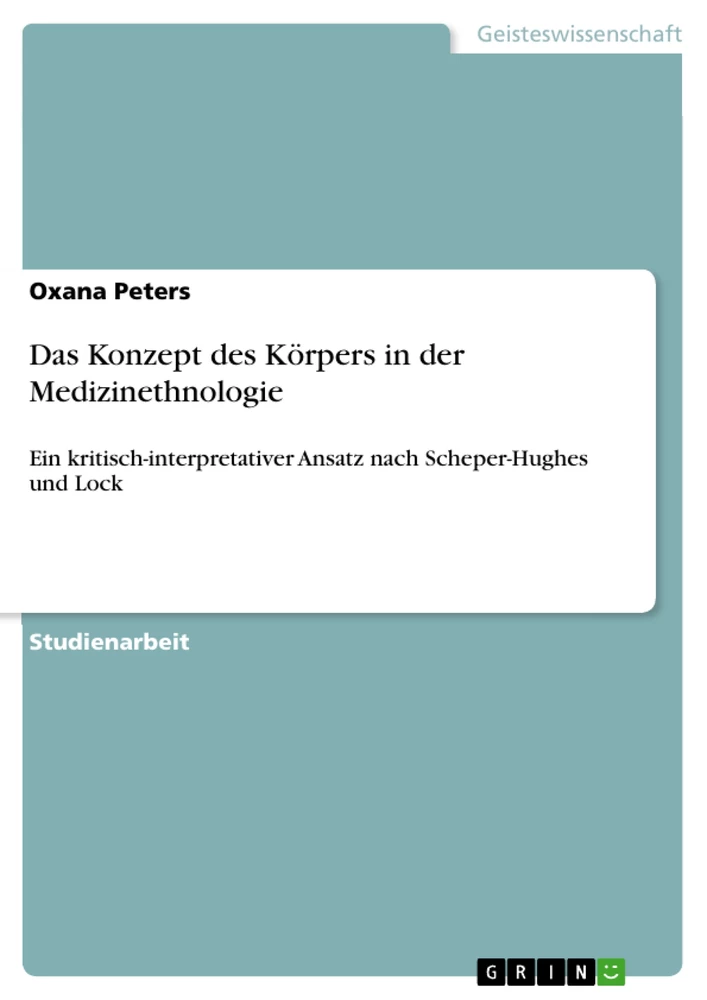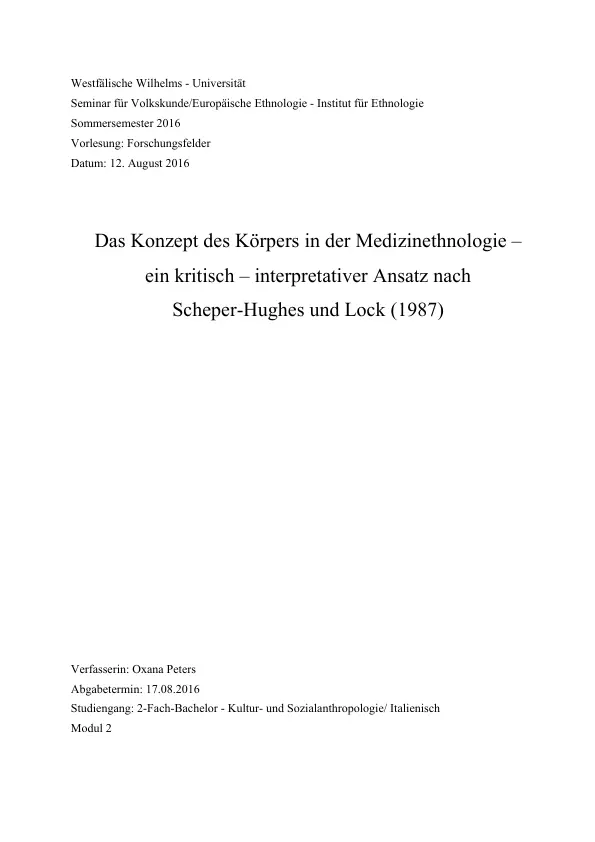Sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart wurde und wird die Medizinethnologie auf verschiedenste Art und Weise in den unterschiedlichen Kontexten definiert und abgegrenzt. Die Medizinethnologie gilt folglich als die kulturwissenschaftliche Erforschung von Medizin, Krankheitsbildern und deren Gesundheitsstörungen in Verknüpfung mit ihrer kulturellen Umgebung.
Erst seit Mitte des letzten Jahrhunderts institutionalisierte sich die Medizinethnologie in verschiedenen Nationen und in unterschiedlichen Fachbereichen als wissenschaftliche Disziplin. In Deutschland entwickelte sich im 18. und 19. Jahrhundert aus der Allgemeinen Anthropologie die Medizinethnologie als Teilbereich der Medizin und gelangte dann unter Beeinflussung der Freud’schen Psychoanalyse zu einer neuen Ausrichtung der Medizin, die auch die kulturelle Biografie einer erkrankten Person berücksichtigte.
Es galt in den 1970er Jahren die Medizin als kulturelles System zu verstehen und die Dominanz und kulturelle Blindheit der westlichen Biomedizin gesellschaftskritisch zu betrachten. Am Ende des Jahrhunderts wurde durch die kritische Medizinethnologie grundlegende Kritik an gesellschaftlichen Machtverhältnissen ausgeübt und für eine gerechtere Verteilung medizinischer Ressourcen plädiert.
Erst Ende der 1980er Jahre, nachdem Natur als eine Form des Kulturellen festgestellt worden war, wurde auch die scheinbar objektive Realität von Krankheit und Körper zu einem zentralen Forschungsthema der Medizinethnologie. Infolgedessen wurde der alleinige Definitionsanspruch der Biomedizin auf das, was als Krankheit und Körper gelten kann, infrage gestellt und begonnen, neue Modelle und Theorien des Körperlichen, des Leidens und des Heilens in der Medizinethnologie zu entwickeln.
Diese Arbeit wird nach einer kurzen Erläuterung der vier verschiedenen Ansätze der Medizinethnologie und des cartesianischen Dualismus das Konzept des Körpers zunächst diesen Kategorien zuordnen. Daraufhin gehe ich auf die zentrale Frage ein: Wie unterscheidet sich das Verständnis des Körpers in der Medizinethnologie von dem der Biomedizin? Dazu orientiere ich mich an dem Modell der drei Körper nach Scheper-Hughes und Lock (1987).
Inhaltsverzeichnis
- 2. WAS IST MEDIZINETHNOLOGIE?
- 2.1. ÖKOLOGISCHER ANSATZ.
- 2.2. INTERPRETATIVER ANSATZ..
- 2.3. KRITISCHE MedizinethNOLOGIE.
- 2.4. ETHNOMEDIZIN
- 2.5. CARTESIANISCHER DUALISMUS .
- 3. DAS KONZEPT DES KÖRPERS.
- 3.1. DIE DREI KÖRPER..
- 3.1.1 Individueller Körper.
- 3.1.2. sozialer Körper.
- 3.1.3. Körperpolitik..
- 3.2. GEFÜHLE ALS MITTLER DES MINDFUL BODY..
- 4. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept des Körpers in der Medizinethnologie und untersucht, wie sich das Verständnis des Körpers in der Medizinethnologie von dem der Biomedizin unterscheidet. Sie analysiert die verschiedenen Ansätze der Medizinethnologie, darunter der ökologische, der interpretative, der kritische und der ethnomedizinische Ansatz, sowie den cartesianischen Dualismus.
- Die verschiedenen Ansätze der Medizinethnologie und deren Bezug zum Körper
- Der cartesianische Dualismus und seine Auswirkungen auf das Körperverständnis
- Das Modell der drei Körper nach Scheper-Hughes und Lock (1987)
- Die Bedeutung von Kultur und Emotionen für die Körpererfahrung
- Der Einfluss von Machtverhältnissen und gesellschaftlichen Strukturen auf Krankheit und Gesundheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Einführung in die Medizinethnologie und erläutert die verschiedenen Ansätze und Denktraditionen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Dabei werden der ökologische Ansatz, der interpretative Ansatz, die kritische Medizinethnologie und die Ethnomedizin vorgestellt. Anschließend wird der cartesianische Dualismus als einflussreicher Faktor für das Körperverständnis in der westlichen Medizin beleuchtet. Im nächsten Kapitel wird das Konzept des Körpers in der Medizinethnologie näher betrachtet, wobei das Modell der drei Körper nach Scheper-Hughes und Lock (1987) im Vordergrund steht. Dieses Modell unterscheidet zwischen dem individuellen Körper, dem sozialen Körper und der Körperpolitik und verdeutlicht die vielschichtigen Ebenen des Körperverständnisses. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung von Kultur und Emotionen für die Körpererfahrung. Abschließend werden die gewonnen Erkenntnisse und die Antwort auf die zentrale Frage in einem Schlussfazit zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Medizinethnologie, Körper, Krankheit, Kultur, Emotionen, Biomedizin, cartesianischer Dualismus, ökologischer Ansatz, interpretativer Ansatz, kritische Medizinethnologie, Ethnomedizin, Modell der drei Körper, embodiment, Leib, Leid, soziale Strukturen, Machtverhältnisse, Gesundheitsressourcen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Medizinethnologie?
Medizinethnologie ist die kulturwissenschaftliche Erforschung von Medizin, Krankheitsbildern und Gesundheit in Verbindung mit ihrer kulturellen und gesellschaftlichen Umgebung.
Was ist das Modell der „drei Körper“ nach Scheper-Hughes und Lock?
Es unterscheidet zwischen dem individuellen Körper (Leib/Selbst), dem sozialen Körper (Symbol für Gesellschaft) und der Körperpolitik (Kontrolle und Macht über Körper).
Was bedeutet „cartesianischer Dualismus“ in der Medizin?
Es ist die strikte Trennung von Geist und Körper. Die westliche Biomedizin basiert oft auf diesem Dualismus, während die Medizinethnologie Körper und Geist als Einheit („Mindful Body“) betrachtet.
Welche Ansätze gibt es in der Medizinethnologie?
Man unterscheidet den ökologischen Ansatz, den interpretativen Ansatz, die kritische Medizinethnologie und die Ethnomedizin.
Wie unterscheidet sich das Körperverständnis der Medizinethnologie von der Biomedizin?
Während die Biomedizin den Körper oft als biologische Maschine sieht, betrachtet die Medizinethnologie ihn als kulturelles Produkt, das durch soziale Strukturen, Emotionen und Machtverhältnisse geprägt ist.
- Arbeit zitieren
- Oxana Peters (Autor:in), 2016, Das Konzept des Körpers in der Medizinethnologie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/349932