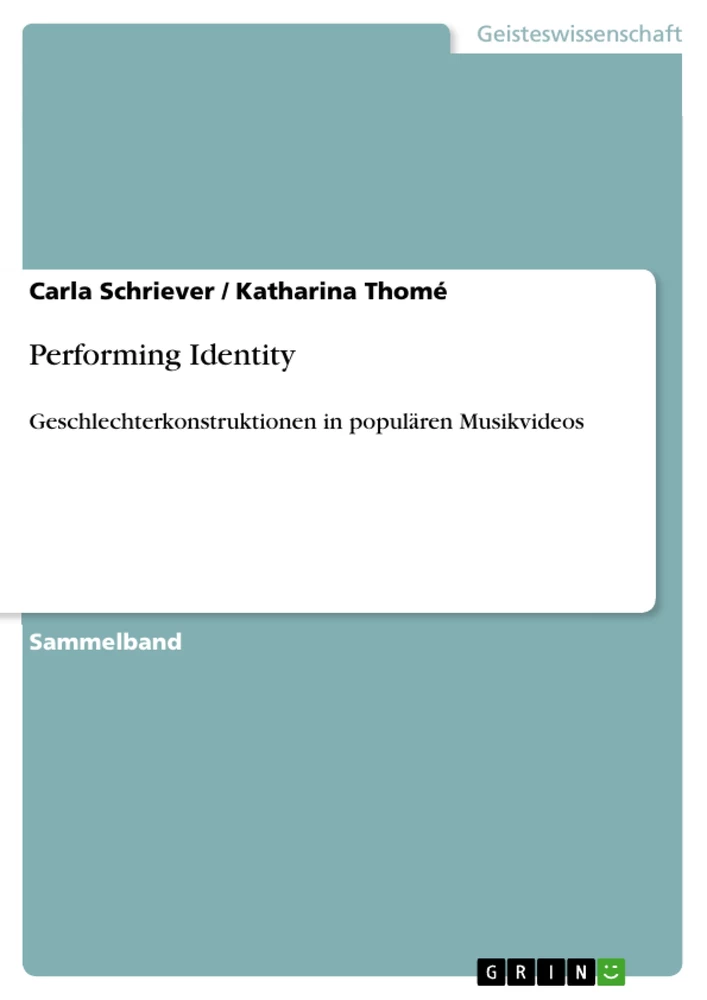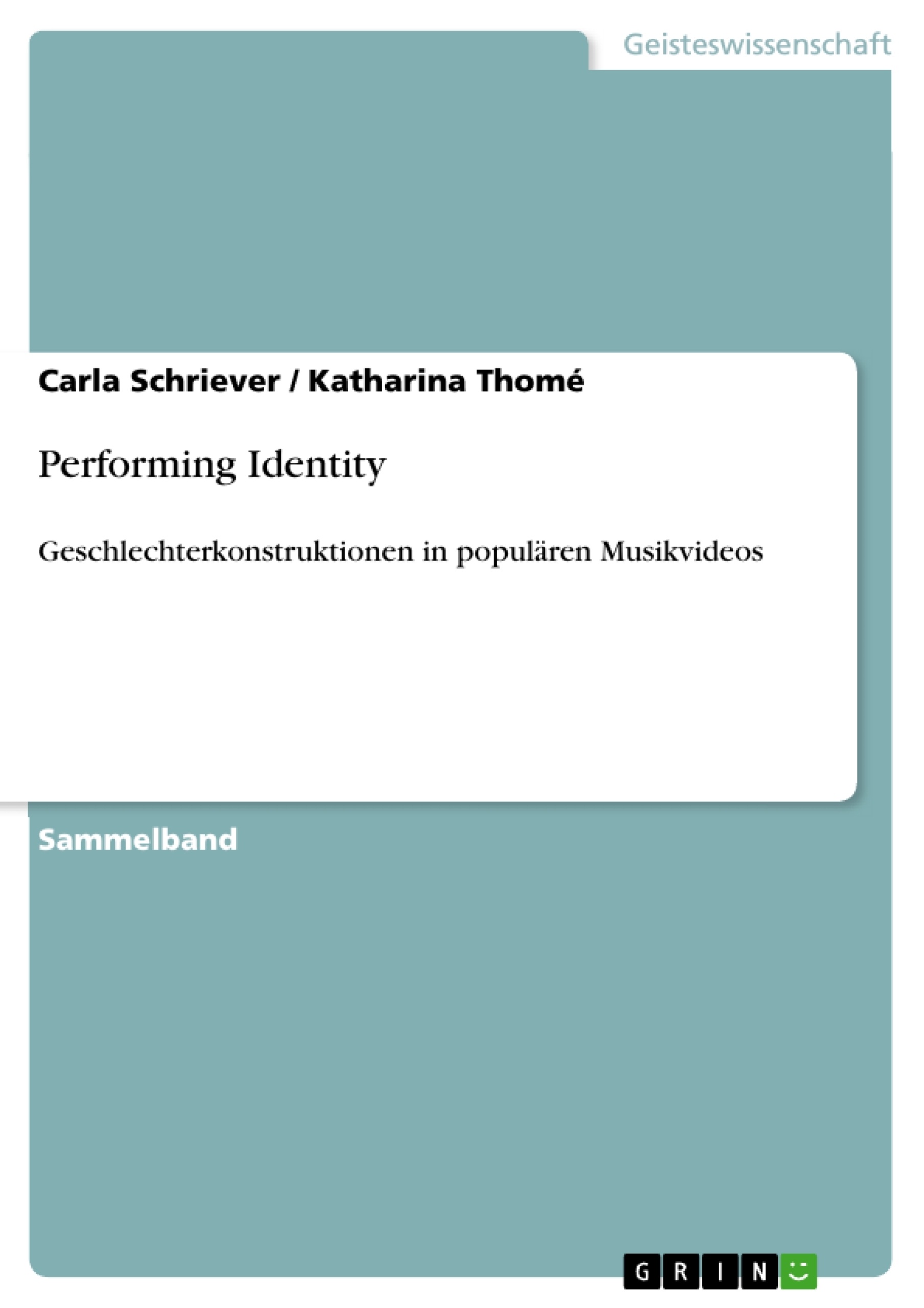Musikvideos haben sich als ein globales Massenphänomen etabliert. Milliarden von Rezipienten konsumieren diese Videos auf Plattformen wie YouTube oder Clipfish, denn das Medium ist für jede_n frei verfügbar, der_die einen Internetzugang besitzt. Die Videos überzeugen durch ihre ansprechende Bild-Text-Sprache und unterstreichen durch visuelle Mittel die Hauptaussagen des jeweiligen Songs. Die Bandbreite der zu decodierenden Stilmittel kann vom Outfit bis zum Kulissenbild reichen.
In jedem Fall bereichern die visuellen Codes die Aussagekraft von Videos. Welche spezifischen Botschaften die Rezipierenden jedoch entschlüsseln, hängt vom Wissensstand und der Disposition der Betrachter ab. Oftmals werden die wahrgenommenen und interpretierten Signale und Zeichen verinnerlicht. Diese im Musikvideo unterschwelligen Botschaften vermitteln starke Aussagen über Geschlechterrollen. Es werden Informationen und Zuschreibungen über die Geschlechter transportiert. Diese Darstellung (doing gender) findet zwangsläufig in jedem Musikvideo statt, wobei sich eine Vielzahl der Videos auf die Heteronormativität beruft. Zudem wird in bestimmten Genres wie Hip-Hop dieses dualistische System durch Hypermaskulinität und Hyperfeminität verstärkt.
Ansätze, die diese Geschlechterrollen kritisieren, finden sich selten in populären Clips. Auf der anderen Seite dienen Musikvideos als Identifikationsvorlage. Nach dem Prinzip sex sells werden Lust und Begehren erzeugt, Emotionen vorgegeben und somit Identifikationen angeboten. Dieses geschieht nicht zuletzt durch das Thematisieren von Phantasien, Wünschen und Ängsten der Rezipienten. Der jeweilige Stil wird aus dem Musikvideo kopiert und übernommen. Stars werden verehrt und zu Idolen gemacht. Es gibt zahlreiche Jugendkulturen, deren Gründung auf einzelne Musikvideos zurückzuführen ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Inszenierung von Weiblichkeit_en in populären Musikvideo
- 1.1 Luisa Korte: “You gotta know how to treat me like a lady” - Inszenierung von Weiblichkeit am Beispiel von Meghan Trainor
- 1.2 Inga Becker: Popfeminismus oder Kommerz? Eine Analyse der Musikvideos Rub von Peaches und ***Flawless von Beyoncé in Bezug auf die feministische Selbstpositionierung der Künstlerinnen
- 1.3 Loreen Luther: Black Feminism im visuellen Album Lemonade von Beyoncé
- 1.4 Frauke Blohm: „Eine Bitch ist 'ne Bitch ist 'ne Bitch ist 'ne Bitch“ Gender Performativität und Empowerment am Beispiel Lady Bitch Ray
- 2 Kritiken an tradierten Rollenbildern: die Mutter
- 2.1 Sara Rihl: Body und Gender im populären Musikvideo
- 2.2 Christine Maria Stahmann: Die Inszenierung der Frau in ihrer Rolle als Mutter am Beispiel des Musikclips zum Song „M.I.L.F.“ (Fergie)
- 2.3 Frauke Schoon: Got milf? Widerstand gegen traditionelle Mutterbilder und Geschlechterrollen im populären Musikvideo
- 3 Adoleszente Identifikationsstrategien mit Pop Bands
- 3.1 Katharina Steinhausen: SPICE UP YOUR LIFE. Die Spice Girls und das Girl-Power-Konzept
- 3.2 Marie Luise Templin: Das männliche Geschlecht als Verliebtheitsobjekt im Popmusikvideo: One Direction als Schablone adoleszenter Bedürfnisse und Sehnsüchte durch die Konstruktion von imaginärer Nähe und Individualität
- 4 Partizipation und Musikvideo
- 4.1 Victoria Wilms: Das Musikvideo lebt wieder - und jeder kann mitmachen - Interaktive Musikvideos im Web 2.0
- 4.2 Mareike Sprock: "Remember when I was a ten and did not look like a guy?" Bart Bakers Parodie zu "Wrecking Ball” von Miley Cyrus
- 5 Zum transgressiven Potenzial von populären Musikvideos
- 5.1 Philipp Alexander Rotzal: Inszenierungen von Männlichkeit_en in Musikvideos der Band Rammstein
- 5.2 Jolanta Stebel: “you wanna be tough – you wanna be a man“. Über die vestimentäre Konstruktion von Michael Jackson im 'Beat it'-Video-Clip
- 5.3 Arne Burhop: „Cyborgs zwischen träumerischer Utopie und kämpferischer Politisierung“. „Feministisch-subversives Potenzial in Musikvideos von Chris Cunningham und Ninian Doff“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Sammelband analysiert die Darstellung von Geschlechterrollen in populären Musikvideos. Ziel ist es, das Potenzial dieser Videos zur Darstellung sozialer Geschlechterkonstruktionen aufzuzeigen und aktuelle Perspektiven der Musikvideoforschung zu präsentieren. Die einzelnen Studien untersuchen verschiedene Aspekte, von der Inszenierung von Weiblichkeit und Männlichkeit bis hin zu Identifikationsstrategien Jugendlicher und dem transgressiven Potenzial des Mediums.
- Inszenierung von Weiblichkeit und Männlichkeit in Musikvideos
- Kritik an traditionellen Geschlechterrollen und -bildern (z.B. die Mutterrolle)
- Identifikationsstrategien Jugendlicher mit Popbands
- Partizipation und Interaktivität im Kontext von Musikvideos
- Transgressives Potenzial von Musikvideos im Hinblick auf Geschlechterkonstruktionen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Inszenierung von Weiblichkeit_en in populären Musikvideo: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Inszenierungen von Weiblichkeit in populären Musikvideos, indem es Künstlerinnenfiguren und deren visuelle Präsentationen analysiert. Es beleuchtet verschiedene Facetten, von der Konstruktion von Weiblichkeit im Mainstream-Pop bis hin zu feministischen Gegenentwürfen und der Darstellung von Black Feminism. Die Analysen zeigen die Bandbreite an Repräsentationen und deren Ambivalenzen auf, die sowohl kommerzielle als auch emanzipatorische Aspekte beinhalten können.
2 Kritiken an tradierten Rollenbildern: die Mutter: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Darstellung der Mutterrolle in Musikvideos. Es untersucht, wie traditionelle Vorstellungen von Mutterschaft inszeniert werden und welche kritischen Auseinandersetzungen mit diesen Bildern in den analysierten Videos zu finden sind. Die Analysen belegen, dass der Diskurs um die Mutterrolle, trotz der relativen Aktualität der untersuchten Videos (2016), weiterhin aktuell und relevant ist, und dass Musikvideos einen Spiegel der gesellschaftlichen Debatten darstellen.
3 Adoleszente Identifikationsstrategien mit Pop Bands: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf den Identifikationsstrategien Jugendlicher mit Popbands, sowohl Girl- als auch Boygroups. Es werden die Mechanismen analysiert, wie diese Bands und ihre Musikvideos Sehnsüchte und Bedürfnisse Jugendlicher ansprechen und Identifikationsangebote schaffen. Die Analysen beleuchten die Konstruktion von Nähe und Individualität in diesen Videos und deren Wirkung auf das Publikum.
4 Partizipation und Musikvideo: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Partizipation im Musikvideokontext, indem es sowohl die zunehmende Interaktivität von Musikvideos im Web 2.0 als auch die Parodie als Form des kritischen Kommentars beleuchtet. Es wird untersucht, wie Zuschauer aktiv an der Produktion und Interpretation von Musikvideos beteiligt werden können und wie diese Partizipation die Bedeutung und Interpretation der Videos beeinflusst.
5 Zum transgressiven Potenzial von populären Musikvideos: Das abschließende Kapitel analysiert Musikvideos, die sich mit dem Durchbrechen dichotomer Geschlechterkonstruktionen auseinandersetzen. Es werden Beispiele untersucht, die subversive und feministische Perspektiven auf Geschlechterrollen präsentieren und die Grenzen traditioneller Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen hinterfragen.
Schlüsselwörter
Geschlechterrollen, Musikvideos, Popkultur, Identität, Weiblichkeit, Männlichkeit, Feminismus, Mutterrolle, Adoleszenz, Identifikation, Partizipation, Transgression, Hypermaskulinität, Hyperfeminität, Web 2.0, Popfeminismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu "Inszenierung von Geschlechterrollen in populären Musikvideos"
Welche Themen werden in diesem Sammelband behandelt?
Der Sammelband analysiert die Darstellung von Geschlechterrollen in populären Musikvideos. Die einzelnen Studien untersuchen verschiedene Aspekte, von der Inszenierung von Weiblichkeit und Männlichkeit bis hin zu Identifikationsstrategien Jugendlicher und dem transgressiven Potenzial des Mediums. Konkret werden Themen wie die Kritik an traditionellen Geschlechterrollen (z.B. die Mutterrolle), Identifikationsstrategien Jugendlicher mit Popbands, Partizipation und Interaktivität im Kontext von Musikvideos sowie das transressive Potenzial von Musikvideos im Hinblick auf Geschlechterkonstruktionen behandelt.
Welche Kapitel umfasst der Sammelband?
Der Sammelband gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Inszenierung von Weiblichkeit_en in populären Musikvideos; 2. Kritiken an tradierten Rollenbildern: die Mutter; 3. Adoleszente Identifikationsstrategien mit Pop Bands; 4. Partizipation und Musikvideo; 5. Zum transgressiven Potenzial von populären Musikvideos. Jedes Kapitel beinhaltet mehrere Einzelstudien zu spezifischen Musikvideos und Künstlern.
Welche Künstler und Musikvideos werden analysiert?
Der Sammelband analysiert eine Vielzahl von populären Musikvideos und Künstlern, darunter Meghan Trainor, Peaches, Beyoncé, Lady Bitch Ray, Fergie, die Spice Girls, One Direction, Miley Cyrus, Rammstein und Michael Jackson. Die Auswahl repräsentiert unterschiedliche Genres und Epochen, um ein breites Spektrum an Geschlechterdarstellungen zu beleuchten.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Studien im Sammelband verwenden verschiedene theoretische Ansätze, um die Darstellung von Geschlechterrollen in Musikvideos zu analysieren. Konzepte wie Gender Performativität, Feminismus (inklusive Black Feminism), Popfeminismus und die Konstruktion von Identität spielen eine zentrale Rolle. Die Analysen berücksichtigen sowohl kommerzielle als auch emanzipatorische Aspekte der Musikvideoinszenierung.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Sammelband?
Der Sammelband zeigt das Potenzial von populären Musikvideos auf, soziale Geschlechterkonstruktionen darzustellen und zu kritisieren. Er verdeutlicht die Ambivalenz von Musikvideoinszenierungen, die sowohl traditionelle als auch transgressiven Geschlechterrollen abbilden können. Die Analysen belegen die Aktualität des Diskurses um Geschlechterrollen und die Bedeutung von Musikvideos als Spiegel gesellschaftlicher Debatten. Weiterhin wird die zunehmende Partizipation der Zuschauer und die Interaktivität von Musikvideos im Web 2.0 hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Sammelbands treffend beschreiben, sind: Geschlechterrollen, Musikvideos, Popkultur, Identität, Weiblichkeit, Männlichkeit, Feminismus, Mutterrolle, Adoleszenz, Identifikation, Partizipation, Transgression, Hypermaskulinität, Hyperfeminität, Web 2.0, Popfeminismus.
Für wen ist dieser Sammelband relevant?
Dieser Sammelband ist relevant für Wissenschaftler, Studierende und alle Interessierten, die sich mit Geschlechterrollen, Popkultur, Musikvideoforschung und feministischen Perspektiven auseinandersetzen. Die interdisziplinäre Perspektive bietet Einblicke in die vielfältigen Facetten der Geschlechterdarstellung in einem populären Medium.
- Quote paper
- Carla Schriever (Editor), Katharina Thomé (Editor), 2016, Performing Identity. Geschlechterkonstruktionen in populären Musikvideos, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/349891