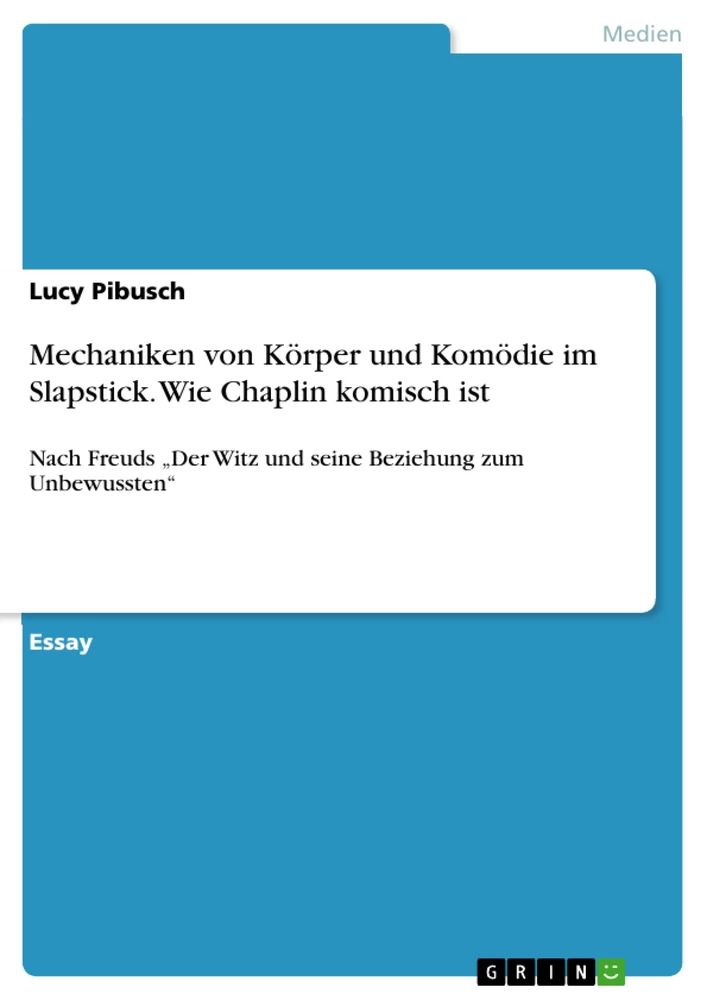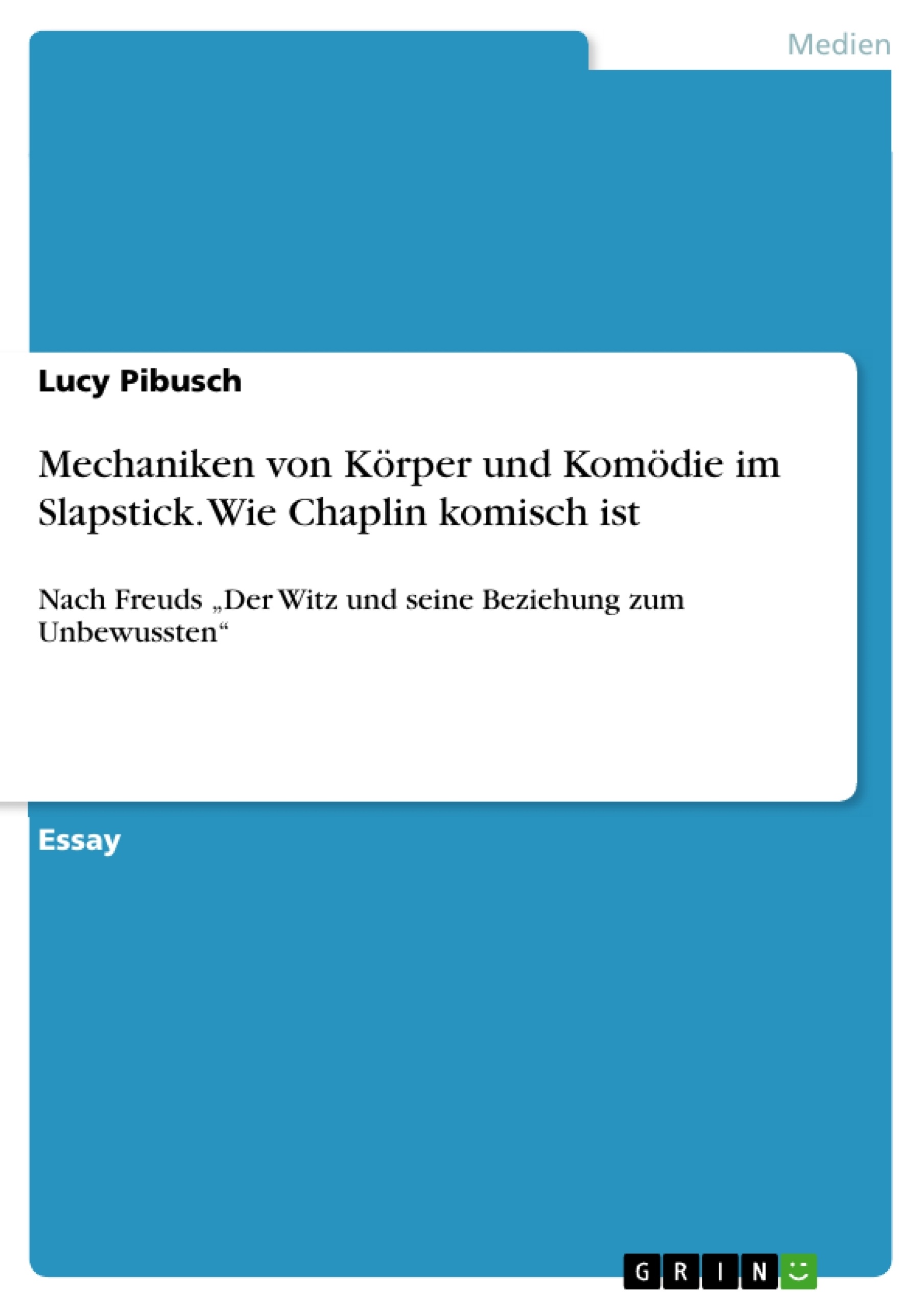„Diejenige Gattung des Komischen, welche dem Witze am nächsten steht, ist das Naive,“ so schreibt Freud in „Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten“ 1905. Das Naive fände man zumeist am Kind, aber auch an Personen die sich offensichtlich und entgegen jedweder Vernunft einfältig, übertrieben sorglos oder gutgläubig verhalten. Man amüsiere sich zum Beispiel köstlich darüber, dass man eine in Naivität und Ahnungslosigkeit getroffene Antwort auf eine Frage von philosophischem Rang erhalte, jedoch nur dann, wenn der Lachende feststellt: Der Antwortende weiß es schlicht und ergreifend nicht besser.
Auf diese Art und Weise funktioniert vielleicht auch Charlie Chaplins Figur des „Tramp“. Irgendwo zwischen dem gewollten Witz und der Komik der Situation steht die Naivität, die auch Charlie Chaplin in seinen Filmen verkörpert. Der allzeit sorglose, wenig vorausschauend denkende und niemals um eine Lösung verlegene Mann in dem zu knapp geratenem Anzug hat ein großartiges Talent dafür, ein Publikum zum Lachen zu bringen.
Wenn Charlie Chaplin mit seinem Watschelgang ins Bild tapert, dann beginnen wir bereits zu schmunzeln. Wenn er dann noch ein „komisches“ Gesicht macht, ist es um uns geschehen: Wir lachen. Dieses Lachen ist für Siegmund Freud eine ganz eigene Physik. Er spricht von einer Art von Energie die sich in uns anstaut, wenn wir etwa einen Bewegungsablauf sehen, der uns in zu großer Geste und mit zu viel Anstrengung vollführt wird. Weil wir selbst viel weniger Aufwand für den gleichen Gang wie der Tramp aufbringen würden, spricht Freud hier von einer „Aufwanddifferenz“. Die angestaute Energie wird abgeführt, indem wir lachen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Warum wir lachen, wo wir lachen
- 3. Wann wir nicht lachen..
- 4. Lachen wir auch grundlos?.....
- 5. (Nicht-)Lachen als Lehre
- 6. Lachen wir nur über „andere?....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, basierend auf Freuds „Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten“, die komischen Mechanismen in Charlie Chaplins Filmen. Sie analysiert, wie Chaplins Naivität und die von Freud beschriebenen Konzepte der Aufwanddifferenz und Situationskomik zum Lachen beim Zuschauer führen.
- Chaplins Naivität als komisches Element
- Freuds Theorie der Aufwanddifferenz und ihre Anwendung auf Chaplins Figuren
- Die Rolle der Parodie und Verkleidung in Chaplins Komik
- Situationskomik in Chaplins Filmen
- Das Verhältnis von Mitleid und Lachen beim Zuschauer
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Verbindung zwischen Freuds Theorie des Witzes und der Komik in Charlie Chaplins Filmen her. Sie benutzt Chaplins Tramp-Figur als Beispiel für naives Verhalten, das komisch wirkt, da eine Diskrepanz zwischen dem Aufwand der Figur und dem Aufwand, den der Zuschauer für dieselbe Handlung betreiben würde, besteht. Diese "Aufwanddifferenz" ist ein zentraler Punkt in Freuds Theorie und wird im weiteren Verlauf der Arbeit genauer beleuchtet.
2. Warum wir lachen, wo wir lachen: Dieses Kapitel erweitert die Betrachtung der Komik in Chaplins Filmen. Neben der Naivität wird das "Sichhineinversetzen" des Zuschauers in die Figur thematisiert. Freud beschreibt dies als Vergleich des seelischen Vorgangs beim anderen mit dem eigenen. Das Kapitel analysiert Chaplins Parodien, insbesondere seine Darstellung von Adenoid Hynkel im „Großen Diktator“, als Beispiel für absichtlich hergestellte Komik. Es werden weiterhin die Verkleidung der Figur und die Situationskomik, beispielsweise in "Modern Times", analysiert und mit Freuds Theorie der "lustbringenden Differenz der Besetzungsaufwände" in Verbindung gebracht.
Schlüsselwörter
Charlie Chaplin, Slapstick, Komik, Freud, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, Naivität, Aufwanddifferenz, Situationskomik, Parodie, Verkleidung, Mitleid, Lachen.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Komik in Charlie Chaplins Filmen basierend auf Freuds Witztheorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die komischen Mechanismen in Charlie Chaplins Filmen anhand von Sigmund Freuds Theorie des Witzes, insbesondere im Hinblick auf die Konzepte der Aufwanddifferenz und Situationskomik. Sie untersucht, wie Chaplins Naivität und seine Darstellungstechniken zum Lachen beim Zuschauer führen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte der Chaplinschen Komik, darunter Chaplins Naivität als komisches Element, Freuds Theorie der Aufwanddifferenz und ihre Anwendung auf Chaplins Figuren, die Rolle der Parodie und Verkleidung, Situationskomik in seinen Filmen und das Verhältnis von Mitleid und Lachen beim Zuschauer. Ein besonderes Beispiel ist die Analyse von Chaplins Darstellung Adenoid Hynkels im "Großen Diktator".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Warum wir lachen, wo wir lachen, Wann wir nicht lachen, Lachen wir auch grundlos?, (Nicht-)Lachen als Lehre und Lachen wir nur über „andere?". Die Einleitung stellt die Verbindung zwischen Freuds Witztheorie und Chaplins Komik her. Kapitel 2 erweitert die Betrachtung der Komik und thematisiert das "Sichhineinversetzen" des Zuschauers. Die weiteren Kapitel vertiefen diese Themen.
Wie wird Freuds Theorie angewendet?
Freuds Konzept der "Aufwanddifferenz" – die Diskrepanz zwischen dem Aufwand der Figur und dem Aufwand, den der Zuschauer für dieselbe Handlung betreiben würde – spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit analysiert, wie diese Differenz in Chaplins Filmen zum komischen Effekt beiträgt. Auch Freuds Theorie der "lustbringenden Differenz der Besetzungsaufwände" wird im Kontext der Situationskomik und Parodien angewendet.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Charlie Chaplin, Slapstick, Komik, Freud, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, Naivität, Aufwanddifferenz, Situationskomik, Parodie, Verkleidung, Mitleid, Lachen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die komischen Mechanismen in Chaplins Filmen zu untersuchen und diese mit Freuds Theorie des Witzes zu verknüpfen. Sie möchte aufzeigen, wie Chaplins spezifische Darstellungstechniken und die von Freud beschriebenen Konzepte zum Lachen beim Zuschauer führen. Die Naivität der Chaplin Figur und das Verhältnis von Mitleid und Lachen werden dabei besonders berücksichtigt.
- Quote paper
- Lucy Pibusch (Author), 2015, Mechaniken von Körper und Komödie im Slapstick. Wie Chaplin komisch ist, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/349782