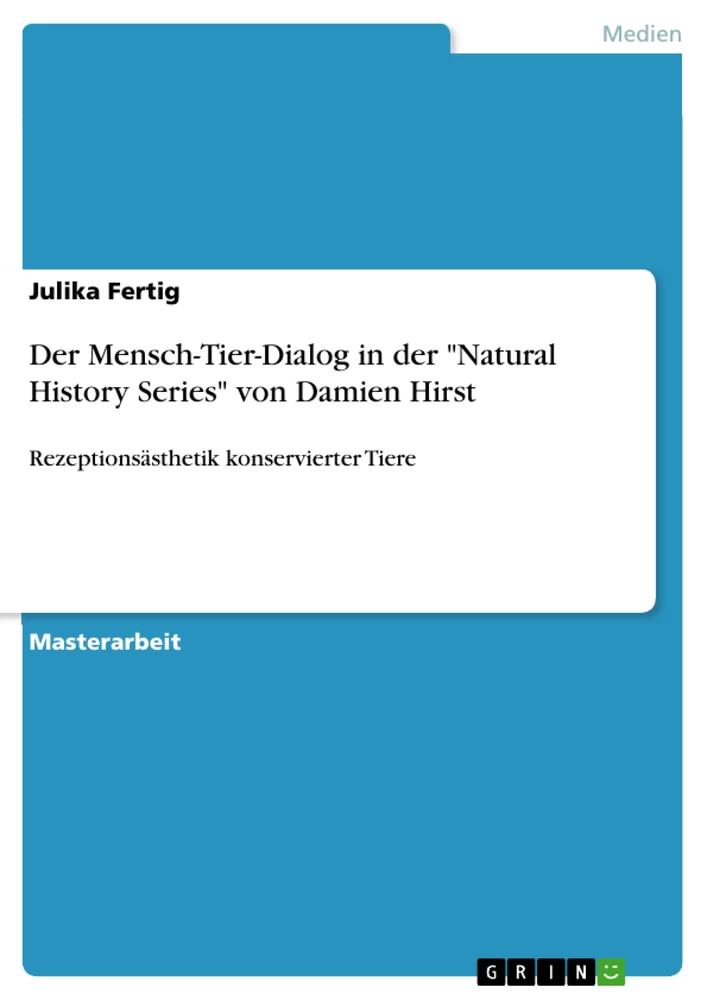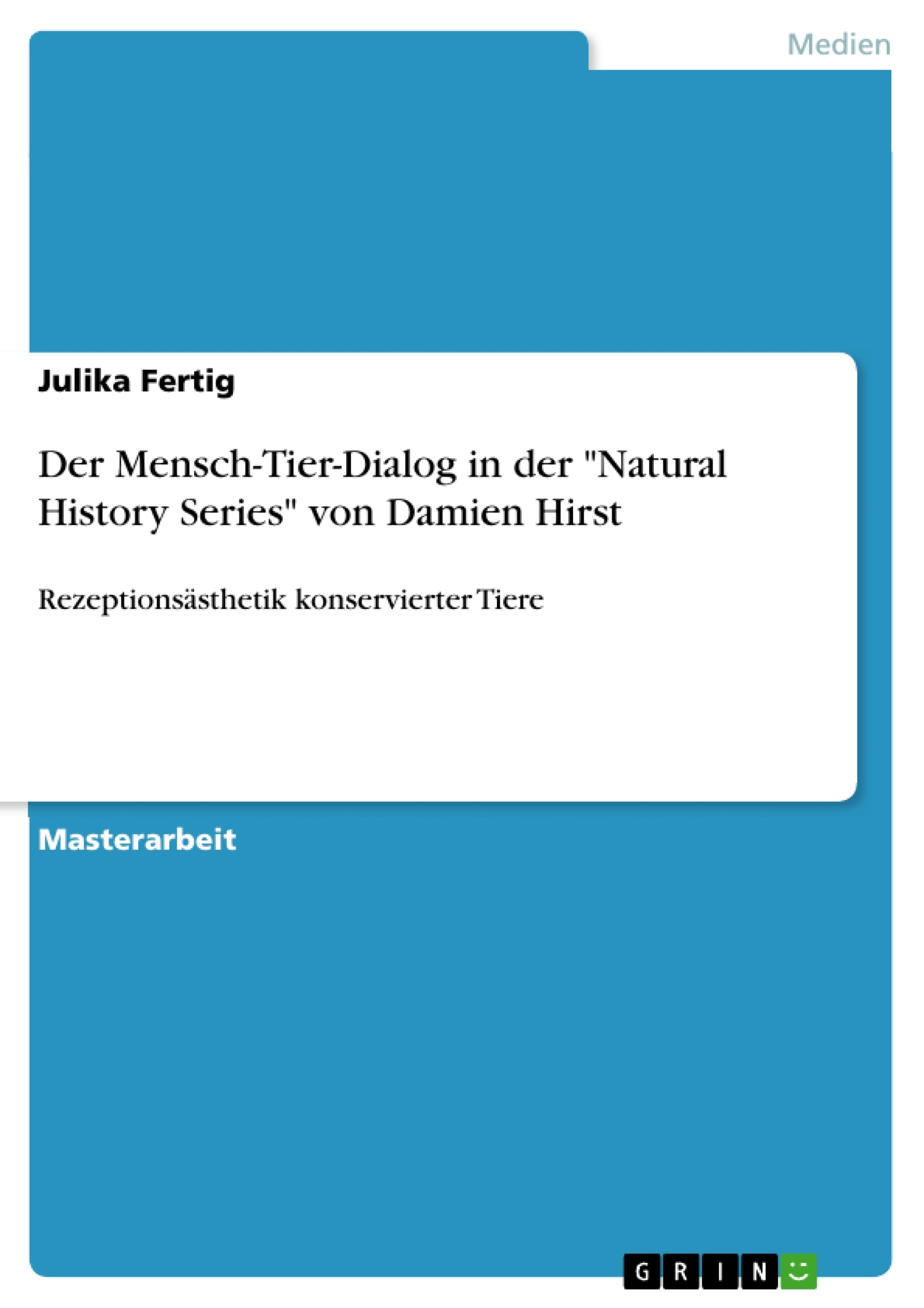Diese Arbeit wird sich nicht mit Damien Hirst, dem Marketinggenie und Superstar der Kunstszene auseinander setzten. Die Preise, die seine Werke erzielen, sind beeindruckend, aber für die in dieser Arbeit untersuchte Thematik unwichtig. Auch die Frage, ob es sich bei den Werken von Hirst um Kunst handelt oder nicht, ist nicht von Bedeutung. Diese Arbeit wird sich ausschließlich mit dem Mensch-Tier-Dialog der "Natural History Series" befassen, wobei die Definition eines solchen Dialoges mit seinen Besonderheiten im Vorfeld erläutert werden wird.
Die "Natural History Series" existiert bereits seit 1991 und besteht größtenteils aus Tieren die in Formalin eingelegt sind. Somit beschränkt sich der Mensch-Tier-Dialog auf tote, ausgestellte Tiere, genauer genommen auf Präparate. Die Rolle des Präparates in der Kunstgeschichte, das tote Tier als künstlerisches Material, aber auch die Grenzen zur Naturwissenschaft und zoologischen Museen sind wichtige Punkte, um sich den Arbeiten von Hirst zu nähren, da dieser mit Produktion und Inszenierung seiner Werke immer wieder Bezug auf eine bereits bestehende Tradition nimmt.
Im Mittelpunkt der Arbeit steht jedoch der Mensch-Tier-Dialog, das Wechselspiel von Kunstwerk und Rezipient, die Rezeptionsästhetik. Ausgangspunkt der Untersuchung ist deswegen das, was der Betrachter sieht. Hierbei konzentriert sich die Arbeit ausschließlich auf das Wesentliche, das Kunstwerk und seinen Rezipienten, unbeeindruckt davon, welcher Mythos um den Künstler herum aufgebaut wurde. Die Rolle von Hirst wird deshalb nur in einem naheliegenden Punkt erarbeitet werden: der Künstler als Erschaffer und erster Rezipient seiner Werke.
Die Arbeit wird sich auf drei ausgewählte Exemplare fokussieren: das erste in Formalin eingelegte Werk der Serie "The Impossibility of Death in the Mind of Someone Living", das umstrittene und auf der Biennale 1993 präsentierte Werk "Mother and Child (Divided)" und eine aktuellere Arbeit, versteigert in der Auktion "Beautiful Inside My Head Forever, The Dream". Anhand von diesen drei Werken soll stellvertretend erläutert werden, wie der Mensch-Tier-Dialog der Serie funktioniert. Hierfür werden die Werke zuerst beschrieben, analysiert um anschließend den entstehenden Dialog genau herauszuarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Natural History Series
- 2.1. Allgemeine Eckdaten
- 2.2. Beispiele
- 2.2.1. The Impossibility of Death in the Mind of Someone living, 1991
- 2.2.2. Mother and Child (Divided), 1993
- 2.2.3. The Dream, 2008
- 3. Das tote, ausgestellte Tier
- 3.1. Rezeptionsgeschichte
- 3.2. Hirsts Spezifika
- 3.2.1. Herstellung
- 3.2.2. Inszenierung
- 4. Der Mensch-Tier-Dialog
- 4.1. Rezeptionsästhetik des toten Tieres
- 4.2. Einzelne Tiere im Dialog
- 4.2.1. „Der Hai“
- 4.2.2. „Die Kuh und das Kalb“
- 4.2.3. „Das Einhorn“
- 4.3. Künstlerrolle
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Mensch-Tier-Dialog in Damien Hirsts Natural History Series. Das Hauptziel ist die Analyse der Rezeptionsästhetik konservierter Tiere als Kunstwerke und die Erforschung des spezifischen Wechselspiels zwischen Betrachter und dem dargestellten, toten Tier. Die Arbeit konzentriert sich auf die ästhetische Wirkung der Präparate und die daraus resultierende Interaktion.
- Rezeptionsästhetik konservierter Tiere in der Kunst
- Der Mensch-Tier-Dialog als zentrales Thema in Hirsts Werk
- Die Rolle des Präparates in der Kunstgeschichte
- Analyse ausgewählter Werke der Natural History Series
- Hirsts künstlerische Rolle als Schöpfer und erster Rezipient
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt Damien Hirst als prominenten und kontroversen zeitgenössischen Künstler vor und hebt seine medienwirksame Inszenierung hervor. Sie betont, dass die Arbeit sich nicht mit Hirsts wirtschaftlichem Erfolg oder der Kunstbegriffdebatte befasst, sondern ausschließlich den Mensch-Tier-Dialog in seiner Natural History Series analysiert. Die Arbeit fokussiert auf tote, ausgestellte Tiere als Präparate und untersucht deren Rolle in der Kunstgeschichte sowie den Bezug zu Naturwissenschaften und zoologischen Museen. Der Schwerpunkt liegt auf der Rezeptionsästhetik und dem Wechselspiel zwischen Kunstwerk und Betrachter, wobei die Rolle Hirsts als Künstler und erster Rezipient beleuchtet wird. Der Begriff der Rezeptionsästhetik nach Wolfgang Kemp bildet die Grundlage der Analyse. Der uralte Dialog zwischen Mensch und Tier wird im Kontext von Hirsts Werk neu interpretiert. Drei ausgewählte Werke – "The Impossibility of Death...", "Mother and Child (Divided)" und "The Dream" – dienen als Fallstudien für die Analyse des Mensch-Tier-Dialogs.
2. Die Natural History Series: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über Hirsts Natural History Series, inklusive allgemeiner Informationen und detaillierter Beschreibungen ausgewählter Werke wie "The Impossibility of Death in the Mind of Someone Living", "Mother and Child (Divided)" und "The Dream". Es analysiert die verwendeten Materialien, Herstellungsverfahren und die Inszenierung der einzelnen Exponate. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Tod und Vergänglichkeit und der daraus resultierenden Konfrontation des Betrachters mit der eigenen Mortalität und der Natur. Durch die detaillierte Betrachtung der ausgewählten Werke wird ein Verständnis für die künstlerische Herangehensweise Hirsts und die vielschichtigen Bedeutungen seiner Arbeiten geschaffen.
3. Das tote, ausgestellte Tier: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rezeptionsgeschichte toter, ausgestellter Tiere in der Kunst und deren spezifische Umsetzung durch Hirst. Es analysiert die Herstellung und Inszenierung der Präparate im Kontext der Kunstgeschichte, um die Einzigartigkeit von Hirsts Ansatz herauszuarbeiten. Die Diskussion beinhaltet die Rolle des Präparates als künstlerisches Material und die Abgrenzung zu naturwissenschaftlichen Darstellungen in zoologischen Museen. Die Analyse der unterschiedlichen Präsentationen und deren Auswirkungen auf die Wahrnehmung des Betrachters steht im Mittelpunkt. Es wird untersucht, wie Hirst die Tradition der Tierdarstellung in der Kunst aufgreift und sie in einen modernen Kontext überführt.
4. Der Mensch-Tier-Dialog: Dieser zentrale Abschnitt erörtert den Mensch-Tier-Dialog als Kernthema der Arbeit und analysiert die Rezeptionsästhetik des toten Tieres im Kontext der Natural History Series. Der Fokus liegt auf dem Wechselspiel zwischen dem Betrachter und dem ausgestellten Tier, das durch die Präparation und Inszenierung eine besondere Form der Kommunikation zulässt. Durch die detaillierte Betrachtung einzelner Tiere ("Der Hai", "Die Kuh und das Kalb", "Das Einhorn") wird exemplarisch gezeigt, wie dieser Dialog funktioniert. Die Rolle des Künstlers als Schöpfer und erster Rezipient seiner Werke wird ebenfalls diskutiert, um die Entstehung und das Verständnis des Dialogs ganzheitlich zu erfassen.
Schlüsselwörter
Damien Hirst, Natural History Series, Rezeptionsästhetik, Mensch-Tier-Dialog, konservierte Tiere, Präparate, Tod, Vergänglichkeit, Kunstgeschichte, Formalin, Inszenierung, Betrachterreaktion.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse der Natural History Series von Damien Hirst
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Mensch-Tier-Dialog in Damien Hirsts Natural History Series. Der Fokus liegt auf der Rezeptionsästhetik konservierter Tiere als Kunstwerke und dem Wechselspiel zwischen Betrachter und dem dargestellten, toten Tier. Die Arbeit untersucht die ästhetische Wirkung der Präparate und die daraus resultierende Interaktion.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Analyse der Rezeptionsästhetik konservierter Tiere in der Kunst und die Erforschung des spezifischen Mensch-Tier-Dialogs in Hirsts Werk. Die Arbeit untersucht die Rolle des Präparates in der Kunstgeschichte und analysiert ausgewählte Werke der Natural History Series. Die Rolle Hirsts als Künstler und erster Rezipient wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Rezeptionsästhetik konservierter Tiere, den Mensch-Tier-Dialog als zentrales Thema in Hirsts Werk, die Rolle des Präparates in der Kunstgeschichte, die Analyse ausgewählter Werke der Natural History Series und Hirsts künstlerische Rolle als Schöpfer und erster Rezipient.
Welche Werke der Natural History Series werden analysiert?
Die Arbeit analysiert exemplarisch drei Werke: "The Impossibility of Death in the Mind of Someone Living", "Mother and Child (Divided)" und "The Dream". Diese dienen als Fallstudien für die Analyse des Mensch-Tier-Dialogs.
Wie wird die Rezeptionsästhetik untersucht?
Die Arbeit verwendet den Begriff der Rezeptionsästhetik nach Wolfgang Kemp als Grundlage der Analyse. Es wird untersucht, wie die Präsentation der Präparate und deren Inszenierung die Wahrnehmung des Betrachters beeinflussen und einen Dialog zwischen Mensch und Tier ermöglichen.
Welche Rolle spielt Damien Hirst in der Analyse?
Hirsts Rolle als Künstler und erster Rezipient seiner Werke wird diskutiert, um die Entstehung und das Verständnis des Mensch-Tier-Dialogs ganzheitlich zu erfassen. Die Arbeit konzentriert sich jedoch nicht auf Hirsts wirtschaftlichen Erfolg oder Kunstbegriffdebatten.
Wie wird der Mensch-Tier-Dialog in der Arbeit dargestellt?
Der Mensch-Tier-Dialog wird als Kernthema der Arbeit betrachtet und durch die detaillierte Analyse der ausgewählten Werke und deren Rezeptionsästhetik erörtert. Der Fokus liegt auf dem Wechselspiel zwischen Betrachter und dem ausgestellten, toten Tier, das durch Präparation und Inszenierung eine besondere Form der Kommunikation zulässt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Die Natural History Series, Das tote, ausgestellte Tier, Der Mensch-Tier-Dialog und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas, beginnend mit einer Einführung in Hirsts Werk und endend mit einer zusammenfassenden Schlussfolgerung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Damien Hirst, Natural History Series, Rezeptionsästhetik, Mensch-Tier-Dialog, konservierte Tiere, Präparate, Tod, Vergänglichkeit, Kunstgeschichte, Formalin, Inszenierung, Betrachterreaktion.
- Quote paper
- Julika Fertig (Author), 2014, Der Mensch-Tier-Dialog in der "Natural History Series" von Damien Hirst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/349104