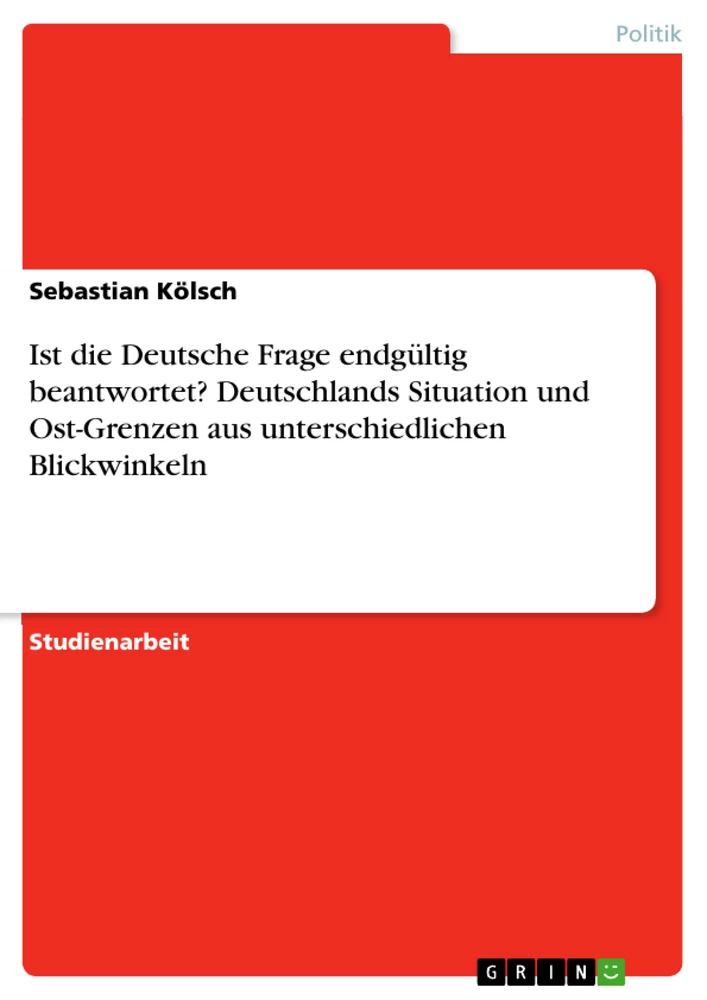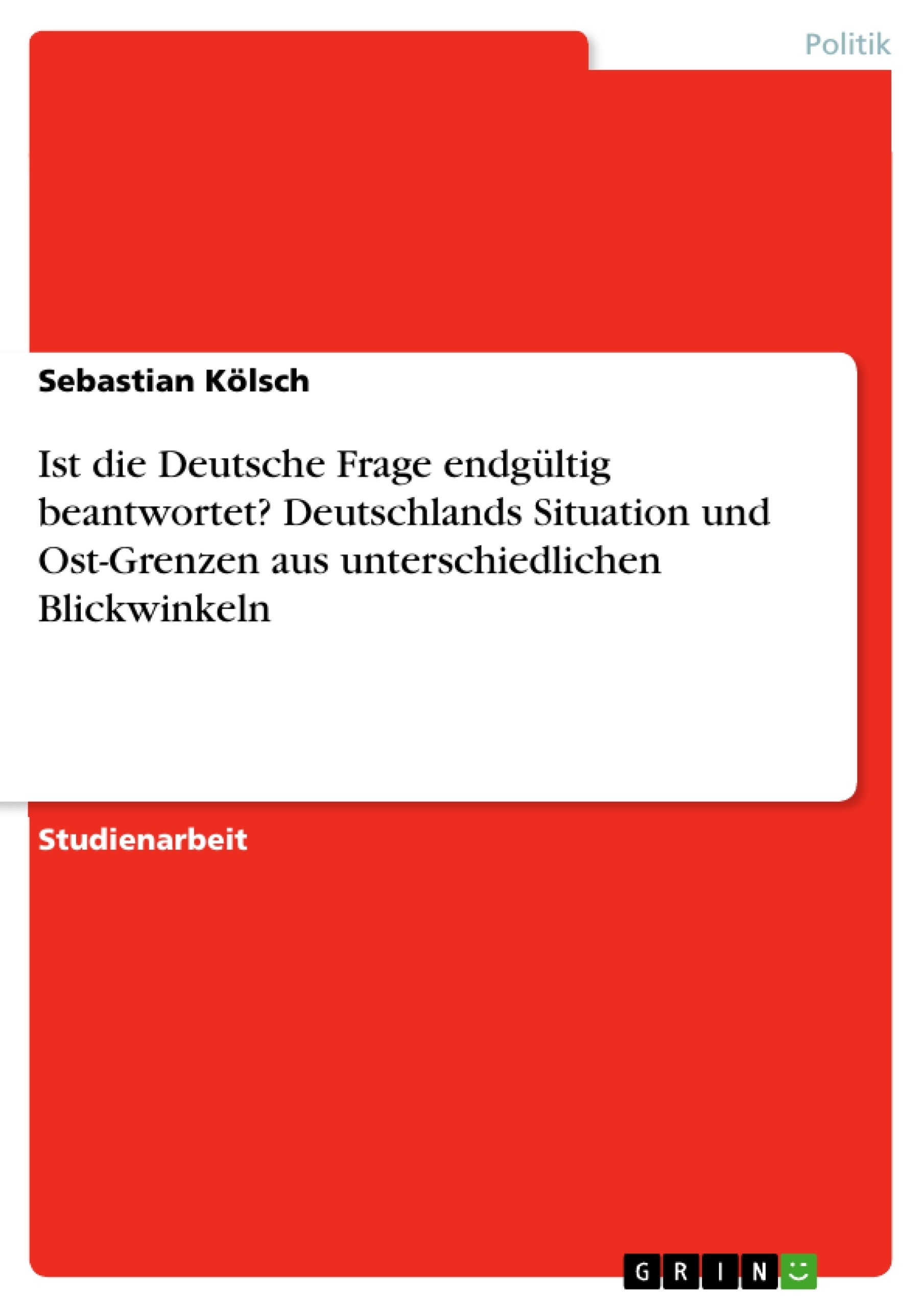,,Die Deutsche Frage bleibt bestehen!" war oftmals die Schlagzeile nach Kongressen der Vertriebenenverbände. Seit der Deutschen Einheit 1990 klingen die Forderungen und Slogans zwar etwas milder, der Grundtenor aber bleibt.
,,Die Deutsche Frage ist beantwortet!" war am 3. Oktober 1990 der Ausruf derer, die im Nachkriegsdeutschland geboren sind, keinen Bezug zu Schlesien oder Ostpreußen haben und somit die Deutsche Frage immer nur auf die Einheit von Bundesrepublik und DDR bezogen hatten.
Im Zuge der Wiedervereinigung kamen Tausende ehemaliger Westbürger nach Brandenburg und Sachsen, nach Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen, nach Sachsen-Anhalt und in den ehemaligen Ostteil Berlins und forderten Grundbesitz und Immobilien zurück, die ihnen oder ihren Vorfahren im Zuge der Verstaatlichung allen Besitzes in der DDR enteignet worden waren - der Einigungsvertrag sah es so vor. Dass viele von ihnen die SBZ bzw. die DDR aus mehr oder weniger freien Stücken verlassen hatten und jetzt trotzdem Rückforderungen stellten, säte mancherorts böses Blut.
Deutsche, die 1945 vor der Roten Armee flüchteten, oder während der Umsiedelung vertrieben wurden, können auch heute noch nicht ihre gezwungenermaßen aufgegebenen Häuser und Höfe, die jetzt in Polen oder Russland liegen, zurück fordern oder dafür Entschädigung verlangen. Auch das sieht der dem Einigungsvertrag zu Grunde liegende 2+4-Vertrag so vor. Und auch das sät bei vielen Vertriebenen natürlich böses Blut.
Wie kam es überhaupt dazu, unter Wiedervereinigung lediglich die Einigung von Bundesrepublik (alt) und DDR ohne ehemalige Ostgebiete zu verstehen? War dies nicht doch nur eine Teileinigung - vom Staat durch Verzichtserklärungen erkauft? Oder sollte jeder einzelne heute im Zeitalter von EU- und NATO-Öffnung nach Osten und im Bewusstsein, dass unter deutscher Herrschaft gerade Osteuropa brutal gelitten hat, für sich den status quo im Interesse des Friedens endlich anerkennen - auch wenn die Eltern aus Königsberg stammen?
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Die Deutsche Frage im Lauf der Geschichte
- 2.1 Der Wandel der deutschen Außengrenzen
- 2.2 1918: Gebietsverluste mit Folgen
- 2.3 Erste Pläne für ein Nachkriegsdeutschland und Besatzung
- 2.4 Der administrative Neubeginn
- 2.5 Zwei deutsche Staaten aber nicht das gesamte Territorium
- 3. Die Deutsche Frage im Nachkriegsdeutschland
- 3.1 Staatsziel Nummer eins: die staatliche Einheit
- 3.2 Das Scheitern verschiedener Vorschläge
- 3.3 Normalisierung und Anerkennung des status quo
- 3.4 Die friedliche Revolution wird zur Wiedervereinigung
- 4. Die Wiedervereinigung - eine Teilvereinigung?
- 4.1 Das Bewusstsein für „Deutschland als Ganzes“
- 4.2 Bedenken und Vorbehalte im Ausland
- 4.3 Der Verzicht auf Gebiets- und Besitzansprüche
- 5. Was ist Deutschland heute?
- 5.1 "...in den Grenzen von 1937"
- 5.2 Von der Flexibilität eines Staates
- 5.3 Generationenkonflikt
- 6. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die „Deutsche Frage“ im Kontext der deutschen Geschichte, insbesondere im Hinblick auf die an Polen und die UdSSR abgetretenen Gebiete nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie beleuchtet die verschiedenen Perspektiven auf die Wiedervereinigung und die Frage, ob diese eine vollständige oder nur eine Teilvereinigung darstellt. Die Arbeit hinterfragt den Verzicht auf Gebietsansprüche und analysiert die anhaltende Bedeutung der „deutschen Frage“ im heutigen Deutschland.
- Der Wandel der deutschen Grenzen im Laufe der Geschichte
- Die unterschiedlichen Interpretationen der „Deutschen Frage“ nach 1945
- Die Rolle der Vertriebenen und ihre Ansprüche auf enteignetes Eigentum
- Die Wiedervereinigung als Prozess der Teilvereinigung
- Die Akzeptanz des Status quo angesichts der historischen Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der endgültigen Beantwortung der „Deutschen Frage“ in den Kontext unterschiedlicher Sichtweisen. Sie verdeutlicht den Konflikt zwischen der Perspektive derer, die die Wiedervereinigung als Abschluss der „Deutschen Frage“ betrachten, und derjenigen, die die anhaltenden Ansprüche der Vertriebenen und die Frage der verlorenen Ostgebiete betonen. Der Fokus liegt auf den an Polen und die UdSSR abgetretenen Gebieten, deren Status im Einigungsvertrag eine zentrale Rolle spielt. Die Einleitung liefert damit einen vielschichtigen Einblick in die Problematik und skizziert die zentralen Diskussionspunkte der Arbeit.
2. Die Deutsche Frage im Lauf der Geschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der deutschen Grenzen, die durch zahlreiche Veränderungen geprägt war. Es betont die Kleinstaaterei im Heiligen Römischen Reich und die spätere Vereinigung Deutschlands im Jahr 1871. Der Abschnitt über die Gebietsverluste von 1918 nach dem Ersten Weltkrieg hebt die Folgen dieses Ereignisses für die nationale Identität hervor und führt direkt in die komplexen Herausforderungen der Nachkriegszeit über. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der historischen Entwicklung der „Deutschen Frage“ und ihrer anhaltenden Relevanz.
3. Die Deutsche Frage im Nachkriegsdeutschland: Dieses Kapitel analysiert die „Deutsche Frage“ im Kontext des geteilten Deutschlands. Es beschreibt das staatliche Ziel der Wiedervereinigung, das Scheitern verschiedener Lösungsansätze und den allmählichen Prozess der Normalisierung und Anerkennung des Status quo. Die friedliche Revolution von 1989/90 und deren Einfluss auf die Wiedervereinigung stehen im Mittelpunkt. Der Kapitelzusammenhang verdeutlicht die langwierigen Bemühungen um die Wiedervereinigung und die komplexen politischen und gesellschaftlichen Prozesse, die damit verbunden waren.
4. Die Wiedervereinigung - eine Teilvereinigung?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, ob die Wiedervereinigung eine vollständige oder nur eine Teilvereinigung war. Es analysiert das Bewusstsein für „Deutschland als Ganzes“, die Bedenken und Vorbehalte im Ausland sowie den Verzicht auf Gebietsansprüche. Der Abschnitt verdeutlicht die komplexen Verhandlungen und Kompromisse, die zur Wiedervereinigung führten, sowie die anhaltenden Debatten über deren Vollständigkeit.
5. Was ist Deutschland heute?: Das Kapitel untersucht den gegenwärtigen Zustand Deutschlands im Kontext der historischen Entwicklung. Es diskutiert die anhaltende Bedeutung der Grenzen von 1937, die Flexibilität des deutschen Staates und den Generationenkonflikt bezüglich der „Deutschen Frage“. Die Kapitelzusammenfassung verdeutlicht die anhaltende Relevanz historischer Ereignisse für die heutige Identität und Politik Deutschlands.
Schlüsselwörter
Deutsche Frage, Wiedervereinigung, Ostgebiete, Vertreibung, Gebietsverluste, Polen, UdSSR, Einigungsvertrag, 2+4-Vertrag, nationale Identität, Status quo, Generationenkonflikt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Die Deutsche Frage
Was ist der Inhalt des Dokuments "Die Deutsche Frage"?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die "Deutsche Frage", insbesondere im Hinblick auf die nach dem Zweiten Weltkrieg an Polen und die UdSSR abgetretenen Gebiete. Es behandelt die historische Entwicklung der deutschen Grenzen, die unterschiedlichen Perspektiven auf die Wiedervereinigung und die Frage, ob diese eine vollständige oder nur eine Teilvereinigung darstellt. Weitere Schwerpunkte sind der Verzicht auf Gebietsansprüche und die anhaltende Bedeutung der "Deutschen Frage" im heutigen Deutschland.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Einführung, 2. Die Deutsche Frage im Lauf der Geschichte, 3. Die Deutsche Frage im Nachkriegsdeutschland, 4. Die Wiedervereinigung - eine Teilvereinigung?, 5. Was ist Deutschland heute?, und 6. Ausblick. Jedes Kapitel wird im Dokument zusammengefasst.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind der Wandel der deutschen Grenzen im Laufe der Geschichte, die unterschiedlichen Interpretationen der "Deutschen Frage" nach 1945, die Rolle der Vertriebenen und ihre Ansprüche auf enteignetes Eigentum, die Wiedervereinigung als Prozess der Teilvereinigung und die Akzeptanz des Status quo angesichts der historischen Entwicklung.
Wie wird die Wiedervereinigung im Dokument betrachtet?
Die Wiedervereinigung wird kritisch hinterfragt, indem die Frage gestellt wird, ob sie eine vollständige oder nur eine Teilvereinigung war. Das Dokument beleuchtet das Bewusstsein für "Deutschland als Ganzes", die Bedenken und Vorbehalte im Ausland und den Verzicht auf Gebietsansprüche im Kontext der Wiedervereinigung.
Welche Rolle spielen die an Polen und die UdSSR abgetretenen Gebiete?
Die an Polen und die UdSSR abgetretenen Gebiete nach dem Zweiten Weltkrieg bilden einen zentralen Fokus des Dokuments. Der Status dieser Gebiete im Einigungsvertrag und die anhaltenden Ansprüche der Vertriebenen werden ausführlich diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Deutsche Frage, Wiedervereinigung, Ostgebiete, Vertreibung, Gebietsverluste, Polen, UdSSR, Einigungsvertrag, 2+4-Vertrag, nationale Identität, Status quo, Generationenkonflikt.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument untersucht die "Deutsche Frage" im Kontext der deutschen Geschichte, beleuchtet verschiedene Perspektiven auf die Wiedervereinigung und hinterfragt den Verzicht auf Gebietsansprüche. Es analysiert die anhaltende Bedeutung der "Deutschen Frage" im heutigen Deutschland.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, das Dokument enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die Kernaussagen und den jeweiligen Fokus jedes Abschnitts hervorhebt.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Das Dokument ist relevant für alle, die sich mit der deutschen Geschichte, insbesondere der "Deutschen Frage", der Wiedervereinigung und den damit verbundenen historischen und politischen Aspekten auseinandersetzen möchten. Es eignet sich für akademische Zwecke und das vertiefte Verständnis der Thematik.
- Quote paper
- Sebastian Kölsch (Author), 2000, Ist die Deutsche Frage endgültig beantwortet? Deutschlands Situation und Ost-Grenzen aus unterschiedlichen Blickwinkeln, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3484