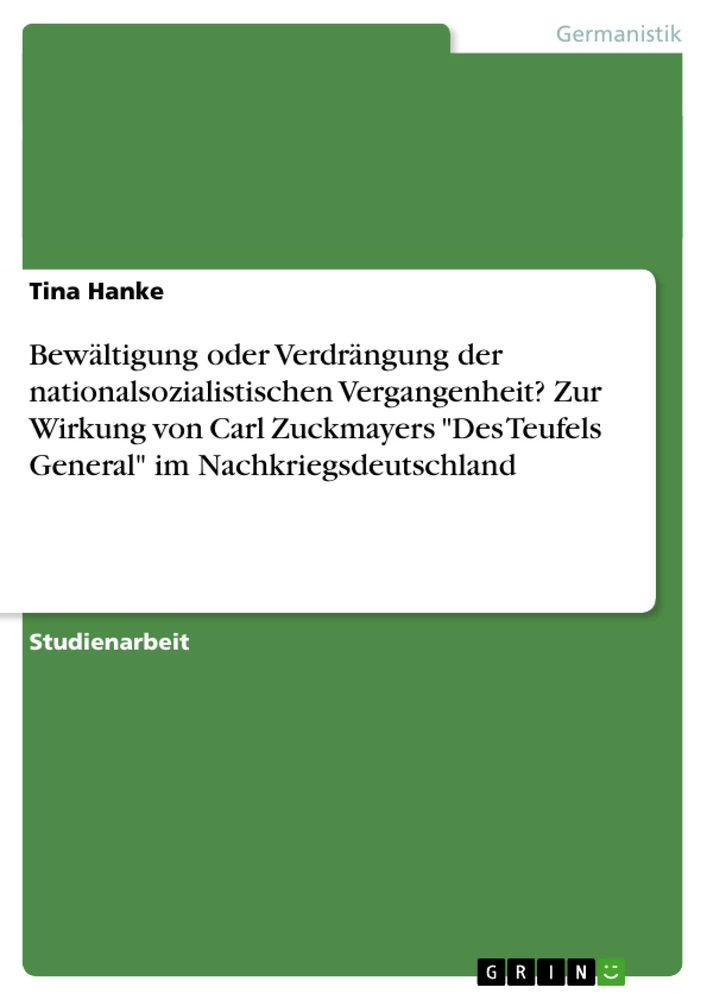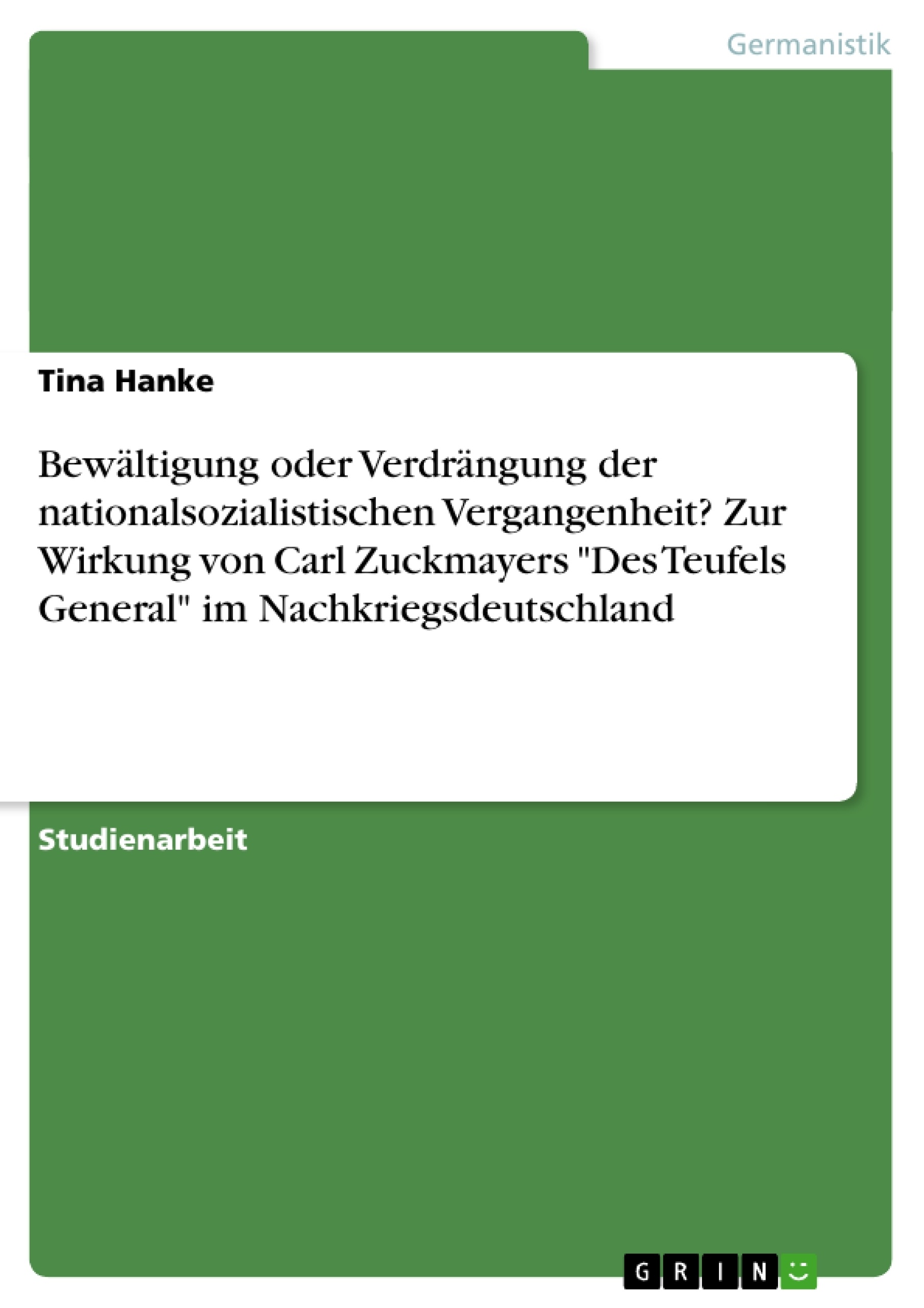Im Dezember des Jahres 1941 [...] war in den amerikanischen Zeitungen eine kurze Notiz erschienen: Ernst Udet, Generalluftzeugmeister der deutschen Armee, sei beim Ausprobieren einer neuen Waffe tödlich verunglückt und mit Staatsbegräbnis beerdigt worden. Sonst nichts. Es gab keine Kommentare, keine Mutmaßungen über seinen Tod. Verunglückt. Staatsbegräbnis. [...] Jetzt, an einem Spätherbsttag im Jahre 1942, ein Jahr nach Udets Tod, stieg ich mit meinem Tragkorb zur Farm hinaus. [...] Auf einmal blieb ich stehen. 'Staatsbegräbnis', sagte ich laut. Das letzte Wort der Tragödie.1 So erinnert sich Carl Zuckmayer in Als wär’s ein Stück von mir an den Anlass und die Umstände, die zur Entstehung seines umstrittenen Exildramas Des Teufels General geführt haben. Aus diesem Bericht ist nicht nur zu entnehmen, dass das Drama vom Schluss her konzipiert ist - lautet das letzte Wort des Stückes doch tatsächlich „Staatsbegräbnis“-, sondern er belegt, dass es für die Titelgestalt ein historisches Vorbild gibt: den draufgängerischen Fliegergeneral und Freund Zuckmayers Ernst Udet (1896-1941), der nach seiner Niederlage in der Schlacht um England im Winter 1940/41 zum Sündenbock der NS-Regierung wurde und daraufhin Selbstmord beging. Bereits 1933 trat Udet, verführt vom Luftfahrtsminister Hermann Göring, der ihm zwei moderne amerikanische Kampfflugzeuge geschenkt hatte, in die NSDAP ein, distanzierte sich im Freundeskreis jedoch stets vom NS-Regime. Die zentrale Figur in Zuckmayers Drama, der sympathische Fliegerheld Harras, ist zwar kein Parteimitglied, verfügt aber über genau dieselbe Doppelmoral wie ihr historisches Vorbild, was Zuckmayers Drama bis heute immer wieder ins Kreuzfeuer der Kritik geraten lässt. Denn trotz tiefster Verachtung für das NS-Regime lässt sich der „Gesinnungslump“ Harras von ihm tragen, da es ihm Aufstieg, Entfaltungsmöglichkeiten und Siege als Flieger verschafft. Entscheidend ist jedoch, dass der Titelheld trotz all des Grauens, das auch in seinem Namen geschieht, und trotz all seiner Fehler, durch und durch sympathisch wirkt. Gutgelaunt und genussfreudig tummelt er sich auf Parties, wo er gerne einmal einen über den Durst trinkt und nebenbei ein paar gewagte Sprüche über die Nazis klopft, avanciert zum Frauenheld und zeigt sich stets von seiner menschlichsten Seite. [...] 1 Zuckmayer 1966, S.548
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Zur Wirkung von Des Teufels General in der Nachkriegszeit
- Individualpsychologischer Ansatz
- General Harras als ideale Identifikationsfigur
- Freuds Deutung der Opferlammphantasie
- Soziopsychologischer Ansatz
- Die Spaltung der Figuren in „gut“ und „böse“
- Infantiler Abwehrmechanismus nach Margaret Mahler
- „Sie-Täter“ kontra „Wir-Opfer“ in der Verfilmung von 1955
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wirkung von Carl Zuckmayers "Des Teufels General" im Nachkriegsdeutschland. Sie analysiert den Erfolg des Stücks unter Berücksichtigung individualpsychologischer und soziopsychologischer Aspekte und beleuchtet die kontroversen Reaktionen auf das Drama in Ost und Westdeutschland.
- Die Identifikationsmöglichkeiten der Nachkriegsgesellschaft mit der Figur des General Harras
- Die psychologischen Mechanismen der Bewältigung der nationalsozialistischen Vergangenheit im Kontext des Stücks
- Die soziopolitische Bedeutung des Dramas und seine Rezeption in Ost- und Westdeutschland
- Die Darstellung von Schuld und Verantwortung im Kontext des NS-Regimes
- Der Einfluss von "Des Teufels General" auf die deutsche Nachkriegsgesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Zur Wirkung von Des Teufels General in der Nachkriegszeit: Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der Entstehung von Zuckmayers Drama "Des Teufels General", ausgehend von der Erinnerung des Autors an den Tod Ernst Udets. Sie stellt die zentrale Figur General Harras vor und skizziert die kontroverse Rezeption des Stücks im Nachkriegsdeutschland, die von enthusiastischen Zuschauerzahlen im Westen bis zur Ablehnung in der sowjetischen Besatzungszone reichte. Die Einleitung leitet die Notwendigkeit einer interdisziplinären Analyse ein, die über rein literaturwissenschaftliche Ansätze hinausgeht.
Individualpsychologischer Ansatz: Dieses Kapitel untersucht die Wirkung des Stücks aus individualpsychologischer Perspektive. Es analysiert General Harras als eine potentielle Identifikationsfigur für das Nachkriegsdeutschland, in dem sich viele Menschen mit der Ambivalenz und der moralischen Grauzone der Figur identifizieren konnten. Der Bezug auf Freuds Theorie der Opferlammphantasie wird herangezogen, um die psychologischen Mechanismen der Zuschauerreaktionen zu ergründen und die emotionale Resonanz des Stücks zu erklären.
Soziopsychologischer Ansatz: Das Kapitel beleuchtet die soziopsychologischen Aspekte der Rezeption von "Des Teufels General". Es analysiert die Darstellung von Gut und Böse im Stück und deren Auswirkungen auf das Publikum. Der infantile Abwehrmechanismus nach Margaret Mahler wird verwendet, um die Verarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit durch die deutsche Gesellschaft zu beleuchten. Die Analyse der Verfilmung von 1955 und der damit verbundenen "Sie-Täter"/"Wir-Opfer"-Dynamik verdeutlicht die komplexen sozialen und politischen Dimensionen der Rezeption des Dramas.
Schlüsselwörter
Des Teufels General, Carl Zuckmayer, Nachkriegsdeutschland, NS-Vergangenheit, Identifikation, Schuld, Verantwortung, Individualpsychologie, Soziopsychologie, Rezeption, Doppelmoral, Bewältigung, Verdrängung, Gruppenidentität.
Häufig gestellte Fragen zu "Des Teufels General": Eine psychologische und soziologische Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Wirkung von Carl Zuckmayers Drama "Des Teufels General" im Nachkriegsdeutschland. Sie untersucht den Erfolg des Stücks unter individualpsychologischen und soziopsychologischen Gesichtspunkten und beleuchtet die kontroversen Reaktionen in Ost und Westdeutschland.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit den Identifikationsmöglichkeiten der Nachkriegsgesellschaft mit General Harras, den psychologischen Mechanismen der NS-Vergangenheitsbewältigung im Kontext des Stücks, der soziopolitischen Bedeutung und Rezeption in Ost- und Westdeutschland, der Darstellung von Schuld und Verantwortung im NS-Regime und dem Einfluss des Dramas auf die deutsche Nachkriegsgesellschaft.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Analyse kombiniert individualpsychologische und soziopsychologische Perspektiven. Der individualpsychologische Ansatz untersucht die Identifikation mit General Harras und bezieht Freuds Opferlammphantasie mit ein. Der soziopsychologische Ansatz analysiert die Darstellung von Gut und Böse, den infantilen Abwehrmechanismus nach Margaret Mahler und die "Sie-Täter"/"Wir-Opfer"-Dynamik in der Verfilmung von 1955.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die den historischen Kontext und die kontroverse Rezeption des Stücks beschreibt. Es folgen Kapitel zum individualpsychologischen und soziopsychologischen Ansatz, die die jeweiligen Perspektiven detailliert untersuchen. Die Arbeit schließt mit einem Resümee.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt die Einleitung mit dem historischen Kontext und der kontroversen Rezeption. Das Kapitel zum individualpsychologischen Ansatz analysiert General Harras als Identifikationsfigur und bezieht Freuds Opferlammphantasie ein. Das soziopsychologische Kapitel beleuchtet die Darstellung von Gut und Böse, den Abwehrmechanismus nach Mahler und die "Sie-Täter"/"Wir-Opfer"-Dynamik in der Verfilmung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Des Teufels General, Carl Zuckmayer, Nachkriegsdeutschland, NS-Vergangenheit, Identifikation, Schuld, Verantwortung, Individualpsychologie, Soziopsychologie, Rezeption, Doppelmoral, Bewältigung, Verdrängung, Gruppenidentität.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Germanistik, Geschichte, Psychologie und Soziologie, die sich mit der deutschen Nachkriegsgeschichte, der NS-Vergangenheitsbewältigung und der Wirkungsgeschichte von Literatur auseinandersetzen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Diese FAQ bietet einen Überblick. Für detaillierte Informationen wird auf den vollständigen Text verwiesen (der in dieser HTML-Datei oben enthalten ist).
- Quote paper
- Tina Hanke (Author), 1999, Bewältigung oder Verdrängung der nationalsozialistischen Vergangenheit? Zur Wirkung von Carl Zuckmayers "Des Teufels General" im Nachkriegsdeutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34816