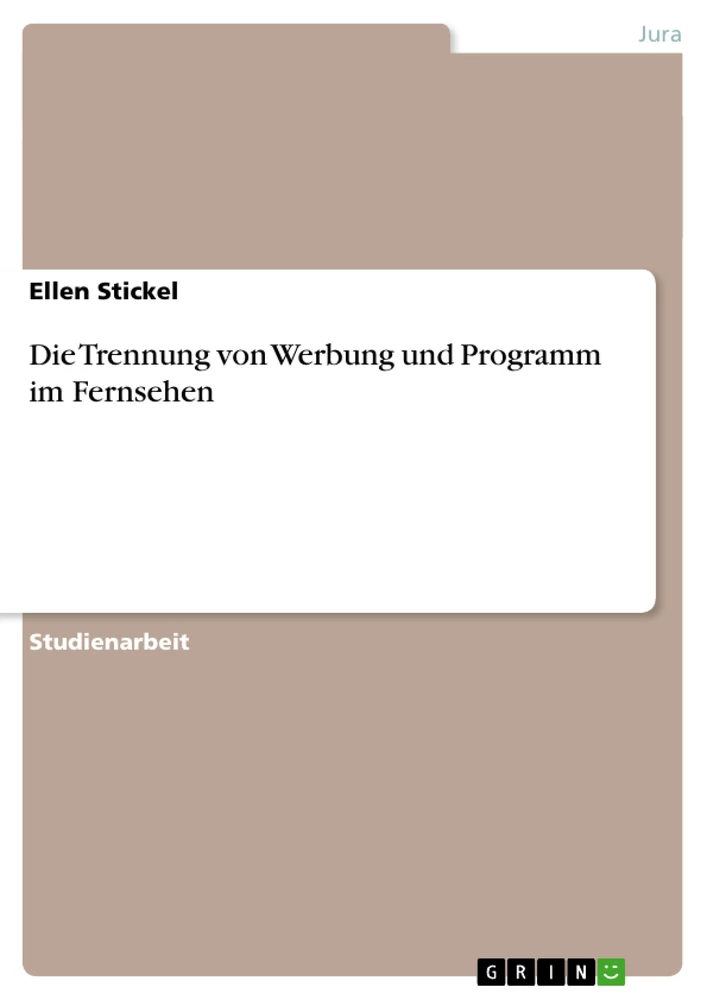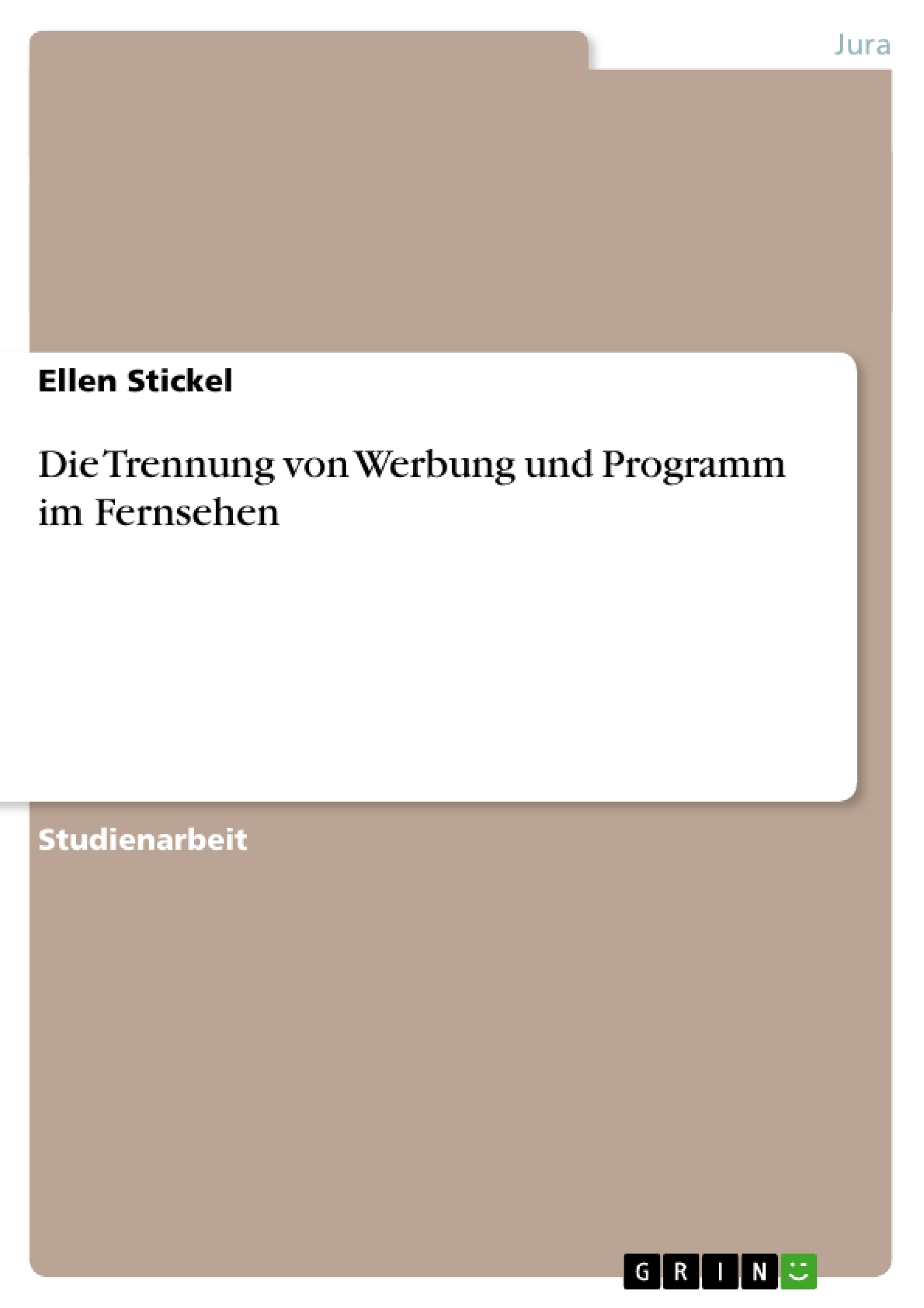Die heutige Medienlandschaft in Deutschland ist durchzogen von immer neuen Werbebotschaften und Marketingeffekten. In den Printmedien wird für Immobilien und Autos geworben, im Radio läuft die Werbung für Milchprodukte vom Bio-Bauern und im Internet werben Banner für Versicherungen oder die neuesten Musik-Downloads. Ein besonders großes Stück vom Werbekuchen entfällt auf das Fernsehen. Ein Fünftel aller Werbeeinnahmen in der Bundesrepublik, immerhin mehr als 20.000 Millionen Euro, wurden 2002 durch Werbespots im TV erzielt. 1
Bei dieser immensen Nachfrage nach Sendezeit durch Wirtschaftsunternehmen stellt sich die Frage, wie Werbung und Programm zusammengehen, ohne sich gegenseitig zu behindern oder auszuschließen. Oberste Maxime zumindest des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist es, eine Bildungsfunktion für die Bürger zu übernehmen. Dies schließt Wirtschaftswerbung in allzu großem Umfang aus. Doch vor allem private Sender sind bei ihrer Finanzierung existenziell auf Werbeeinnahmen angewiesen, da sie keinen Zugriff auf Rundfunkgebühren haben wie die öffentlich-rechtlichen Sender. Der Gesetzgeber und auch die Europäische Gemeinschaft haben d eshalb Regeln aufgestellt, die eine zu große Beeinflussung des Programms durch die Werbetreibenden oder auch durch die Programmveranstalter selbst verhindern sollen. In dieser Arbeit sollen die grundlegenden Rechtsnormen vorgestellt werden, die ein ausgewogenes Miteinander von Programm und Werbung garantieren sollen: Das Grundgesetz, die Rundfunkstaatsverträge und die Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft. Weiter soll der aktuelle Fernseh-Werbemarkt im Hinblick auf die zurzeit hauptsächlich genutzten Werbeformen untersucht werden und ein nachfolgender kurzer Abriss von modernen Sonderwerbeformen soll zeigen, dass die bisher gültigen Rechtsnormen nicht zwangsläufig auch für alle künftigen Werbeideen praktikabel sind.
Der Grund für die Vielzahl neuartiger Werbeformen ist, dass die Werbungsdichte im deutschen Fernsehen von Jahr zu Jahr steigt. Die Anzahl der ausgestrahlten Spots wird immer größer. Es wird deshalb immer schwerer, die Aufmerksamkeit der Rezipienten auf ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Spot zu lenken. Die Fernsehzuschauer sind übersättigt von zuviel Werbung, die Fernbedienung ist das ideale Mittel, um unliebsame Werbeunterbrechungen einfach weg zu zappen. Zudem gibt eine immer größere Anzahl von Sendern den Zuschauern immer mehr Auswahlmöglichkeiten.
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung
- B Die Trennung von Fernsehprogramm und Werbesendungen
- 1) Bedeutung der Werbung für Öffentlich-rechtliche und private Rundfunkbetreiber
- 2) Einzelne Werbeformen im Überblick
- 3) Die werberechtlichen Grundlagen
- 4) Regulierungsprobleme seit Beginn des Werbefernsehens
- 5) Grauzonen und Lücken im Normenkatalog
- C Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Trennung von Werbung und Programm im deutschen Fernsehen. Sie beleuchtet die Bedeutung von Werbung für öffentlich-rechtliche und private Sender, analysiert verschiedene Werbeformen und deren rechtliche Grundlagen, und geht auf Regulierungsprobleme und Grauzonen im bestehenden Rechtsrahmen ein. Die Arbeit zielt darauf ab, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Programm und Werbung darzustellen.
- Bedeutung der Werbung für die Finanzierung des Fernsehens
- Entwicklung und Vielfalt von Werbeformen im Fernsehen
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Fernsehwerbung (Grundgesetz, Rundfunkstaatsverträge, EG-Richtlinien)
- Herausforderungen der Regulierung durch neue Werbeformen
- Grauzonen und Lücken im bestehenden Rechtsrahmen
Zusammenfassung der Kapitel
A Einleitung: Die Einleitung beschreibt die omnipräsente Rolle von Werbung in der modernen Medienlandschaft, besonders im Fernsehen. Sie hebt die immense Bedeutung von Werbeeinnahmen für private Sender hervor und betont den Spagat zwischen der Notwendigkeit von Werbung zur Finanzierung und dem Erhalt der Unabhängigkeit und Bildungsfunktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Arbeit kündigt die Untersuchung grundlegender Rechtsnormen sowie eine Analyse aktueller und zukünftiger Werbeformen an, die die bestehenden Regelungen herausfordern.
B Die Trennung von Fernsehprogramm und Werbesendungen: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Fernsehwerbung in Deutschland, beginnend mit den ersten Werbespots in den 1950er Jahren. Es beleuchtet die unterschiedlichen Interessenlagen von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowie die Auseinandersetzungen zwischen Verlegern und Fernsehveranstaltern um Werbezeiten. Die Einführung des Farbfernsehens und der privaten Sender wird als wichtige Wendepunkte im Kontext der Werbeentwicklung dargestellt. Das Kapitel unterstreicht die Notwendigkeit einer Balance zwischen den ökonomischen Interessen der Sender und dem Schutz vor einer Überflutung mit Werbung. Es zeigt wie die zunehmende Werbedichte die Aufmerksamkeit der Zuschauer beeinflusst und neue Werbeformen hervorbringt die die bestehenden rechtlichen Regelungen in Frage stellen.
Schlüsselwörter
Fernsehwerbung, Rundfunkrecht, Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Privatsender, Werbeformen, Regulierung, Grundgesetz, Rundfunkstaatsverträge, EG-Fernsehrichtlinien, Grauzonen, Werbewirkungsforschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Trennung von Fernsehprogramm und Werbesendungen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Trennung von Werbung und Programm im deutschen Fernsehen. Sie analysiert die Bedeutung von Werbung für öffentlich-rechtliche und private Sender, verschiedene Werbeformen und deren rechtliche Grundlagen, sowie Regulierungsprobleme und Grauzonen im bestehenden Rechtsrahmen. Ziel ist die Darstellung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Programm und Werbung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung der Werbung für die Finanzierung des Fernsehens, der Entwicklung und Vielfalt von Werbeformen, den rechtlichen Rahmenbedingungen (Grundgesetz, Rundfunkstaatsverträge, EG-Richtlinien), den Herausforderungen der Regulierung durch neue Werbeformen und Grauzonen im bestehenden Rechtsrahmen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung (A), ein Hauptkapitel über die Trennung von Fernsehprogramm und Werbesendungen (B) und ein Fazit (C). Kapitel B unterteilt sich in Unterkapitel zur Bedeutung der Werbung für Sender, einen Überblick über Werbeformen, die werberechtlichen Grundlagen, Regulierungsprobleme und Grauzonen im Normenkatalog.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt die omnipräsente Rolle von Werbung im Fernsehen, die Bedeutung von Werbeeinnahmen für private Sender und den Spagat zwischen Werbung und der Unabhängigkeit/Bildungsfunktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie kündigt die Untersuchung von Rechtsnormen und die Analyse aktueller und zukünftiger Werbeformen an.
Worüber handelt Kapitel B ("Die Trennung von Fernsehprogramm und Werbesendungen")?
Kapitel B analysiert die Entwicklung der Fernsehwerbung in Deutschland, die unterschiedlichen Interessenlagen öffentlich-rechtlicher und privater Sender, die Auseinandersetzungen um Werbezeiten, die Einflüsse von Farbfernsehen und privaten Sendern, die Balance zwischen ökonomischen Interessen und dem Schutz vor Werbungsüberflutung, und wie zunehmende Werbedichte die Aufmerksamkeit der Zuschauer und die bestehenden rechtlichen Regelungen beeinflusst.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind Fernsehwerbung, Rundfunkrecht, Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Privatsender, Werbeformen, Regulierung, Grundgesetz, Rundfunkstaatsverträge, EG-Fernsehrichtlinien, Grauzonen und Werbewirkungsforschung.
- Quote paper
- M.A. Ellen Stickel (Author), 2004, Die Trennung von Werbung und Programm im Fernsehen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34780