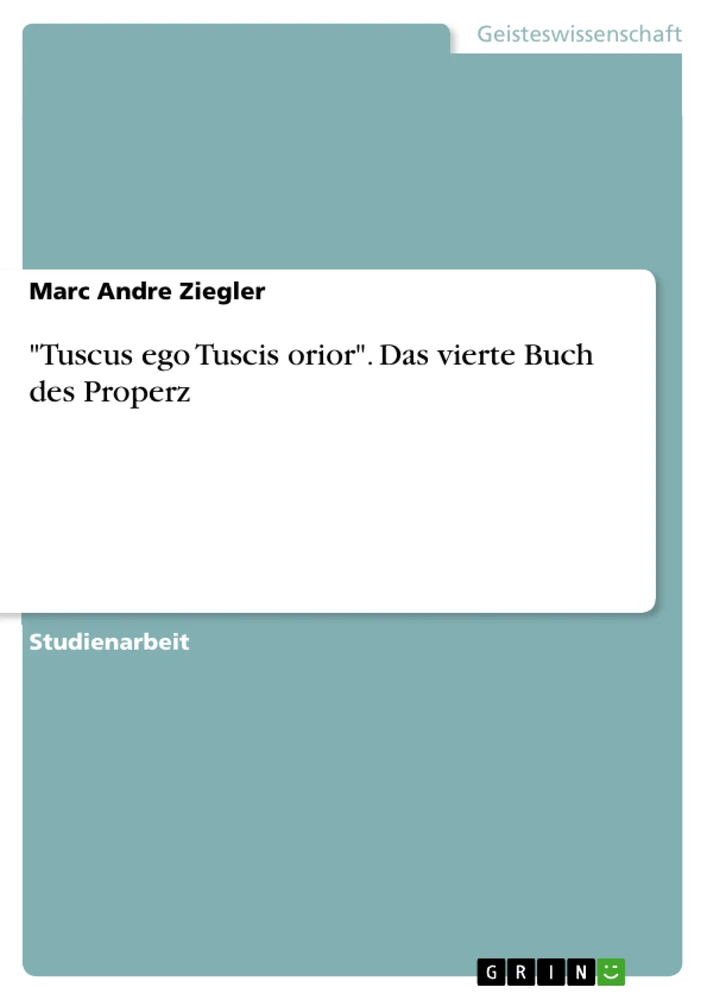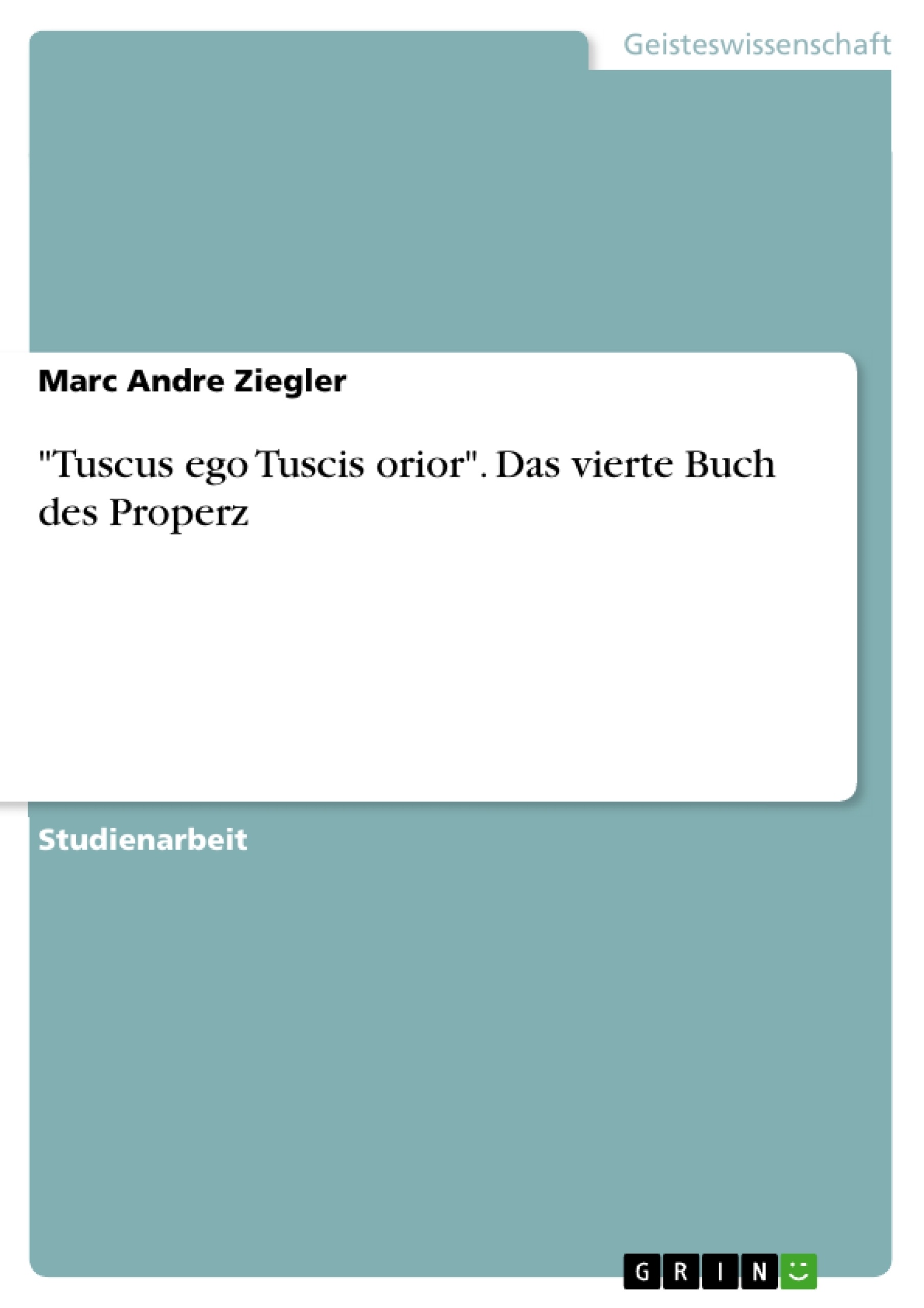In der vorliegenden Arbeit geht es um das vierte Buch der Elegien des Propertius, das hier analysiert und interpretiert wird, nachdem eingangs ein biographischer Überblick über das Leben des Dichters erfolgt.
Im Unterschied zu seinem „üblichen“ Thema, der Liebe, widmet sich Propertius im vierten Buch seiner Elegien abwechselnd auch dem römischen Mythos. Das gesamte Buch ist ein Hin und Her zwischen Liebe und Mythos. Dieser Wechselcharakter zeigt sich bereits im ersten Gedicht des Buches, welches in zwei thematisch unterschiedlich strukturierte Hälften geteilt ist.
Die Elegie gliedert sich in mehrere Teile. Zunächst erfolgt eine Ansprache an den imaginären Passanten, der an der Statue vorüber schreitet. Dieser Einleitung folgt eine erste Vorstellung des lyrischen Ichs. Im Zentrum des Gedichtes stehen drei Etymologien von Vertumnus' Namen. Propertius erzählt zunächst zwei Varianten, die seiner Meinung nach nicht richtig sind, ehe er die wahre Identität des Gottes erläutert. Der letzte Abschnitt beginnt mit einem Exkurs zur Vergangenheit und Zukunft des Gottes bzw. der Statue, bevor am Ende eine Hommage an den Bildner Mamurius steht. Die Sprache ist funktional.
Sprachliche wie inhaltliche Eigenschaften des vierten Buches werden hier einer genauen Untersuchung unterzogen.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Person des Propertius
- Mythologische Figuren
- Vertumnus
- Tatius (Tati, Prop. IV 2, 52)
- Lucumo (Lycomedius, Prop. IV 2, 51)
- Metrische Analyse
- Textkritik
- Qui (Prop. IV 2, 1)
- praecepimus (Prop. IV 2, 11)
- †pastorem† ad baculum possum †curare† (Prop. IV 2, 39)
- Grammatische Besonderheiten
- Übersetzung
- Interpretation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Belegarbeit von Marc Andre Ziegler befasst sich mit dem vierten Buch des römischen Dichters Properz und analysiert dessen Elegie IV 2, welche den Kult des Gottes Vertumnus thematisiert. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die sprachlichen und inhaltlichen Besonderheiten des Gedichts herauszuarbeiten und somit einen Einblick in die dichterische Kunst Properzens zu ermöglichen.
- Die Person des Propertius und sein literarisches Schaffen
- Die mythologische Figur des Vertumnus und seine Bedeutung im römischen Kult
- Die sprachliche und metrische Gestaltung des Gedichts
- Die Interpretation der Elegie und ihre Bedeutung im Kontext der römischen Kultur
- Die Textkritik und die Herausforderungen der Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit widmet sich der Biografie Properzens und beleuchtet seine literarischen Einflüsse und seine literarische Karriere. Das zweite Kapitel analysiert die mythologischen Figuren Vertumnus, Tatius und Lucumo, die in Properzens Elegie IV 2 eine zentrale Rolle spielen. Kapitel drei befasst sich mit der metrischen Analyse des Gedichts und identifiziert die Besonderheiten der Versstruktur und der Sprache. Kapitel vier behandelt die Textkritik und untersucht verschiedene Textvarianten, die für die Interpretation relevant sind. Das fünfte Kapitel analysiert grammatische Besonderheiten der Elegie. Kapitel sechs liefert eine vollständige Übersetzung des Textes, die die komplexen Strukturen und sprachlichen Nuancen der Elegie für den Leser zugänglich machen soll. Das siebte Kapitel ist der Interpretation der Elegie gewidmet und beleuchtet die zentralen Themen, die in den Versen behandelt werden. Die Arbeit zeichnet ein umfassendes Bild von Properzens literarischem Schaffen und seinem Umgang mit mythologischen Themen, wobei sie die Bedeutung der Elegie IV 2 für das Verständnis des römischen Kulturkreises in den Vordergrund stellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Elegie IV 2 des römischen Dichters Properz. Zentrale Themen sind die mythologische Figur des Vertumnus, die Interpretation des Gedichts im Kontext der römischen Kultur und die Untersuchung der sprachlichen Besonderheiten und der metrischen Struktur des Textes. Die Arbeit analysiert verschiedene literarische Elemente wie Enjambements, Alliterationen und Chiasmen und beleuchtet die Bedeutung der Textkritik und der Herausforderungen der Interpretation. Die Arbeit zielt darauf ab, das literarische Schaffen Properzens und seine künstlerische Gestaltung von Mythos und Sprache zu beleuchten.
- Quote paper
- Marc Andre Ziegler (Author), 2006, "Tuscus ego Tuscis orior". Das vierte Buch des Properz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/347159