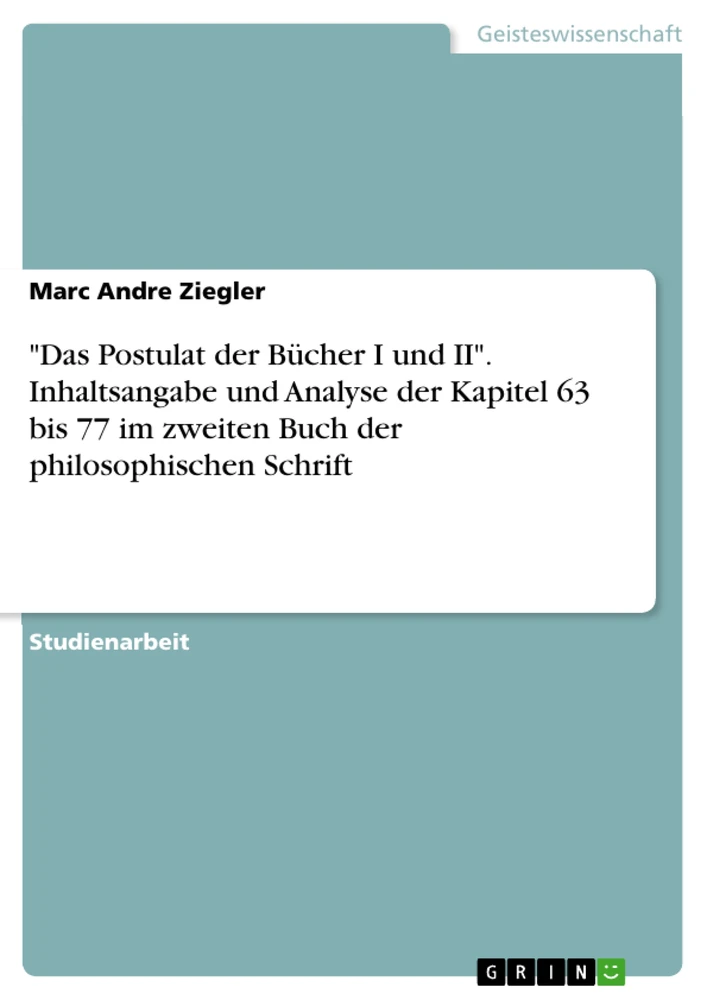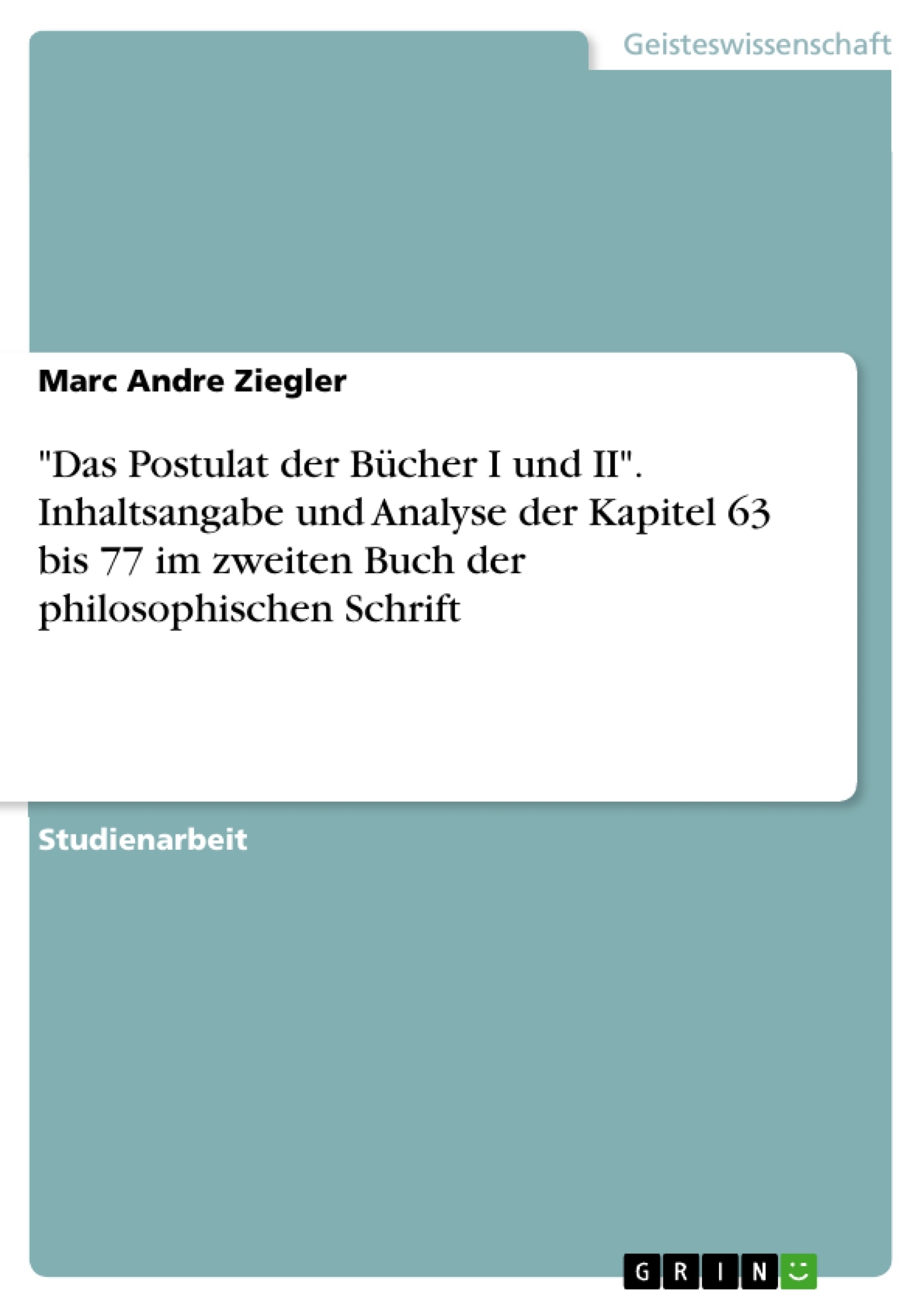Ciceros philosophische Schrift »De finibus bonorum et malorum« entstand in einem relativ kurzen Zeitraum, nämlich von Mitte Mai bis Ende Juni des Jahres 45 vor unserer Zeit; im gleichen Jahr also, in dem auch die Tusculanae disputationes verfasst wurden. Das Werk fällt in eine späte schriftstellerische Phase des Autors, welche sich von vorangegangenen durch eine starke Zäsur abgrenzen lässt.
Politisch ist diese Zäsur durch den Untergang der Republik charakterisiert. Im persönlichen Bereich ist sie gekennzeichnet durch den Tod von Ciceros Tochter Tullia, die im Februar 45 starb. Nun wurde die existenzielle Bedeutung, die die Philosophie für den Römer und Staatsmann Cicero hatte, in ganzem Maße sichtbar.
Ciceros Gedanke war es, ein Gesamtwerk über die verschiedenen philosophischen Strömungen der griechischen Kultur in lateinischer Sprache zu verfassen. Den Beginn dieses Vorhabens markierten die Academica, in denen er die Lehre der Akademie Platons darlegte. Während ihn persönliche Gründe zu dieser Schrift bewegten – zur Lehre der platonischen Akademie fühlte sich Cicero nämlich am meisten hingezogen – war die Frage nach dem höchsten Gut und dem größten Übel, eine der philosophischen Grundfragen, Ausgangspunkt für seine nächste Schrift De finibus bonorum et malorum.
Inhaltsverzeichnis
- Zum Werk
- Geschichtlicher Rahmen und philosophischer Hintergrund
- Formale Aspekte und Gesprächspartner
- Inhaltsbeschreibung
- Vorgeschichte
- Inhalt des Abschnitts
- Ausblick auf den weiteren Verlauf
- Argumentation Ciceros
- Kapitel 63 bis 66
- Kapitel 67 bis 77
- Stilistische Analyse
- Allgemeine Bemerkungen
- Konkrete Beispiele
- Persönliche Einschätzung des Befunds
- Übersetzung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den zweiten Teil von Ciceros philosophischen Werk „De finibus bonorum et malorum“, genauer gesagt die Kapitel 63 bis 77. Sie beleuchtet die Argumentation Ciceros gegen die Philosophie Epikurs, fokussiert dabei auf die Kritik an der "voluptas" als höchstes Gut und untersucht den Stellenwert der Vernunft für die Definition des Guten.
- Kritik an der epikureischen Lehre der "voluptas" als höchstes Gut
- Bedeutung der Vernunft für die Bestimmung des Guten
- Analyse der rhetorischen Strategien Ciceros
- Untersuchung der philosophischen und historischen Hintergründe des Werks
- Vergleich der epikureischen Lehre mit anderen philosophischen Strömungen
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Übersicht verschiedener philosophischer Erörterungsmethoden, wobei Cicero die dialektische Methode gegenüber anderen favorisiert. Anschließend betont er die Bedeutung klarer Begriffsdefinitionen und kritisiert die mangelnde Präzision in Epikurs Lehre, insbesondere hinsichtlich des Begriffs der "voluptas". Cicero bemängelt die dualistische Definition der Lust als sowohl katastematischer (fester Zustand) als auch kinetischer (Bewegung oder Drang) und zeigt die Widersprüchlichkeit der epikureischen Lehre durch zahlreiche Gegenüberstellungen mit anderen philosophischen Ansichten auf. Er kritisiert auch die epikureische Einteilung der Lust und die Vorstellung einer Begrenzung der Begierden als unrealistisch. Epikurs Versuch, das Streben der Tiere nach Schmerzlosigkeit mit der Lust als oberstes Ziel gleichzusetzen, wird ebenfalls abgelehnt. Cicero betont stattdessen die Vernunft als Grundlage für die Bestimmung des höchsten Gutes und stuft Epikurs stärkere Gewichtung der Sinneswahrnehmungen herab. Die Auseinandersetzung zwischen der Tugend (Virtus) und der Lust (Voluptas) bildet den Kernpunkt der Diskussion. Cicero demonstriert mit seiner Schrift die Bedeutung der Vernunft als Wesensmerkmal des Menschen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die philosophischen Konzepte der "voluptas" und der "virtus" in Ciceros "De finibus bonorum et malorum". Sie beleuchtet die Argumentationsstrategie Ciceros gegen Epikurs Lehre sowie die Bedeutung von Vernunft und Begriffsdefinitionen in der philosophischen Analyse. Die Arbeit setzt sich mit der dialektischen Methode, der historischen und philosophischen Kontextualisierung des Werkes sowie mit der Verwendung rhetorischer Mittel im Werk auseinander.
- Quote paper
- Marc Andre Ziegler (Author), 2004, "Das Postulat der Bücher I und II". Inhaltsangabe und Analyse der Kapitel 63 bis 77 im zweiten Buch der philosophischen Schrift, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/347141