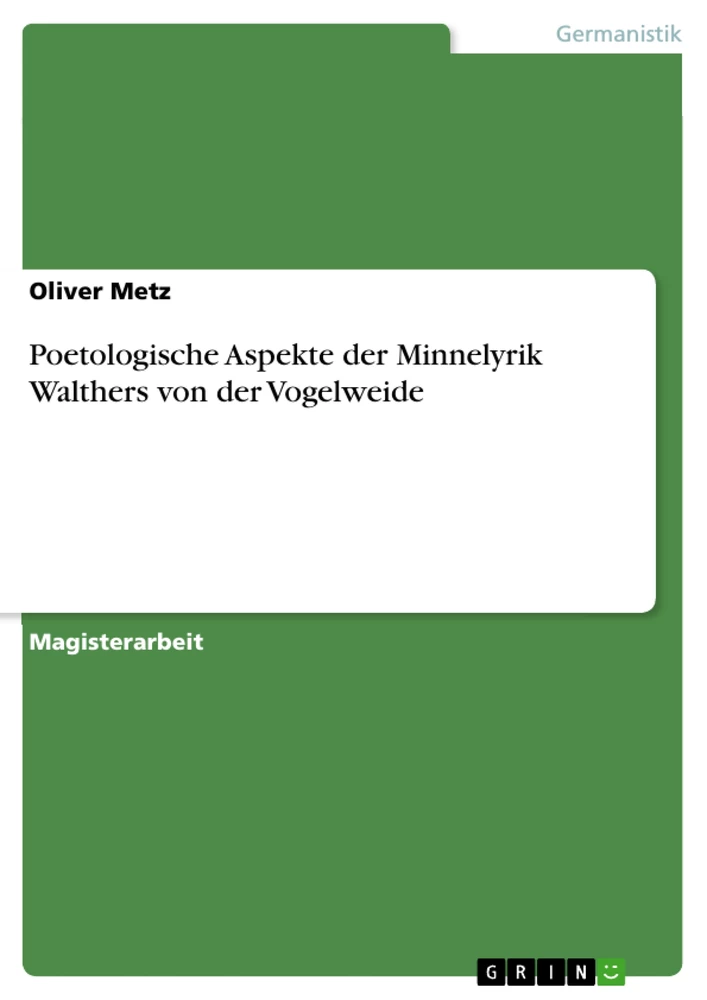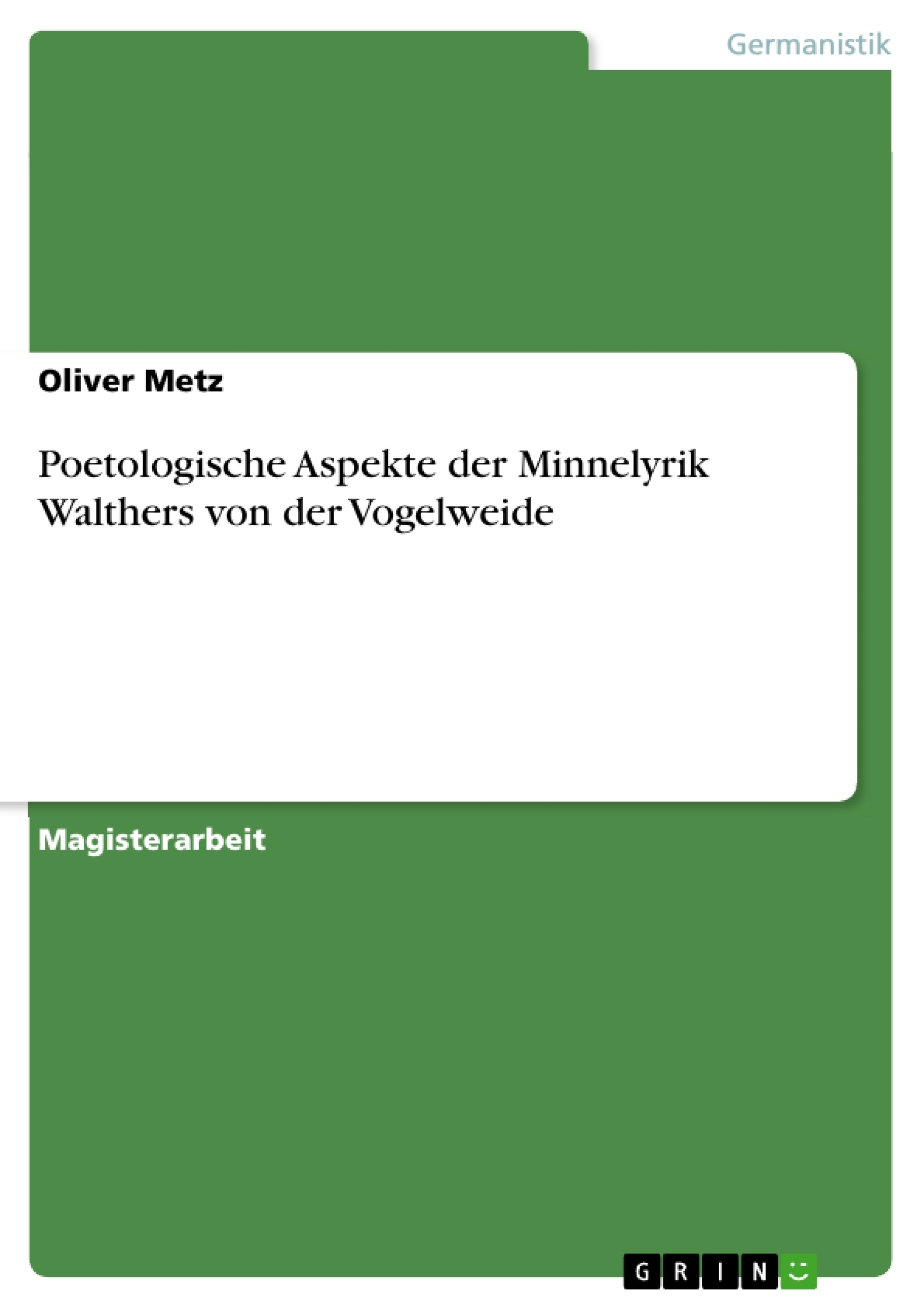Literatur findet heutzutage meist im kleinsten Kreis statt: Der Leser ist mit seinem Buch allein und liest. Nur Dichterlesungen knüpfen an die Tradition der Literatur als gesellschaftliches und geselliges Phänomen an. Im Hohen Mittelalter dagegen stellten Literatur und Gesellschaft eine nicht aufzulösende Einheit dar: Kein Hof ohne Literatur, keine Literatur ohne den gesellschaftlichen Rahmen. Literatur wurde durch den Vortrag eines Sängers vermittelt.
Die vorliegende Arbeit setzt sich auseinander mit der Frage nach der Bedeutung des Gesangs für die höfische Gesellschaft, mit der Rolle des Sängers am Hof und mit der Rolle, die dem Publikum bei der Aufführung beigemessen wird. Grundlage dieser Analyse stellt die Liedlyrik Walthers von der Vogelweide dar, womit eine spezifische Sicht aus dem Blickwinkel Walthers als Zeitzeuge entsteht.
Im Mittelpunkt der Analyse stehen die Fragen: Welche Konsequenzen hatte die direkte Anwesenheit des Publikums auf die Entstehung von Liedern und Texten? In welcher Beziehung zueinander standen Sänger und Zuhörer? Wird die Vortragssituation in den Texten deutlich? Und: Inwiefern beeinflussen sich Sänger und Publikum gegenseitig? Lässt sich der Diskurs über das Singen als fester Bestandteil der Minnelyrik Walthers von der Vogelweide begreifen?
Nach einer Einführung über den Literaturbetrieb im Mittelalter und kurzen Erläuterung der Begriffe ‚Singen, Sänger und Publikum‘ wird für jeden dieser Aspekte ein Lied Walthers von der Vogelweide exemplarisch analysiert.
Im Kern der Arbeit wird ein weiteres Lied Walthers hinsichtlich der Interaktionswege zwischen Sänger und Publikum betrachtet. Interessant ist hierbei insbesondere die Verknüpfungen zwischen textinterner und textexterner Ebene.
Im Anhang findet sich eine Auflistung aller Strophen mit poetologischer Thematik aus Walthers Gesamtwerk, jeweils nach den Aspekten Singen, Sänger und Publikum aufgeteilt, sowie eine Liste mit Literaturangaben.
Die Diskussion der poetologischen Aspekte von Minnelyrik eröffnet die Möglichkeit, eine neue Sicht der gesellschaftlichen Verhältnisse des Hohen Mittelalters zu gewinnen. Auf diese Weise stellen die Lieder Walthers von der Vogelweide weit mehr als nur ein Zeugnis mittelalterlicher Lyrik dar. Sie können, mit der gebotenen Vorsicht, als eine Quelle der Information über die Aufführungspraxis von Minnesang betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Lesen, singen und hören
- III. Grundlagen
- III.1. Versteckte Poetik
- III.2. Walthers Minnesangkonzept
- IV. Das Singen, der Sänger und das Publikum
- IV.1. Exposition der Begriffe
- IV.2.,,singen unde sagen“: das Singen
- IV.2.1.,,Lange swîgen des hât ich gedâht“ (L 72,31)
- IV.2.1.1. Überlieferung und Form
- IV.2.1.2. Inhalt
- IV.2.1.3. Ebenen des Singens
- IV.2.2. Weitere Textzeugen
- IV.2.1.,,Lange swîgen des hât ich gedâht“ (L 72,31)
- IV.3.,,werben umbe werdekeit“: der Sänger
- IV.3.1.,,Ir reiniu wip, ir werden man“ (L66,21)
- IV.3.1.1. Überlieferung, Form und Inhalt
- IV.3.1.2. Das Selbstbewußtsein des Sängers
- IV.3.2. Weitere Textzeugen
- IV.3.1.,,Ir reiniu wip, ir werden man“ (L66,21)
- IV.4.,,so sprechet denne ja“: das Publikum
- IV.4.1.,,Saget mir ieman, waz ist minne“ (L 69,1)
- IV.4.1.1. Überlieferung, Form und Inhalt
- IV.4.1.2. Textintenes und textexternes Publikum
- IV.4.2. Weitere Textzeugen
- IV.4.1.,,Saget mir ieman, waz ist minne“ (L 69,1)
- V. Interaktionen zwischen Sänger und Publikum
- V.1.,,Owê, hovelîchez singen“ (L 61,34)
- V.1.1. Überlieferung, Form und Inhalt
- V.1.3. Sender und Adressaten
- V.1.,,Owê, hovelîchez singen“ (L 61,34)
- VI. Resumee
- Die Bedeutung des Singens in Walthers Liedern
- Die Rolle des Sängers in der Minnesang-Tradition
- Die Interaktion zwischen Sänger und Publikum
- Die Verbindung von textinterner und textexterner Ebene in Walthers Werken
- Walthers Konzeption von Minne und ihre Ausdrucksweise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit beschäftigt sich mit der poetologischen Thematik im Werk Walthers von der Vogelweide. Das Ziel ist, die Lieder Walthers hinsichtlich der Elemente des Minnesangs – das Singen, der Sänger und das Publikum – zu analysieren. Durch exemplarische Analysen ausgewählter Lieder werden die jeweiligen Aspekte und ihre Bedeutung für die Gesamtaussage der Werke untersucht.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit erläutert. Kapitel III beleuchtet die Grundlagen des Themas, indem es einen Blick auf die Poetik des Mittelalters wirft und Walthers Minnesangkonzept beleuchtet. Kapitel IV analysiert die drei zentralen Elemente des Minnesangs – Singen, Sänger und Publikum – anhand exemplarischer Lieder. Kapitel V untersucht die Interaktionen zwischen Sänger und Publikum in einem weiteren Lied und legt die Verknüpfungen zwischen textinterner und textexterner Ebene frei.
Schlüsselwörter
Minnesang, Poetik, Walther von der Vogelweide, Liedanalyse, Singen, Sänger, Publikum, Interaktion, Textinterpretation, Mittelalterliche Literatur, Überlieferung, Form, Inhalt.
- Quote paper
- Oliver Metz (Author), 2000, Poetologische Aspekte der Minnelyrik Walthers von der Vogelweide, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3468