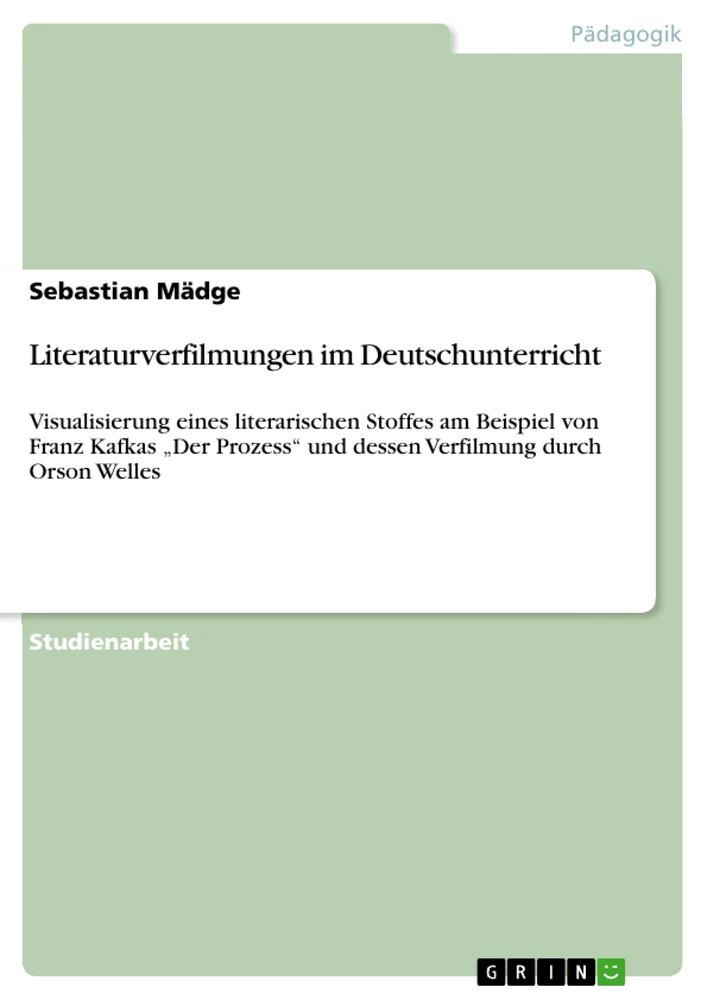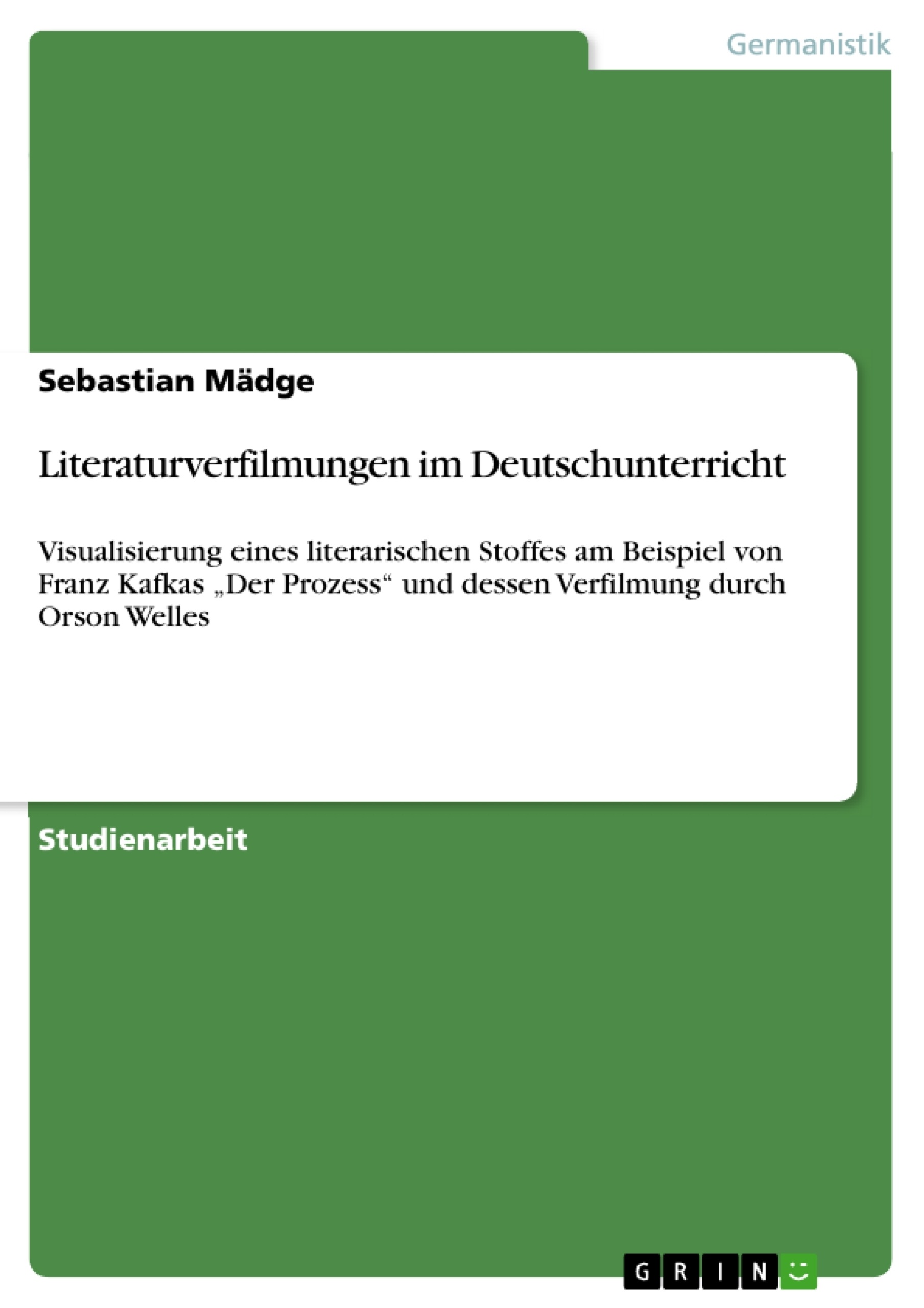Im Folgenden soll ein Auge darauf geworfen werden, inwiefern Buch und Film damals wie heute eine Koexistenz leben oder sich gegenseitig beeinflussen. Dafür soll genauer analysiert werden, welche Möglichkeiten das Buch in der Vermittlung im Vergleich zum Film und umgekehrt besitzt und wie eine Umsetzung des einen Stoffs in den Anderen möglich ist.
Seit der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg entwickelte sich das Buch im Laufe der Jahrhunderte zu dem grundlegenden Verbreitungsmedium von Informationen. Bis weit ins 20. Jahrhundert blieb das geschriebene Wort das Medium der Gesellschaft. Erinnerungen, Darstellungen untergegangener Gesellschaften, Geschichten zu allen Themenbereichen des Alltags der Menschen wurden in Schriften und Büchern festgehalten. Auch wenn im 19. Jahrhundert langsam die Entwicklung des Films und damit die Verbildlichung des Wortes begann, dauerte es doch bis Mitte des 20. Jahrhunderts bis der Film in der breiten Masse der Gesellschaft ankam.
Nach und nach eroberte der Film zunächst die Theater, welche vermehrt in Lichtspielhäuser umgewandelt wurden und fand schließlich mit der fortschreitenden Entwicklung der Technologie, u.a. mit Erfindung des Fernsehens, auch Zugang in die Wohnzimmer der Menschen. So präsent der Film in jeglicher Form, ob im Kino oder in Serien auch in der Gesellschaft ist, das Buch wurde letztendlich nicht verdrängt. Ganz im Gegenteil, die gegenseitige Beeinflussung beider Medien ist stärker denn je. Insbesondere die Jugendliteratur erfuhr und erfährt mit der Umsetzung zahlreicher Buchreihen, wie z.B. die Geschichten um Harry Potter, eine wahnsinnig große Beliebtheit.
Die Umsetzung von Literatur in Film besitzt nunmehr auch schon eine über hundertjährige Geschichte. So verfilmte Louis Jean Lumieré bereits 1896 die Geschichte des „Faust“. Es folgten unzählige weitere Verfilmung u.a. „Nosferatu“, als Adaption des Bram Stoker Roman „Dracula“ (1922) oder auch die Umsetzung der Kinderbuchreihe „Emil und die Detektive“ (1931) von Erich Kästner. Orson Welles nahm sich im Jahre 1962 dem Werk „Der Prozess“ von Franz Kafka aus dem Jahr 1914/15 an und entwickelte einen Schwarz- Weiß-Film der bis heute einen Meilenstein der Filmgeschichte darstellt. Insofern man die Literaturverfilmung als Bindeglied zwischen Buch und Film erkennt, so maßgeblich lässt sich dies an Welles’ Verfilmung zeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Literatur und Film – Eine vereinbare Koexistenz?
- Medienwechsel, Intermedialität und Visualität
- Arten der Transformation
- Vergleich filmischer und literarischer Ausdrucksmittel
- Über die Sinnhaftigkeit der Einführung eines Filmkanons
- Verfilmung von Franz Kafkas „Der Prozess“ durch Orson Welles
- „Der Prozess”, Franz Kafka
- ,,The Trial", Orson Welles
- Vergleichende Analyse der Raumstruktur einzelner Szenen in Buch und Film
- Kontrastive Gestaltung der Räume
- Labyrinthstruktur
- Einsatzmöglichkeiten im Unterricht
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text beschäftigt sich mit der Thematik der Literaturverfilmung und deren Einsatz im Deutschunterricht. Es wird analysiert, inwieweit Literatur und Film als Medien eine Koexistenz leben und sich gegenseitig beeinflussen. Im Mittelpunkt steht der Vergleich von Franz Kafkas „Der Prozess“ und dessen Verfilmung durch Orson Welles. Der Text beleuchtet die Transformation von literarischem Stoff ins filmische Medium und die Unterschiede in den Ausdrucksmöglichkeiten beider Medien. Neben einer vergleichenden Analyse der Raumstruktur in Buch und Film wird auch die Bedeutung dieser Adaption im Unterricht untersucht.
- Literatur und Film als Medien: Koexistenz und gegenseitige Beeinflussung
- Transformation von literarischem Stoff ins filmische Medium
- Vergleich der Ausdrucksmöglichkeiten von Literatur und Film
- Analyse der Raumstruktur in Kafkas „Der Prozess“ und Welles’ Verfilmung
- Einsatzmöglichkeiten der Adaption im Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Literaturverfilmung ein und stellt die Relevanz des Themas in der heutigen Zeit dar. Sie beleuchtet die Geschichte der Literaturverfilmung und die Bedeutung des Mediums Film in der Gesellschaft. In Kapitel 2 werden verschiedene Aspekte der Koexistenz von Literatur und Film analysiert, wie z.B. der Medienwechsel, die Intermedialität und die Visualität. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Ausdrucksweise beider Medien beleuchtet. Kapitel 3 befasst sich mit der Verfilmung von Franz Kafkas „Der Prozess“ durch Orson Welles. Es werden sowohl die literarische Vorlage als auch die filmische Adaption genauer vorgestellt und die Raumstruktur in einzelnen Szenen verglichen. Abschließend wird in Kapitel 4 untersucht, welche Möglichkeiten die Adaption im Deutschunterricht bietet und wie sie genutzt werden kann.
Schlüsselwörter
Literaturverfilmung, Medienwechsel, Intermedialität, Visualität, Franz Kafka, „Der Prozess”, Orson Welles, Raumstruktur, Deutschunterricht.
- Quote paper
- Sebastian Mädge (Author), 2016, Literaturverfilmungen im Deutschunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/346831