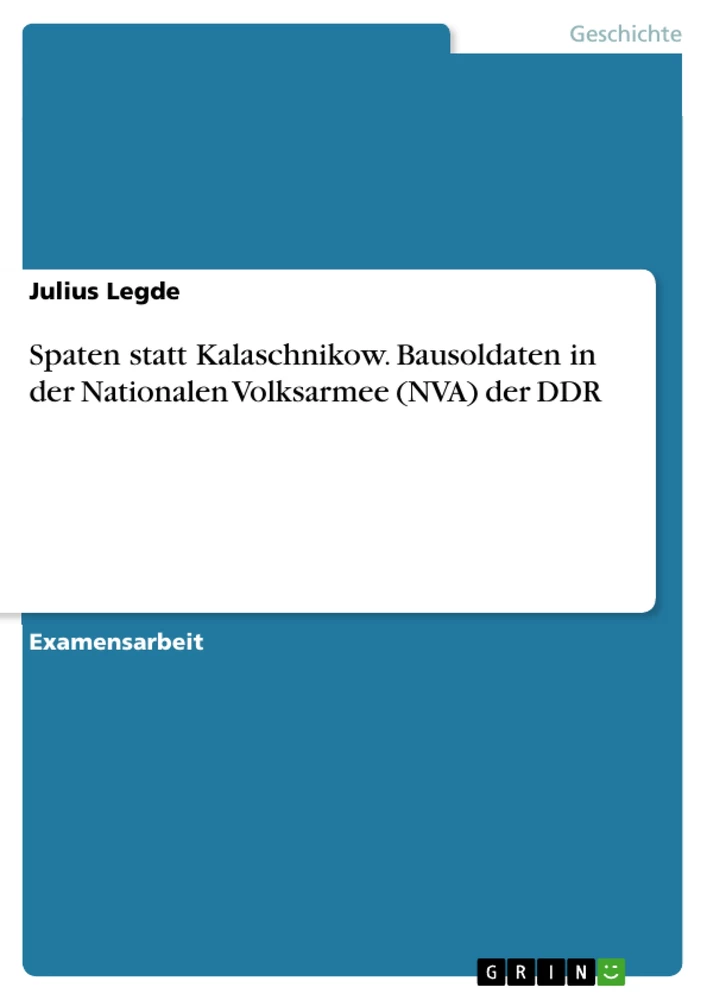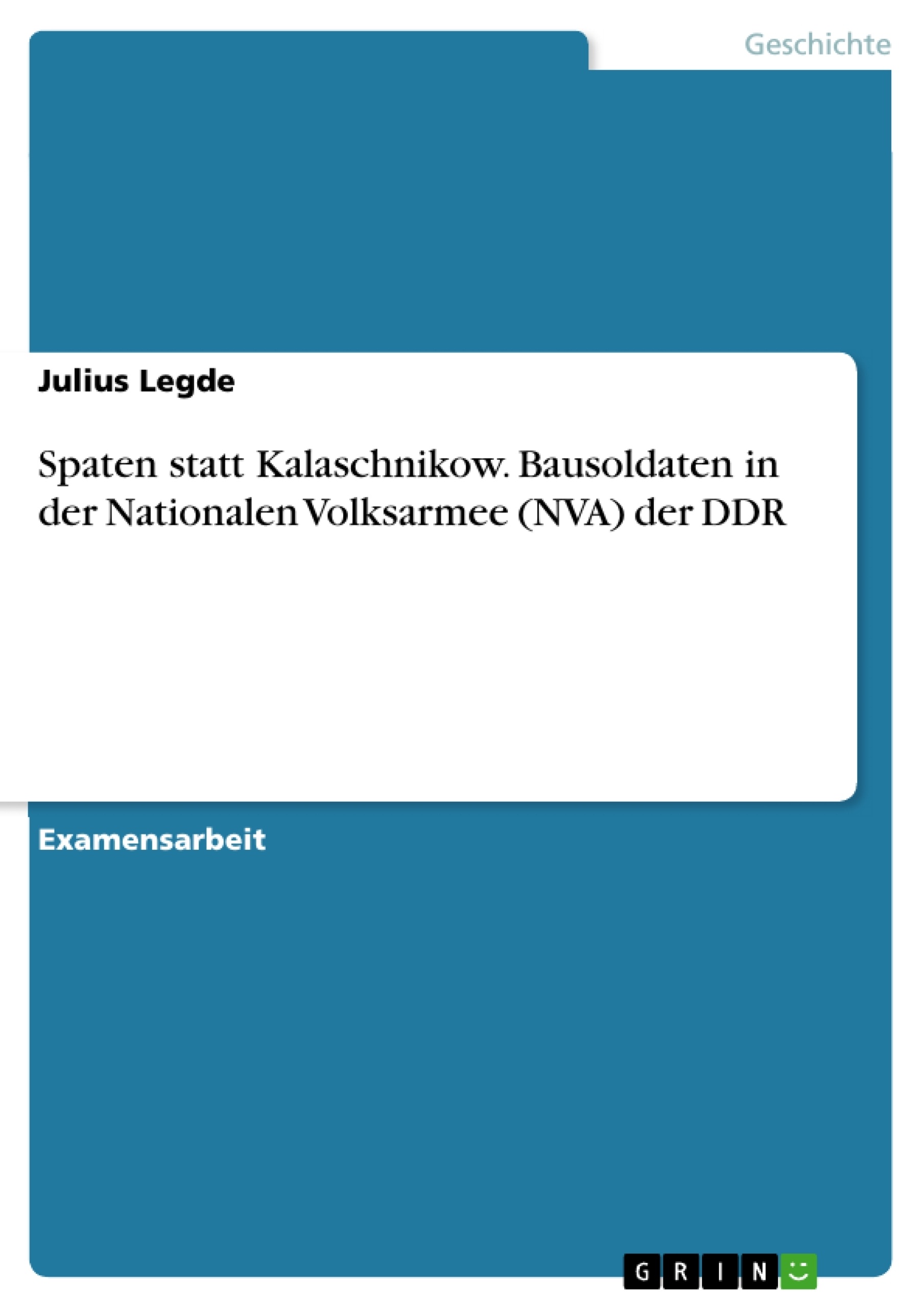Im Spätsommer 1964 schuf die DDR eine Möglichkeit den Wehrdienst ohne Waffe zu leisten. Dass damit kein wirklicher Wehrersatzdienst ins Leben gerufen war, wurde bereits den ersten Bausoldaten schnell bewusst.
Diese Arbeit befasst sich mit der Waffendienstverweigerung in der DDR. Vor allem geht es hierbei um die Hintergründe der Entstehung der "Alternative" zum NVA-Dienst. Weiterhin wird das Leben der Bausoldaten innerhalb der NVA genauer betrachtet und dabei der Personenkreis, das Gelöbnis, die Arbeitsbedingungen, das Freizeitverhalten aber auch die Behandlung durch Vorgesetzte, der Widerstand und die Bespitzelung durch das MfS sowie das Leben der Waffenverweigerer nach ihrem Dienst untersucht.
Zur Unterstützung der traditionellen Quellen und um dieser Arbeit einen wissenschaftlichen Mehrwert zu geben wurden vom Autor drei Zeitzeugeninterviews mit ehemaligen Bausoldaten geführt und ausgewertet. Das interdisziplinäre Forschungsfeld der Oral History beschäftigt sich mit einer solchen Quellenart und deren Methodik. Auch auf sie wurde genauer eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Fragestellung
- 1.2. Forschungsstand
- 1.3. Das Zeitzeugeninterview – eine historische Quelle
- 2. Die Militärpolitik der SED
- 2.1. Die Mobilisation der DDR-Bevölkerung
- 2.2. Die Einführung der Wehrpflicht (in allen Bereichen des Lebens)
- 3. Auf dem Weg zur Schaffung einer Alternative
- 3.1. Die Rolle der Kirche und Blockparteien
- 3.2. Die Entstehung des Bausoldatendienstes
- 4. Der Dienst mit dem Spaten - Bausoldaten vs. NVA
- 4.1. Personenkreis und Verweigerungsmotive
- 4.2. Das ungeliebte Gelöbnis
- 4.3. Arbeitsfelder und -bedingungen
- 4.3.1. Zentralisierung und militärische Vereinnahmung: 1964–1975
- 4.3.2. Dezentralisierung und Entspannung: 1975–1982
- 4.3.3. Rezentralisierung und Einsatz in der Volkswirtschaft: 1982-1989
- 4.4. Freizeitgestaltung
- 4.5. Stellung innerhalb der NVA und Behandlung durch Vorgesetzte
- 4.6. Protest und Widerstand
- 4.7. Bespitzelung durch das MfS
- 5. Bausoldaten nach ihrem Dienst
- 5.1. Gesellschaftliche Stellung und bildungspolitische Diskriminierung
- 5.2. Die Bausoldatenbewegung als „Keimzelle der friedlichen Revolution“?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte des Bausoldatendienstes in der DDR, einen waffenlosen Militärdienst, der als Alternative zum regulären Wehrdienst eingeführt wurde. Sie beleuchtet die Entstehung dieses Dienstes im Kontext der Militärpolitik der SED und der Reaktion der Kirche auf die allgemeine Wehrpflicht. Die Arbeit analysiert die Erfahrungen der Bausoldaten, ihre Motive zur Wehrdienstverweigerung, ihren Alltag, sowie ihre Stellung innerhalb der NVA und das Verhältnis zum MfS.
- Die Entstehung des Bausoldatendienstes in der DDR und die Rolle der Kirche und der SED.
- Die Motive der Bausoldaten zur Wehrdienstverweigerung und ihre gesellschaftliche Stellung.
- Der Alltag der Bausoldaten: Arbeitsbedingungen, Freizeitgestaltung und Konflikte mit der NVA.
- Die Überwachung der Bausoldaten durch das MfS und die daraus resultierenden Spannungen.
- Die Situation der Bausoldaten nach ihrem Dienst und ihre Bedeutung für die friedliche Revolution.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel legt den Fokus auf die Fragestellung der Arbeit, die sich mit der Waffendienstverweigerung in der DDR, speziell dem Bausoldatendienst, auseinandersetzt. Es grenzt die Bausoldaten von Totalverweigerern ab und skizziert den Forschungsstand, wobei die Herausforderungen soziologischer Datengewinnung aufgrund fehlender spezifischer Bestandsführung der NVA betont werden. Die Einleitung umreißt den Aufbau der Arbeit und die wichtigsten Forschungsfragen: Wie kam es zur Einführung des Bausoldatendienstes? Wie gestaltete sich der Alltag der Bausoldaten? Welche Bedeutung hatten sie für die DDR und die spätere friedliche Revolution?
2. Die Militärpolitik der SED: Dieses Kapitel analysiert die Militärpolitik der SED nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und die damit verbundenen Konflikte, vor allem mit der Kirche. Es untersucht die Reaktionen der SED auf Wehrdienstverweigerer aus religiösen oder ethischen Gründen und legt den Grundstein für das Verständnis der Notwendigkeit einer "Alternative", die im Bausoldatendienst gefunden werden sollte. Der Fokus liegt auf dem politischen Kontext und der Ideologie hinter den Entscheidungen der SED in Bezug auf Wehrpflicht und die Behandlung von Verweigerern.
3. Auf dem Weg zur Schaffung einer Alternative: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Prozess der Entstehung des Bausoldatendienstes. Es analysiert die Rolle der Kirche und der Blockparteien in der Entscheidungsfindung und beleuchtet die Kompromisse und politischen Kalküle, die zur Einführung dieses waffenlosen Militärdienstes führten. Es wird untersucht, inwiefern die Kirche tatsächlich Einfluss auf die Schaffung des Bausoldatendienstes nehmen konnte und welche Rolle politische Opportunität der SED spielte.
4. Der Dienst mit dem Spaten - Bausoldaten vs. NVA: Dieses Kapitel widmet sich dem Alltag der Bausoldaten, unterteilt in drei Phasen, die durch unterschiedliche Arbeitsbedingungen und Schwerpunkte gekennzeichnet waren. Es analysiert die Motive der Wehrdienstverweigerer, das Ablegen des Gelöbnisses, das Verhältnis der Bausoldaten zur NVA und die Überwachung durch das MfS. Es beleuchtet den Konflikt zwischen den Zielen des SED-Regimes und den Erfahrungen der Bausoldaten. Die Kapitel untersucht die Behandlung der Bausoldaten durch Vorgesetzte und die Versuche von Protest und Widerstand.
5. Bausoldaten nach ihrem Dienst: Dieser Abschnitt untersucht die gesellschaftliche Stellung und die bildungspolitische Diskriminierung ehemaliger Bausoldaten nach ihrem Dienst. Es wird analysiert, inwiefern die Erfahrungen der Bausoldaten ihre spätere Lebensgestaltung beeinflussten und welche Rolle sie in der Opposition und der friedlichen Revolution gespielt haben. Der Fokus liegt auf den langfristigen Konsequenzen der Wehrdienstverweigerung und der Frage, ob die Bausoldatenbewegung als "Keimzelle der friedlichen Revolution" betrachtet werden kann.
Schlüsselwörter
Bausoldaten, DDR, Wehrdienstverweigerung, SED, Militärpolitik, Kirche, NVA, MfS, friedliche Revolution, Gewissenskonflikt, Opposition, Alternative zum Wehrdienst, gesellschaftliche Diskriminierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: "Bausoldaten in der DDR"
Was ist das Thema dieser Studie?
Diese Studie untersucht die Geschichte des Bausoldatendienstes in der DDR. Sie beleuchtet die Entstehung, den Alltag und die langfristigen Folgen dieses waffenlosen Militärdienstes als Alternative zum regulären Wehrdienst im Kontext der Militärpolitik der SED und der Rolle der Kirche.
Welche Aspekte des Bausoldatendienstes werden behandelt?
Die Studie analysiert die Entstehung des Bausoldatendienstes, die Motive der Wehrdienstverweigerer, die Arbeitsbedingungen, die Freizeitgestaltung, das Verhältnis zu NVA und MfS, den Protest und Widerstand der Bausoldaten, sowie deren gesellschaftliche Stellung vor und nach dem Dienst und deren mögliche Rolle in der friedlichen Revolution.
Wie ist die Studie strukturiert?
Die Studie ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung (Fragestellung, Forschungsstand), Militärpolitik der SED und die Einführung der Wehrpflicht, Entstehung des Bausoldatendienstes und die Rolle der Kirche, der Alltag der Bausoldaten (Arbeitsbedingungen, Beziehungen zu NVA und MfS), und schließlich die Situation der Bausoldaten nach ihrem Dienst und ihre mögliche Bedeutung für die friedliche Revolution. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Zusammenfassung.
Welche Rolle spielte die SED in Bezug auf den Bausoldatendienst?
Die Studie analysiert die Militärpolitik der SED und deren Reaktion auf Wehrdienstverweigerung. Sie beleuchtet die politischen Kalküle und Kompromisse, die zur Einführung des Bausoldatendienstes als vermeintliche Alternative führten. Die SED's Kontrolle und Überwachung des Dienstes durch das MfS wird ebenfalls untersucht.
Welche Rolle spielte die Kirche?
Die Studie untersucht die Rolle der Kirche im Kontext der Wehrpflicht und der Entstehung des Bausoldatendienstes. Sie beleuchtet die Bemühungen der Kirche, Einfluss auf die Entscheidungsfindung zu nehmen und Alternativen für Wehrdienstverweigerer aus religiösen oder ethischen Gründen zu schaffen.
Wie gestaltete sich der Alltag der Bausoldaten?
Die Studie beschreibt den Alltag der Bausoldaten anhand von drei Phasen mit unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und Schwerpunkten. Sie beleuchtet Arbeitsfelder, Freizeitgestaltung, Konflikte mit der NVA, die Überwachung durch das MfS und Versuche von Protest und Widerstand.
Welche Motive hatten die Bausoldaten für die Wehrdienstverweigerung?
Die Studie analysiert die Motive der Bausoldaten für ihre Wehrdienstverweigerung, einschließlich religiöser, ethischer und politischer Gründe. Sie betrachtet den Personenkreis und die individuellen Beweggründe der Verweigerung.
Wie wurden die Bausoldaten nach ihrem Dienst behandelt?
Die Studie untersucht die gesellschaftliche Stellung und die bildungspolitische Diskriminierung ehemaliger Bausoldaten nach ihrem Dienst. Sie analysiert die langfristigen Folgen der Wehrdienstverweigerung auf ihr Leben und ihre mögliche Rolle in der Opposition und der friedlichen Revolution.
Kann die Bausoldatenbewegung als "Keimzelle der friedlichen Revolution" betrachtet werden?
Die Studie untersucht diese Frage, indem sie die Erfahrungen der Bausoldaten nach ihrem Dienst und ihre mögliche Beteiligung an der friedlichen Revolution analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Studie?
Schlüsselwörter sind: Bausoldaten, DDR, Wehrdienstverweigerung, SED, Militärpolitik, Kirche, NVA, MfS, friedliche Revolution, Gewissenskonflikt, Opposition, Alternative zum Wehrdienst, gesellschaftliche Diskriminierung.
- Quote paper
- Julius Legde (Author), 2016, Spaten statt Kalaschnikow. Bausoldaten in der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/346806