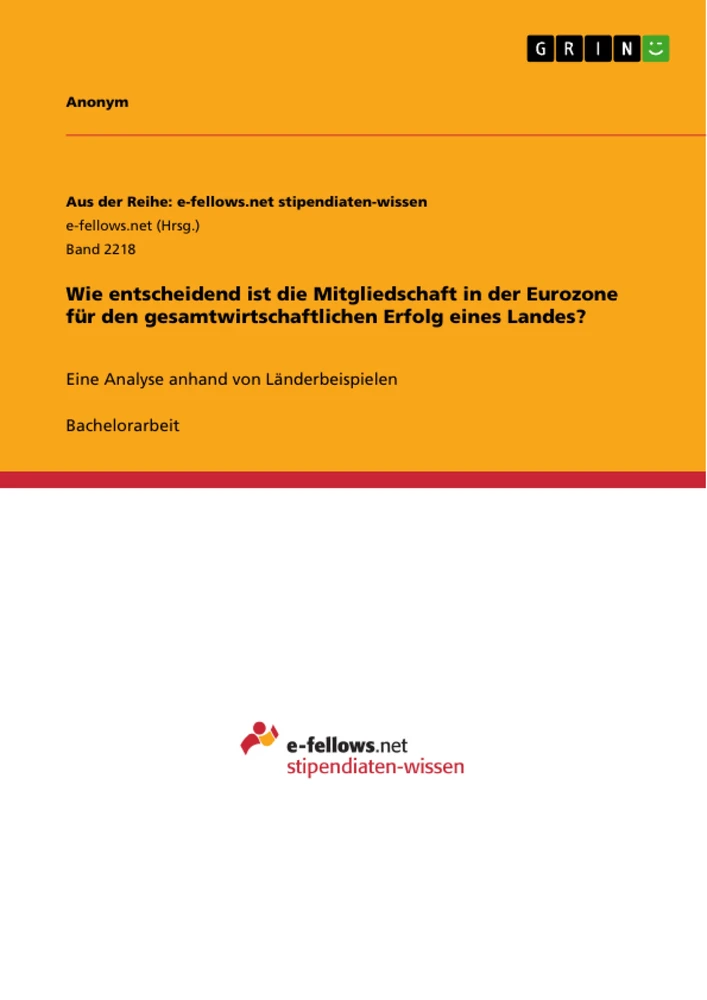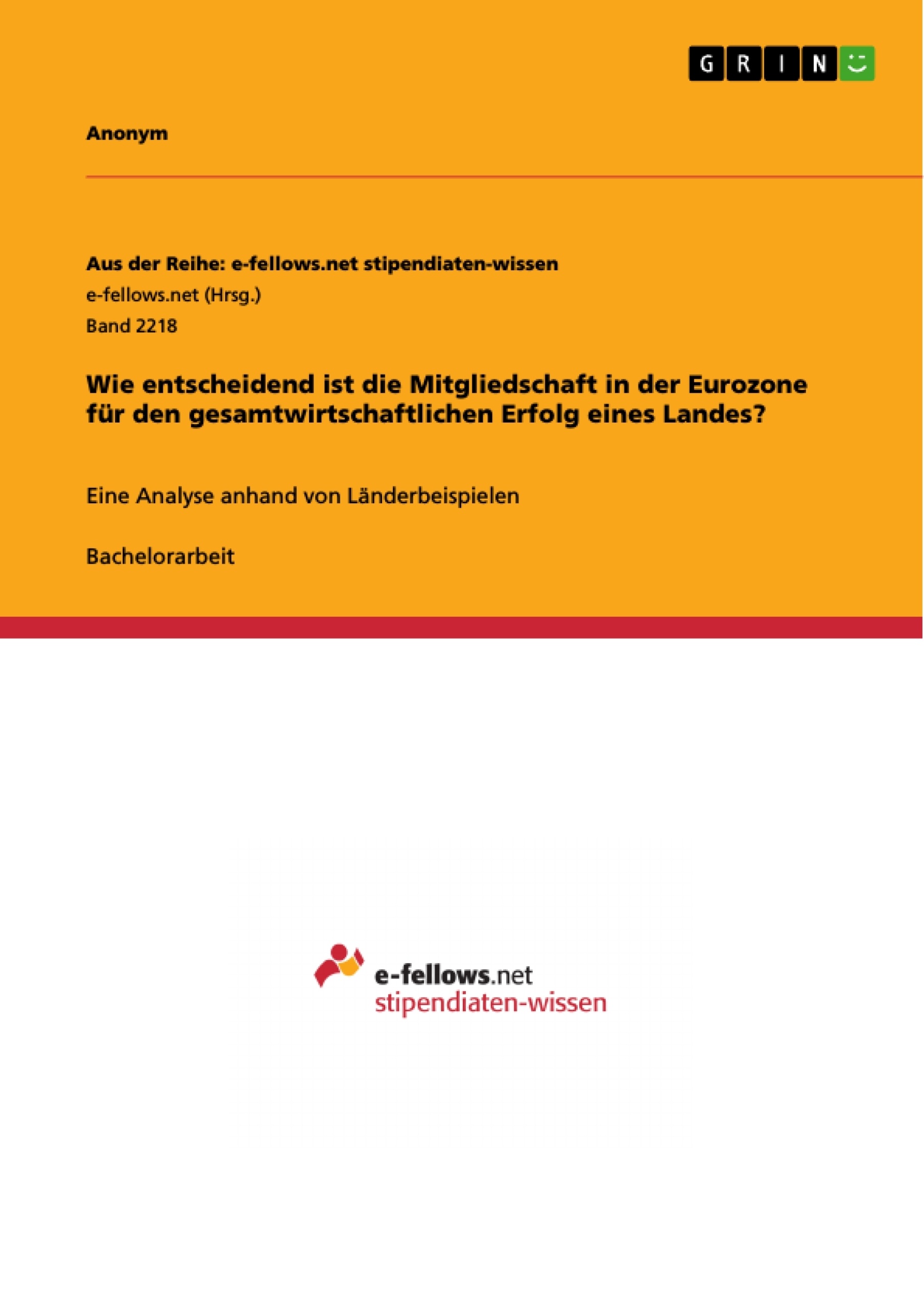Die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) im Jahre 1952 war der Auftakt für eine engere Zusammenarbeit auf dem europäischen Kontinent. Diese wirtschaftliche und politische Integration setzte sich über die Jahre fort. Es entstand eine engere Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie (EURATOM) bis hin zum Abschluss des Vertrags von Maastricht, welcher die Gründung der Europäischen Union (EU) beschloss.
Eine Errichtung einer Währungsunion wurde als ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur tieferen wirtschaftlichen Integration und dem Aufbau eines gemeinsamen Binnenmarktes gesehen. Eine Währungsunion bezeichnet eine Gesamtheit von Ländern, welche eine gemeinsame Geld- und Währungspolitik betreiben, die in der Regel durch eine gemeinsame Währung und die Erschaffung einer allein verantwortlichen Zentralbank ergänzt wird. Es wurden Pläne über die Eurozone, mit dem Euro als gemeinsame Währung und der supranationalen Europäischen Zentralbank (EZB), erstellt.
Es wurden jedoch auch Gegenstimmen laut, welche auf die möglichen Probleme einer Gemeinschaftswährung hingewiesen haben. Diesen Gegenmeinungen zum Trotz wurde am 01.01.1999 der Euro als Buchgeld in elf europäischen Ländern3 eingeführt. Zu Beginn der Zusammenarbeit zeigten sich zunächst vor allem die wirtschaftlichen Vorteile der neugeschaffenen Währungsunion, sodass die teilnehmenden Länder durchaus positive Bilanzen ziehen konnten. Im Zuge dieser Entwicklung schlossen sich mit den Jahren weitere acht Staaten der Eurozone an, primär um von den ökonomischen Vorteilen des Wirtschaftsraumes zu profitieren.
Mit Blick auf die heutige Situation in Verbindung mit den Erwartungen, welche der Eurozone noch vor wenigen Jahren entgegenbracht wurden, zeigt sich die gegenwärtige Entwicklung umso ernüchternder. Die Eurozone befindet sich in einer Staatsschulden-, Banken- und Wirtschaftskrise, ausgelöst durch die Nicht-Einhaltung der Konvergenzkriterien im Vorfeld und durch externe Schocks wie der Finanzkrise von 2007/08. Somit entsteht die Frage, ob die Vor- oder die Nachteile einer Mitgliedschaft in der Eurozone überwiegen. Um mich einer Antwort auf diese Frage zu nähern, werde ich mit den theoretischen Grundlagen einer Mitgliedschaft in einer Währungsunion, am Beispiel der Eurozone, beginnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen der Mitgliedschaft in einer Währungsunion am Beispiel der Eurozone
- 2.1 Vorteile einer Mitgliedschaft
- 2.1.1 Wegfall von Transaktionskosten
- 2.1.2 Handelssteigerung
- 2.1.3 Geldwertstabilität
- 2.1.4 Eliminierung des Wechselkursrisikos
- 2.1.5 Weitere Vorteile
- 2.2 Nachteile einer Mitgliedschaft
- 2.2.1 Aufgabe der autonomen Geldpolitik
- 2.2.2 Aufgabe der autonomen Währungspolitik
- 3. Auswahl der Länderpaare
- 4. Schweden – Finnland
- 4.1 Der Weg zur Eurozone
- 4.2 Wirtschaftswachstum
- 4.3 Handel
- 4.4 Wechselkursentwicklung
- 4.5 Geldwertstabilität
- 5. Tschechische Republik – Slowakei
- 5.1 Der Weg zur Eurozone
- 5.2 Wirtschaftswachstum
- 5.3 Handel
- 5.4 Wechselkursentwicklung
- 5.5 Geldwertstabilität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, ob die Mitgliedschaft in der Eurozone für den gesamtwirtschaftlichen Erfolg eines Landes entscheidend ist. Die Arbeit analysiert anhand von Länderbeispielen die Auswirkungen des Euro-Eintritts auf verschiedene wirtschaftspolitische Bereiche.
- Die Vorteile und Nachteile einer Mitgliedschaft in einer Währungsunion werden am Beispiel der Eurozone untersucht.
- Die Arbeit analysiert die Auswirkungen des Euro-Eintritts auf das Wirtschaftswachstum, den Handel und die Wechselkursentwicklung.
- Es werden zwei Länderpaare, Schweden-Finnland und Tschechische Republik-Slowakei, herangezogen, um die Auswirkungen der Euro-Mitgliedschaft zu vergleichen.
- Die Arbeit untersucht, ob die Einhaltung der Konvergenzkriterien für den Erfolg einer Euro-Mitgliedschaft von Bedeutung ist.
- Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Eurozone in der Lage ist, die Herausforderungen der Globalisierung zu bewältigen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Eurozone und der Frage nach deren Bedeutung für den gesamtwirtschaftlichen Erfolg eines Landes ein. Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse der Auswirkungen einer Währungsunion. Dabei werden die Vorteile und Nachteile einer Mitgliedschaft in einer Währungsunion, insbesondere der Eurozone, erläutert. In Kapitel 3 wird die Auswahl der Länderpaare Schweden-Finnland und Tschechische Republik-Slowakei begründet. Kapitel 4 analysiert die Auswirkungen des Euro-Eintritts auf Schweden und Finnland, während Kapitel 5 die Entwicklung der Tschechischen Republik und der Slowakei im Vergleich beleuchtet.
Schlüsselwörter
Eurozone, Währungsunion, Wirtschaftswachstum, Handel, Wechselkurs, Geldwertstabilität, Konvergenzkriterien, Schweden, Finnland, Tschechische Republik, Slowakei, Ländervergleich.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Wie entscheidend ist die Mitgliedschaft in der Eurozone für den gesamtwirtschaftlichen Erfolg eines Landes?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/346433