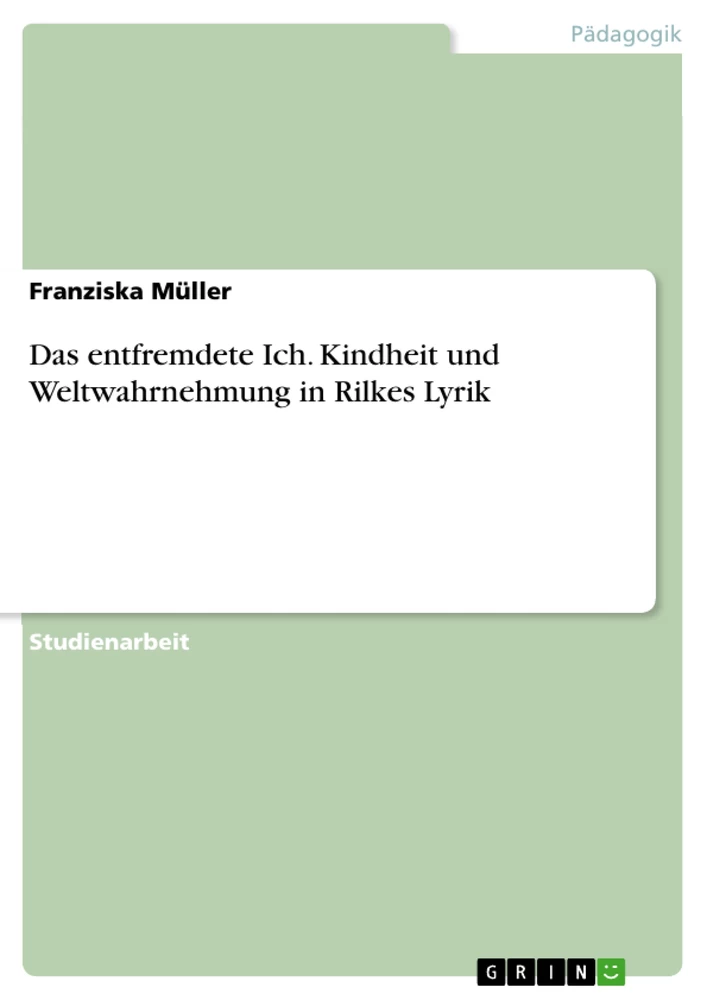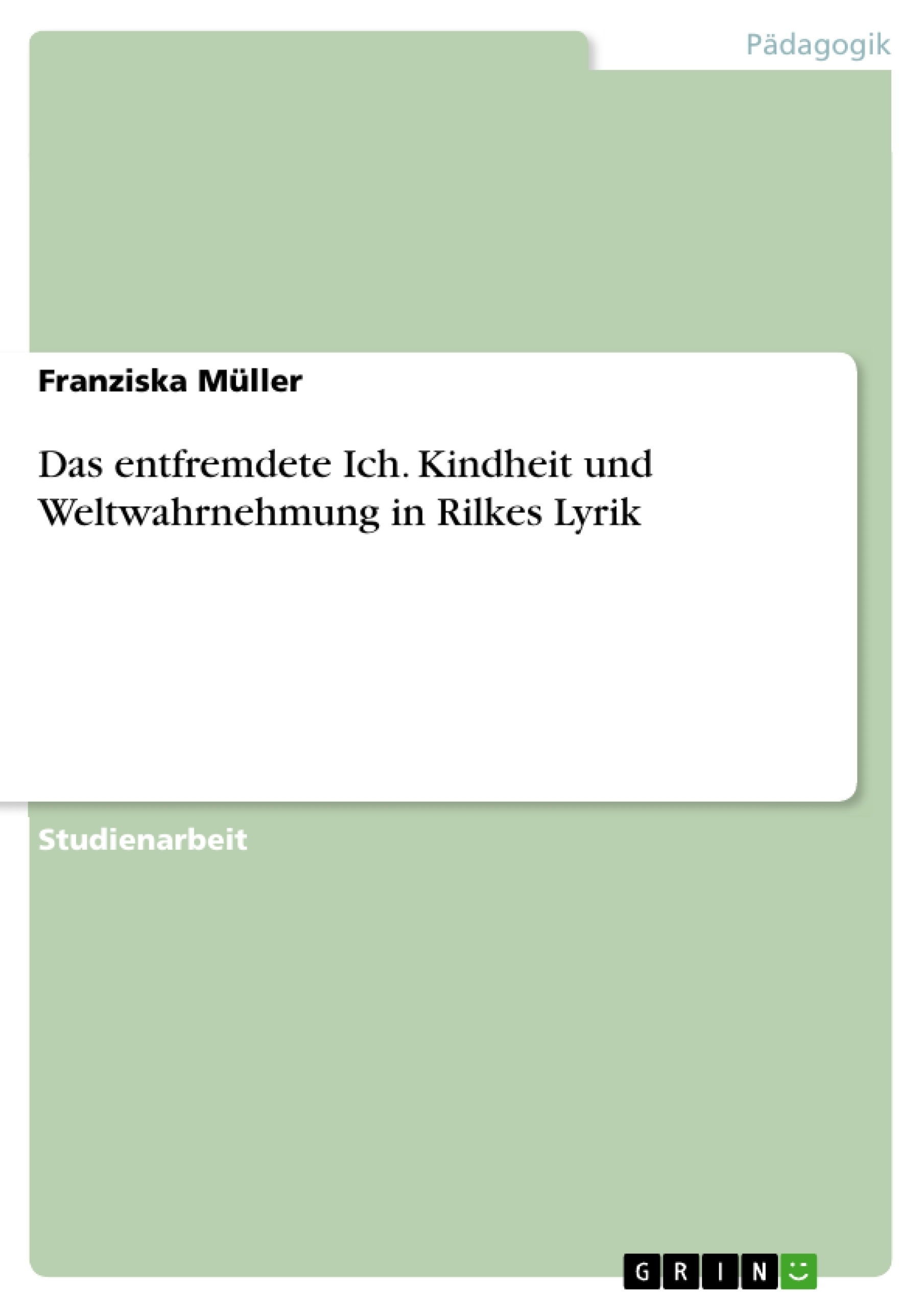Im Februar 2015 spaltet das Foto eines Kleides die Menschen in zwei Parteien: Ist das Kleid schwarz-blau oder doch eher gold-weiß? Klar ist: Unsere Wahrnehmung der Welt ist nicht so objektiv, wie wir dachten. Wenn unsere Wahrnehmung bereits auf einem Foto so subjektiv ist, wie weitreichend sind dann die Folgen für unseren Sinneseindruck der Welt insgesamt? Was ist die wahre Welt? Und vor allem: Wie können wir sicher sein, dass das, was wir sehen, tatsächlich die wahre Welt ist?
Viele Jahre vor dem Zeitalter des Internets und der „#the dress“-Debatte sah sich ein Dichter vor ähnliche Fragen gestellt. Rainer Maria Rilke beschäftigte sich ausführlich mit der menschlichen Wahrnehmung der Welt, die ihm unzureichend und oftmals falsch erschien. Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit dieser Wahrnehmung von Welt und Umwelt bei Rilke. Der Schwerpunkt wird dabei auf einer Untersuchung jener Gedichte Rilkes liegen, die sich gleichzeitig mit dem Thema Kindheit auseinandersetzen.
Zum einen soll dabei herausgefunden werden, in welchem Verhältnis die Themen Kindheit und Weltverständnis bei Rilke stehen. Des weiteren soll ermittelt werden, ob sich im Verlauf Rilkes Schaffen eine Änderung in der Verbindung dieser Elemente erkennen lässt. Dazu werden jeweils zwei Gedichte von Rilkes frühen, mittleren und späten Werken untersucht. Die gewählten Gedichte sind für Rilkes Frühwerk „Mädchenklage“ und „Kindheit“, im Falle des mittleren Schaffens „Kindheit“ und „Das Karussell“ und schließlich für das Spätwerk „Vor Weihnachten 1914“ und die „Vierte Elegie“ der „Duineser Elegien“. Die Wahl der Gedichte erfolgte auf Grund ihrer thematischen Behandlung der Kindheit und ist freilich nur als exemplarisch anzusehen. Eine vollständige Untersuchung aller Kindheitsgedichte Rilkes würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Sofern nicht anders angegeben beziehen sich die Strophen- und Versangaben in Klammern jeweils auf das in dem jeweiligen Kapitel behandelte Gedicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rilkes Frühwerk
- „Mädchen-Klage“
- „Kindheit“ 1905/06
- Rilkes mittleres Werk
- Kindheit, Neue Gedichte, 1906
- Das Karussell
- Zusammenfassung: Rilkes Mittleres und Frühes Werk
- Rilkes Spätwerk
- Weihnachten 1914
- Die Duineser Elegien
- Zusammenfassung: Weltverständnis in Rilkes Spätwerk
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Rainer Maria Rilkes Gedichten im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Kindheitserfahrungen und dem Verständnis von Welt. Es wird analysiert, wie Rilke die Wahrnehmung der Welt in seinen Gedichten darstellt und ob sich diese Darstellung im Laufe seines Schaffens verändert. Der Fokus liegt dabei auf ausgewählten Gedichten aus seinem Früh-, Mittel- und Spätwerk, um exemplarisch die Entwicklung seines Weltverständnisses aufzuzeigen.
- Die Entwicklung von Rilkes Weltverständnis im Laufe seines Lebens
- Der Zusammenhang zwischen Kindheit und Weltwahrnehmung in Rilkes Lyrik
- Die Darstellung von Einsamkeit und dem Gefühl des Verstoßenseins
- Die Veränderung der Wahrnehmung von Einsamkeit vom positiven Zustand der kindlichen Selbstgenügsamkeit zum negativen Gefühl der erwachsenen Isolation
- Die Rolle der Innerlichkeit und deren Verlust im Übergang vom Kind zum Erwachsenen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der subjektiven Wahrnehmung der Welt ein und stellt die zentrale Frage nach der Objektivität unserer Sinneserfahrungen. Sie führt Rainer Maria Rilke als zentralen Bezugspunkt ein, dessen Auseinandersetzung mit der Weltwahrnehmung im Mittelpunkt der Arbeit steht, mit dem Schwerpunkt auf der Verbindung von Kindheit und Weltverständnis in seinen Gedichten. Die Methodik der Arbeit wird erläutert, die auf der Analyse ausgewählter Gedichte aus verschiedenen Schaffensperioden Rilkes basiert.
Rilkes Frühwerk: Dieses Kapitel analysiert Rilkes Frühwerk, fokussiert auf die Gedichte "Mädchen-Klage" und "Kindheit". Es untersucht, wie Rilke die frühen Kindheitserfahrungen des lyrischen Ichs darstellt und wie diese mit dem Verständnis der Welt verbunden sind. Die Analyse konzentriert sich auf den Kontrast zwischen der positiven Wahrnehmung der Einsamkeit in der Kindheit und dem Gefühl des Verstoßenseins und der Einsamkeit im Erwachsenenalter.
Schlüsselwörter
Rainer Maria Rilke, Kindheit, Weltwahrnehmung, Einsamkeit, Lyrik, Selbstwahrnehmung, Erwachsenenwerden, Innerlichkeit, Subjektivität, Objektivität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Rilkes Lyrik und Weltverständnis
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Rainer Maria Rilkes Gedichte, um den Zusammenhang zwischen seinen Kindheitserfahrungen und seinem Verständnis der Welt aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung seiner Weltwahrnehmung im Laufe seines Lebens, dargestellt anhand ausgewählter Gedichte aus seinem Früh-, Mittel- und Spätwerk.
Welche Gedichte werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf ausgewählte Gedichte aus Rilkes Früh-, Mittel- und Spätwerk. Aus dem Frühwerk werden „Mädchen-Klage“ und „Kindheit“ untersucht. Aus dem mittleren Werk werden „Kindheit, Neue Gedichte, 1906“ und „Das Karussell“ betrachtet. Aus dem Spätwerk werden „Weihnachten 1914“ und „Die Duineser Elegien“ herangezogen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung von Rilkes Weltverständnis, den Zusammenhang zwischen Kindheit und Weltwahrnehmung in seiner Lyrik, die Darstellung von Einsamkeit und dem Gefühl des Verstoßenseins, die Veränderung der Wahrnehmung von Einsamkeit vom positiven Zustand der kindlichen Selbstgenügsamkeit zum negativen Gefühl der erwachsenen Isolation sowie die Rolle der Innerlichkeit und deren Verlust im Übergang vom Kind zum Erwachsenen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Rilkes Früh- und Mittelwerk, ein Kapitel zu Rilkes Spätwerk, jeweilige Zusammenfassungen und einen Ausblick. Die Einleitung stellt die Thematik vor und erläutert die Methodik. Die Kapitel analysieren die ausgewählten Gedichte und zeigen die Entwicklung von Rilkes Weltverständnis auf. Die Zusammenfassungen fassen die Ergebnisse der jeweiligen Kapitel zusammen. Der Ausblick gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer Analyse ausgewählter Gedichte aus verschiedenen Schaffensperioden Rilkes. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung der Weltwahrnehmung und deren Entwicklung im Laufe von Rilkes Leben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rainer Maria Rilke, Kindheit, Weltwahrnehmung, Einsamkeit, Lyrik, Selbstwahrnehmung, Erwachsenenwerden, Innerlichkeit, Subjektivität, Objektivität.
Welche zentrale Frage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Frage ist, wie sich Rilkes Weltverständnis im Laufe seines Lebens entwickelt hat und inwiefern seine Kindheitserfahrungen diese Entwicklung beeinflusst haben.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, Rilkes Entwicklung eines Weltverständnisses anhand seiner Gedichte zu untersuchen und den Einfluss seiner Kindheitserfahrungen auf diese Entwicklung aufzuzeigen.
- Quote paper
- Franziska Müller (Author), 2015, Das entfremdete Ich. Kindheit und Weltwahrnehmung in Rilkes Lyrik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345646