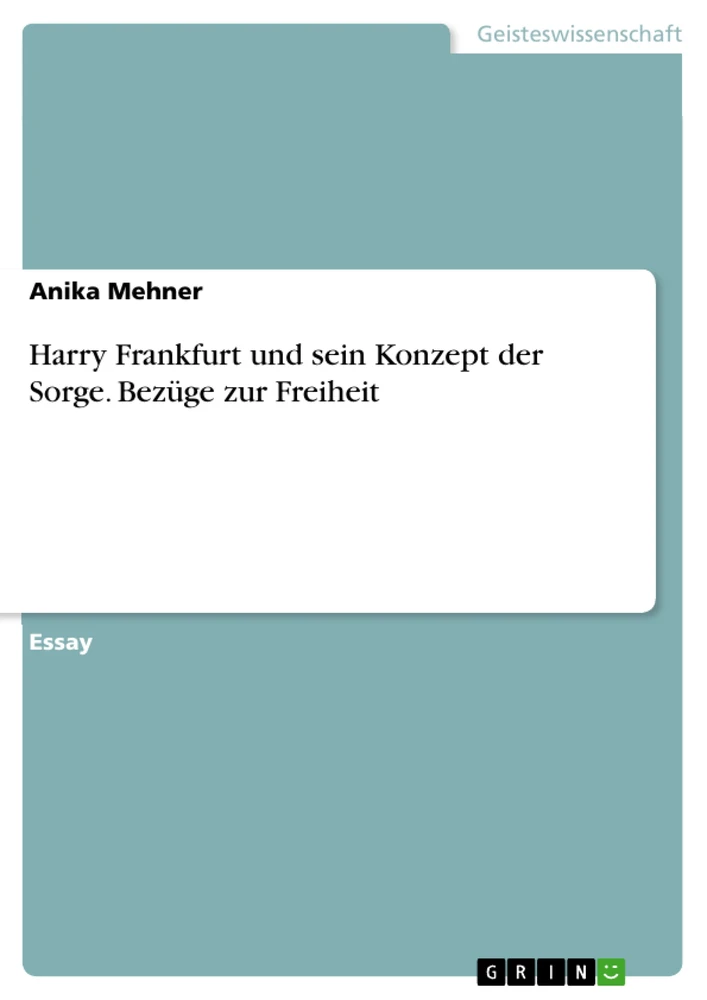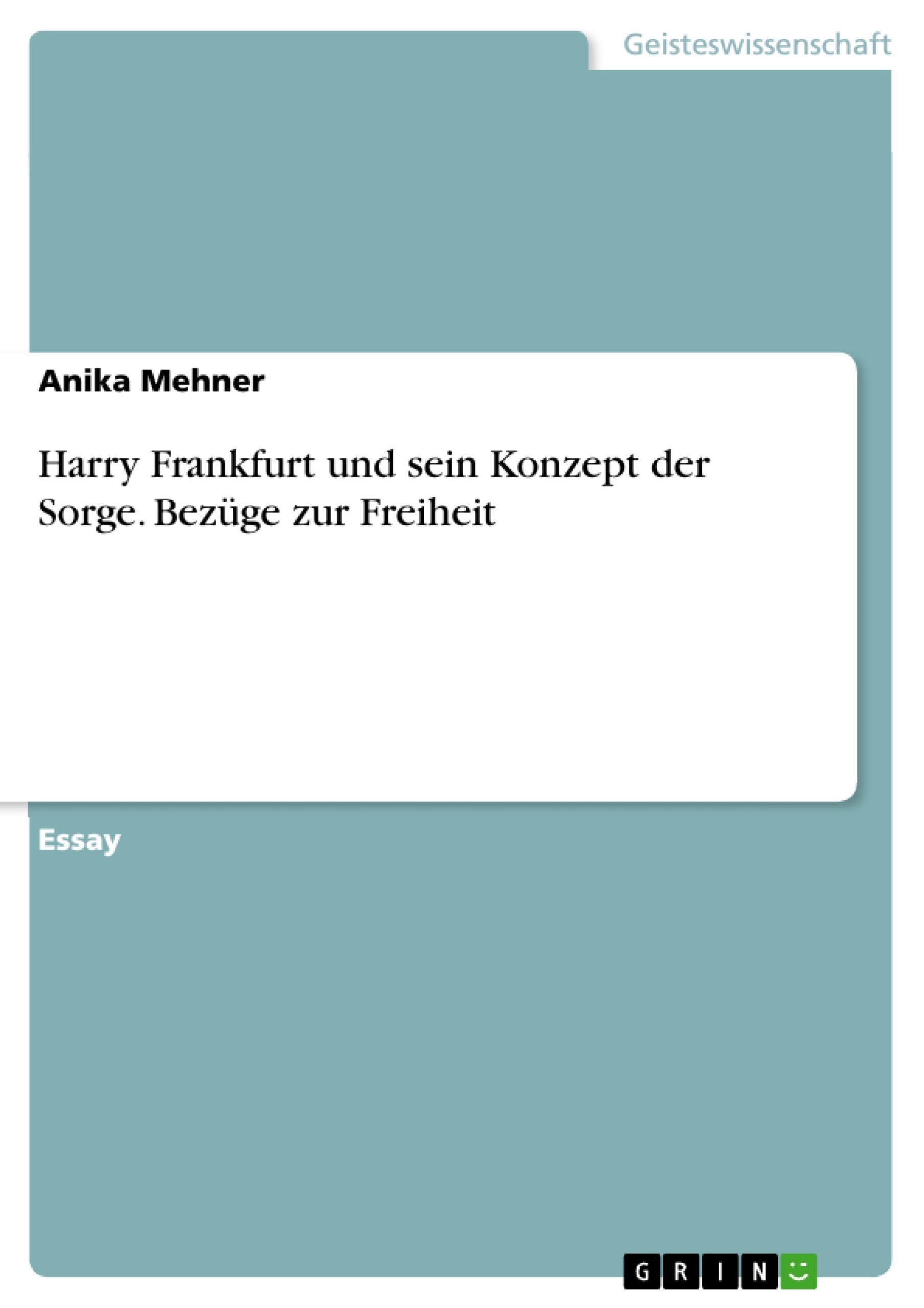Harry Frankfurt untersucht in seinem Werk „Freiheit und Selbstbestimmung“ im Kapitel „Über die Bedeutsamkeit des Sich-Sorgens“ speziell die Fähigkeit des Sich-Sorgens. Diesen Begriff fügt er in einen neuen philosophischen Themenkomplex ein und grenzt ihn von anderen ab. Er analysiert und definiert den Begriff und ordnet ihn schließlich als Sache des Willens einer Person ein. Damit einhergehend spricht er in seinen Ausführungen zu seinem Konzept der Sorge an vielen Stellen über deren Zusammenhang mit unfreiem oder freiem Willen und unfreiwilligem oder freiwilligem Handeln und einer damit vom Menschen empfundenen Freiheit, speziell bei seinem Konzept einer volitionalen Nötigung. Schließlich werden zwei Paradoxien angebracht und geklärt, bevor auf die empfundene Freiheit speziell aus Gründen der Liebe und Vernunft eingegangen wird.
Wie sich Frankfurts Sorgen – Konzept mit seinem Konzept von Willensfreiheit vereinen lässt, soll hauptsächlich im dritten Teil der Arbeit vorerst geprüft werden. Daher soll bei dieser Bearbeitung zunächst die Grundzüge seines Konzeptes der Willensfreiheit aus dem Kapitel „Willensfreiheit und der Begriff der Person“ dargelegt und später bei der Betrachtung der Sorge als Sache des Willens ein Fokus auf den vierten und fünften Abschnitt seines Kapitels „Über die Bedeutsamkeit des Sich-Sorgens“ gelegt werden. Des Weiteren soll näher auf die damit zusammenhängenden Paradoxien eingegangen werden, speziell auf jenes, bei welcher ein volitional Genötigter sich einem unfreien Willen bzw. einer unfreien Sorge freiwillig hingeben muss, um Freiheit zu erlangen. Diese Freiheit zu definieren und von Seiten der Willensfreiheit und der Sorge zu beleuchten, soll der zweite und letzte Untersuchungspunkt sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Frankfurts Konzept der Willensfreiheit
- Das Modell höherstufiger Wünsche
- In seinem Willen frei sein vs. etwas aus freiem Willen tun
- Eigene Erweiterungen
- Frankfurts Konzept der Sorge
- Dritter Forschungszweig und Abgrenzung zur Ethik
- Der Begriff des „Sich Sorgens“
- Das Sorgen als Willensakt
- Das Sorgen und die Freiheit
- Volitionale Nötigung
- Liebe und Vernunft als Gründe
- Paradoxien
- Fazit und Schlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Harry Frankfurts Konzept der Sorge und dessen Verhältnis zu seinem Konzept der Willensfreiheit. Das Hauptziel ist es, die zentralen Aspekte von Frankfurts Theorie der Sorge zu erläutern und deren Verbindung zu Freiheit und unfreiem Willen zu analysieren. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Integration des Sorgens in Frankfurts philosophisches System und die damit verbundenen Paradoxien.
- Frankfurts Modell höherstufiger Wünsche und dessen Bedeutung für die Willensfreiheit
- Der Begriff der Sorge als Willensakt bei Frankfurt
- Der Zusammenhang zwischen Sorge und volitionaler Nötigung
- Die Rolle von Liebe und Vernunft im Kontext von Freiheit und Sorge
- Paradoxien der Freiheit im Zusammenhang mit Sorge und volitionaler Nötigung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Fokus der Arbeit: die Untersuchung von Harry Frankfurts Konzept der Sorge und dessen Beziehung zur Willensfreiheit. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der die Analyse von Frankfurts Werken „Freiheit und Selbstbestimmung“ und speziell des Kapitels „Über die Bedeutsamkeit des Sich-Sorgens“ umfasst. Die Arbeit wird die zentralen Aspekte von Frankfurts Theorie der Sorge erläutern und deren Verbindung zu Freiheit und unfreiem Willen analysieren. Es wird insbesondere auf die Integration des Sorgens in Frankfurts philosophisches System und die damit verbundenen Paradoxien eingegangen.
1. Frankfurts Konzept der Willensfreiheit: Dieses Kapitel behandelt Frankfurts Theorie der Willensfreiheit, ausgehend von seinem Modell höherstufiger Wünsche. Es wird der Unterschied zwischen Wünschen erster und zweiter Stufe erläutert, wobei Wünsche zweiter Stufe als Reflexion über Wünsche erster Stufe verstanden werden. Der Wille wird als Identifikation mit einem Wunsch erster Stufe definiert, und die Willensfreiheit wird als Übereinstimmung zwischen dem Willen und der Volition zweiter Stufe dargestellt. Frankfurts Unterscheidung zwischen Personen und nicht-personenhaften Wesen anhand der Fähigkeit zur Bildung von Volitionen zweiter Stufe wird ausführlich diskutiert, unter Verwendung des Beispiels der Drogensüchtigen. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis von Frankfurts Philosophie, die im weiteren Verlauf der Arbeit auf das Konzept der Sorge angewendet wird.
2. Frankfurts Konzept der Sorge: Dieses Kapitel widmet sich Frankfurts Konzept der Sorge als eigenständigem philosophischen Forschungszweig, der sich von der Ethik abgrenzt. Es analysiert den Begriff des „Sich Sorgens“ und stellt dessen Einordnung als Willensakt dar. Die Diskussion konzentriert sich auf die Natur des Sorgens als einer Form des Wollens und auf seine Beziehung zu anderen Aspekten von Frankfurts Philosophie. Der Fokus liegt auf der Definition und Einordnung des „Sich Sorgens“ innerhalb des Gesamtkonzepts von Willensfreiheit und Handlung.
3. Das Sorgen und die Freiheit: In diesem Kapitel wird der Zusammenhang zwischen Sorge und Freiheit untersucht. Der Begriff der volitionalen Nötigung wird eingeführt und im Detail analysiert. Die Arbeit beleuchtet, wie Liebe und Vernunft als Gründe für Handeln in Konflikt mit der Willensfreiheit stehen können. Zwei Paradoxien werden vorgestellt und diskutiert: erstens die Situation, in der eine volitionale Nötigung nicht als solche empfunden wird, und zweitens die Frage, ob Liebe und Vernunft ein Gefühl von Freiheit ermöglichen, obwohl der Wille unfrei ist. Diese Paradoxien verdeutlichen die Komplexität des Verhältnisses zwischen Sorge und Freiheit in Frankfurts Philosophie.
Schlüsselwörter
Willensfreiheit, Sorge, höhere Wünsche, volitionale Nötigung, Person, Trieb, Freiheit, Vernunft, Liebe, Paradoxien, Handlungsfreiheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Harry Frankfurts Konzept der Sorge und Willensfreiheit
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Harry Frankfurts Konzept der Sorge und dessen Verhältnis zu seinem Konzept der Willensfreiheit. Das Hauptziel ist die Erläuterung der zentralen Aspekte von Frankfurts Theorie der Sorge und die Analyse deren Verbindung zu Freiheit und unfreiem Willen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Integration des Sorgens in Frankfurts philosophisches System und den damit verbundenen Paradoxien.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Frankfurts Modell höherstufiger Wünsche und deren Bedeutung für die Willensfreiheit, den Begriff der Sorge als Willensakt, den Zusammenhang zwischen Sorge und volitionaler Nötigung, die Rolle von Liebe und Vernunft im Kontext von Freiheit und Sorge sowie Paradoxien der Freiheit im Zusammenhang mit Sorge und volitionaler Nötigung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Frankfurts Konzept der Willensfreiheit und seinem Konzept der Sorge, ein Kapitel zum Verhältnis von Sorge und Freiheit sowie ein Fazit. Die Einleitung beschreibt den Fokus und den methodischen Ansatz. Die Kapitel untersuchen detailliert die genannten Konzepte und deren Zusammenhänge. Schlüsselwörter und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Was ist Frankfurts Modell höherstufiger Wünsche?
Frankfurts Modell höherstufiger Wünsche unterscheidet zwischen Wünschen erster und zweiter Stufe. Wünsche zweiter Stufe sind Reflexionen über Wünsche erster Stufe. Der Wille wird als Identifikation mit einem Wunsch erster Stufe definiert, und die Willensfreiheit als Übereinstimmung zwischen Willen und Volition zweiter Stufe dargestellt. Die Fähigkeit zur Bildung von Volitionen zweiter Stufe unterscheidet Personen von nicht-personenhaften Wesen.
Was versteht Frankfurt unter Sorge?
Frankfurt betrachtet Sorge als eigenständigen philosophischen Forschungszweig, getrennt von der Ethik. "Sich Sorgen" wird als Willensakt analysiert, als eine Form des Wollens, die in Beziehung zu anderen Aspekten von Frankfurts Philosophie steht. Der Fokus liegt auf der Definition und Einordnung des "Sich Sorgens" innerhalb des Gesamtkonzepts von Willensfreiheit und Handlung.
Wie hängen Sorge und Freiheit zusammen?
Das Kapitel zum Verhältnis von Sorge und Freiheit untersucht den Begriff der volitionalen Nötigung. Es wird beleuchtet, wie Liebe und Vernunft als Handlungsgründe mit der Willensfreiheit in Konflikt geraten können. Zwei Paradoxien werden diskutiert: die nicht-erkannte volitionale Nötigung und die Frage, ob Liebe und Vernunft trotz unfreien Willens ein Gefühl von Freiheit ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Willensfreiheit, Sorge, höhere Wünsche, volitionale Nötigung, Person, Trieb, Freiheit, Vernunft, Liebe, Paradoxien, Handlungsfreiheit.
Welche Werke von Frankfurt werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Frankfurts Werke „Freiheit und Selbstbestimmung“ und speziell das Kapitel „Über die Bedeutsamkeit des Sich-Sorgens“.
- Citar trabajo
- Anika Mehner (Autor), 2013, Harry Frankfurt und sein Konzept der Sorge. Bezüge zur Freiheit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345331