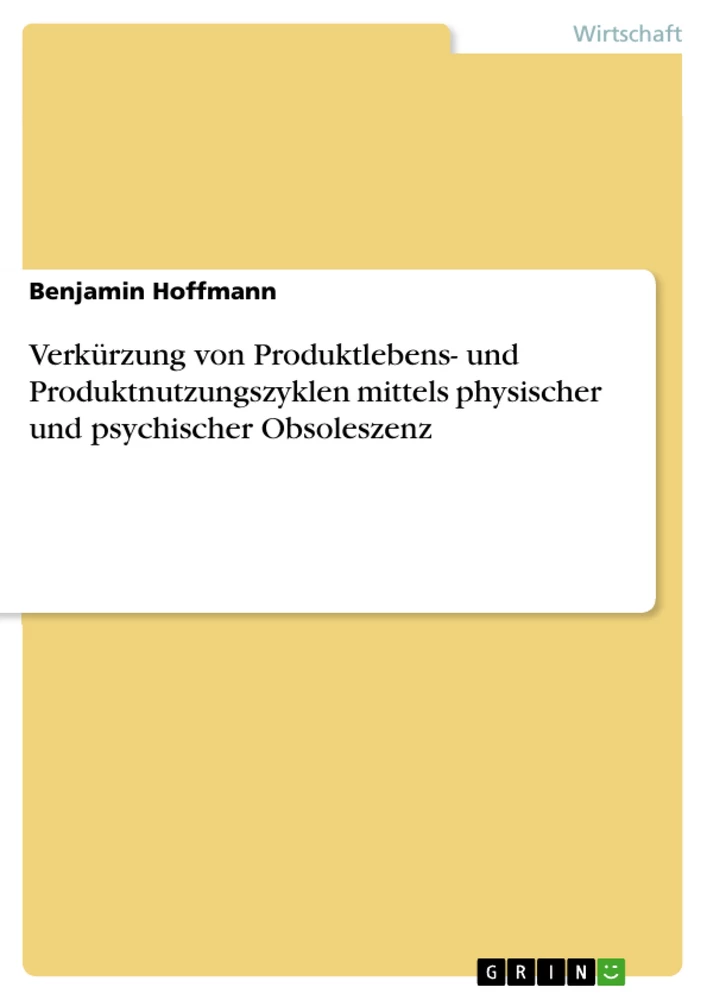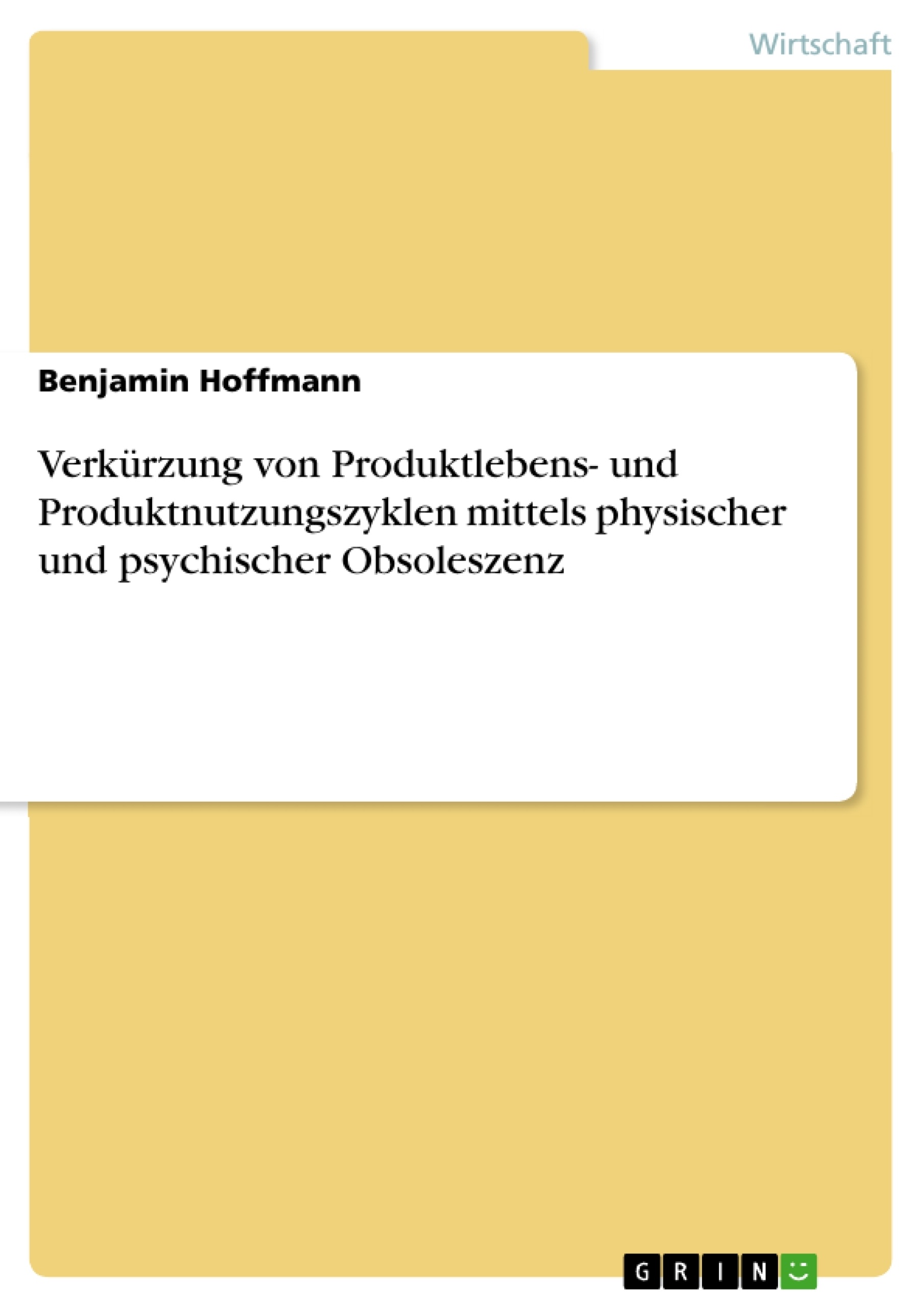Kaum ist die Garantie abgelaufen, schon ist das blöde Ding im Eimer! – Jeder kennt Geschichten über Waschmaschinen, die eigentlich über Jahre hinweg treue Dienste leisten sollten, aber bereits in den ersten fünf Jahren einen scheinbar unreparierbaren Defekt aufweisen. Genauso ist die Rede von Druckern, die, wie als wären sie darauf programmiert, nach gut zwei Jahren streiken und ihren Dienst quittieren.
Die Annahme, Unternehmen könnten ihre Produkte gezielt darauf auslegen, nach einer bestimmten Nutzungsdauer oder -häufigkeit gewisse Defekte aufzuweisen, ist mittlerweile weit verbreitet. Gerade mit Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungspflicht, so scheint es, geben diese Produkte urplötzlich den Geist auf, ohne dass eine Fehlnutzung vorliegt. Zahlreiche Beispiele erhärten die Vermutung, dass Hersteller vorsätzlich sogenannte Sollbruchstellen verbauen, um dadurch die Lebensdauer von Produkten künstlich zu verkürzen und somit die Nutzer zum Neukauf zu zwingen. Dieses Phänomen ist als physische Obsoleszenz also die geplante, körperlichen Alterung eines Produktes bekannt und in den letzten Jahren zunehmend in die Schlagzeilen geraten, wodurch auf Seiten der Verbraucher ein wachsendes Misstrauen gegenüber den Herstellern und deren Qualitätsversprechen geweckt wurde.
Generell ist eine zunehmende Tendenz hin zu immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen bzw. -nutzungsdauern zu erkennen wobei auch auffällt, dass neben dem Austausch aufgrund von technischen Defekten gerade elektronische Produkte immer häufiger ersetzt werden, obwohl das vorhandene Gerät eigentlich noch voll funktionstüchtig ist. So versuchen die Hersteller neben der körperlichen Alterung der Produkte auch durch sogenannte psychische Obsoleszenz, also der Alterung der Produkte im Auge der Konsumenten. Hierzu werden Produkte durch immer neue Eigenschaften und Fähigkeiten sowie optische bzw. modische Neuerungen ergänzt, wodurch die bis dato aktuellen schnell veraltet wirken und der Konsument so animiert wird, das Produkt neu zu kaufen, obwohl das aktuelle Produkt technisch eigentlich noch einwandfrei ist. Im Gegensatz zu der physischen Obsoleszenz, die durch einen bewussten Defekt an der Ware hervorgerufen wird, basiert die psychische Obsoleszenz also rein auf der subjektiven Wahrnehmung des Nutzers, sein Produkt sei veraltet und nicht mehr zeitgemäß.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung / Problemstellung
- 2. Die Theorie der geplanten Obsoleszenz
- 2.1 Begriffsdefinitionen und -abgrenzungen
- 2.2 Zur Theorie der geplanten Obsoleszenz und deren praktische Umsetzung von der Vergangenheit bis heute
- 2.3 Ursachen kürzerer Produktlebenszyklen
- 2.4 Gibt es geplante Obsoleszenz?
- 2.5 Möglichkeiten zur gezielten Einflussnahme auf die Lebensdauer von Produkten seitens der Hersteller
- 3. Physische Obsoleszenz
- 3.1 Mangelnde Qualität, Sollbruchstellen und weitere Maßnahmen physischer Obsoleszenz
- 3.2 Häufig von physischer Obsoleszenz betroffene Produkte und Produktarten
- 3.3 Optimierung von Produktnutzungszyklen
- 4. Psychische Obsoleszenz
- 4.1 Theoretische Betrachtung der psychischen Obsoleszenz
- 4.2 Frühe praktische Ansätze der psychischen Obsoleszenz
- 4.3 Wie psychische Obsoleszenz die Lebenszyklen sowie die Nutzungsdauer von Produkten beeinflusst
- 4.4 Marketing als Treiber von psychischer Obsoleszenz
- 5. Verschiedene Auswirkungen als Resultat von verkürzten Produktlebens- und Produktnutzungszyklen
- 5.1 Einfluss auf den Verbraucher und die Gesellschaft
- 5.2 Einfluss auf Wachstum und Beschäftigung
- 5.3 Überflussproduktion und die Entwicklung zur Wegwerfgesellschaft
- 5.4 Ökologische Belastung durch Ressourcenverschwendung und zunehmende Abfallmengen
- 6. Maßnahmen zur Bekämpfung von geplanter Obsoleszenz
- 6.1 Politische Maßnahmen und Regulierungsmöglichkeiten
- 6.2 Gesellschaftliche Gegenbewegungen zur Wegwerfgesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Phänomen der geplanten Obsoleszenz, ihre verschiedenen Ausprägungen (physisch und psychisch) und die Auswirkungen auf Konsumenten, Wirtschaft und Umwelt. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Thematik zu entwickeln und mögliche Maßnahmen zur Bekämpfung zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung der geplanten Obsoleszenz
- Analyse der physischen und psychischen Obsoleszenz
- Auswirkungen verkürzter Produktlebenszyklen auf Verbraucher und Gesellschaft
- Ökologische Folgen der Wegwerfgesellschaft
- Möglichkeiten zur Bekämpfung der geplanten Obsoleszenz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung / Problemstellung: Die Einleitung beschreibt das allgegenwärtige Problem von Produkten, die kurz nach Ablauf der Garantie ausfallen. Sie führt das Konzept der geplanten Obsoleszenz ein, sowohl physisch (durch eingebaute Sollbruchstellen) als auch psychisch (durch Marketing, das Produkte schnell veraltet erscheinen lässt). Die Einleitung stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor: Wie wirkt sich geplante Obsoleszenz auf Konsumenten, Wirtschaft und Umwelt aus? Welche Gegenmaßnahmen sind denkbar?
2. Die Theorie der geplanten Obsoleszenz: Dieses Kapitel befasst sich mit der theoretischen Fundierung des Konzepts der geplanten Obsoleszenz. Es definiert den Begriff, untersucht seine historische Entwicklung und beleuchtet die verschiedenen Strategien der Hersteller, die Lebensdauer von Produkten zu beeinflussen. Es werden unterschiedliche Ursachen für kürzere Produktlebenszyklen analysiert und die Frage nach dem tatsächlichen Vorhandensein von geplanter Obsoleszenz diskutiert. Der Fokus liegt auf der Erläuterung der theoretischen Grundlagen und der verschiedenen Facetten des Phänomens.
3. Physische Obsoleszenz: Hier wird die physische Obsoleszenz im Detail betrachtet. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse von mangelnder Qualität, eingebauten Sollbruchstellen und anderen Maßnahmen, die die Lebensdauer von Produkten verkürzen. Das Kapitel untersucht Produkte, die besonders häufig von physischer Obsoleszenz betroffen sind, und diskutiert Möglichkeiten zur Optimierung der Produktnutzungszyklen. Es liefert konkrete Beispiele und verdeutlicht die Auswirkungen dieser Praktiken.
4. Psychische Obsoleszenz: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die psychische Obsoleszenz, die auf der subjektiven Wahrnehmung des Konsumenten basiert, dass sein Produkt veraltet ist. Es untersucht die theoretischen Grundlagen und die frühen Ansätze der psychischen Obsoleszenz, zeigt wie sie die Lebenszyklen und Nutzungsdauer von Produkten beeinflusst und analysiert die Rolle des Marketings als Triebkraft. Es erklärt den Unterschied zur physischen Obsoleszenz und hebt die Bedeutung der wahrgenommenen Veralterung hervor.
5. Verschiedene Auswirkungen als Resultat von verkürzten Produktlebens- und Produktnutzungszyklen: Dieses Kapitel analysiert die weitreichenden Konsequenzen verkürzter Produktlebenszyklen. Es untersucht die Auswirkungen auf den Verbraucher und die Gesellschaft, auf Wachstum und Beschäftigung, auf die Überflussproduktion und die Entwicklung zur Wegwerfgesellschaft sowie die ökologische Belastung durch Ressourcenverschwendung und zunehmende Abfallmengen. Die Kapitel beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen Konsumverhalten, Wirtschaft und Umwelt.
6. Maßnahmen zur Bekämpfung von geplanter Obsoleszenz: Das Kapitel skizziert mögliche Maßnahmen zur Bekämpfung geplanter Obsoleszenz. Es untersucht politische Maßnahmen und Regulierungsmöglichkeiten sowie gesellschaftliche Gegenbewegungen zur Wegwerfgesellschaft. Es beleuchtet unterschiedliche Ansätze, um den negativen Folgen der geplanten Obsoleszenz entgegenzuwirken und nachhaltigere Konsummuster zu fördern.
Schlüsselwörter
Geplante Obsoleszenz, Physische Obsoleszenz, Psychische Obsoleszenz, Produktlebenszyklen, Produktnutzungsdauer, Wegwerfgesellschaft, Konsumverhalten, Nachhaltigkeit, Umweltbelastung, politische Regulierung, gesellschaftliche Gegenbewegungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Geplante Obsoleszenz: Eine umfassende Analyse"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Phänomen der geplanten Obsoleszenz umfassend. Sie analysiert die verschiedenen Ausprägungen (physisch und psychisch), die Auswirkungen auf Konsumenten, Wirtschaft und Umwelt und beleuchtet mögliche Gegenmaßnahmen.
Welche Arten von Obsoleszenz werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen physischer und psychischer Obsoleszenz. Physische Obsoleszenz bezieht sich auf die durch Konstruktion (z.B. Sollbruchstellen) verkürzte Lebensdauer von Produkten. Psychische Obsoleszenz hingegen beschreibt die vom Marketing induzierte Wahrnehmung der Veralterung eines Produkts, auch wenn es technisch noch funktionsfähig ist.
Wie wird geplante Obsoleszenz definiert?
Die Arbeit definiert geplante Obsoleszenz als die bewusste Verkürzung der Lebensdauer von Produkten durch Hersteller, um den Konsum anzuregen. Dies geschieht sowohl durch physische Maßnahmen (Mangelnde Qualität, Sollbruchstellen) als auch durch psychische Strategien (Marketing, das Produkte schnell veraltet erscheinen lässt).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Einführung/Problemstellung, 2. Die Theorie der geplanten Obsoleszenz, 3. Physische Obsoleszenz, 4. Psychische Obsoleszenz, 5. Auswirkungen verkürzter Produktlebenszyklen und 6. Maßnahmen zur Bekämpfung geplanter Obsoleszenz.
Welche Auswirkungen verkürzter Produktlebenszyklen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen auf Verbraucher und Gesellschaft (z.B. erhöhter Konsum), auf Wachstum und Beschäftigung (z.B. Überflussproduktion), auf die Entwicklung zur Wegwerfgesellschaft und auf die Umweltbelastung (Ressourcenverschwendung, Abfallmengen).
Welche Maßnahmen zur Bekämpfung geplanter Obsoleszenz werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert politische Maßnahmen und Regulierungsmöglichkeiten sowie gesellschaftliche Gegenbewegungen, um den negativen Folgen der geplanten Obsoleszenz entgegenzuwirken und nachhaltigere Konsummuster zu fördern.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geplante Obsoleszenz, Physische Obsoleszenz, Psychische Obsoleszenz, Produktlebenszyklen, Produktnutzungsdauer, Wegwerfgesellschaft, Konsumverhalten, Nachhaltigkeit, Umweltbelastung, politische Regulierung, gesellschaftliche Gegenbewegungen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der geplanten Obsoleszenz zu entwickeln und mögliche Maßnahmen zur Bekämpfung zu beleuchten. Sie analysiert die verschiedenen Facetten des Phänomens und dessen Auswirkungen auf Konsumenten, Wirtschaft und Umwelt.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die zentralen Forschungsfragen sind: Wie wirkt sich geplante Obsoleszenz auf Konsumenten, Wirtschaft und Umwelt aus? Welche Gegenmaßnahmen sind denkbar?
- Quote paper
- Dipl. Betriebswirt (VWA) Benjamin Hoffmann (Author), 2016, Verkürzung von Produktlebens- und Produktnutzungszyklen mittels physischer und psychischer Obsoleszenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345329