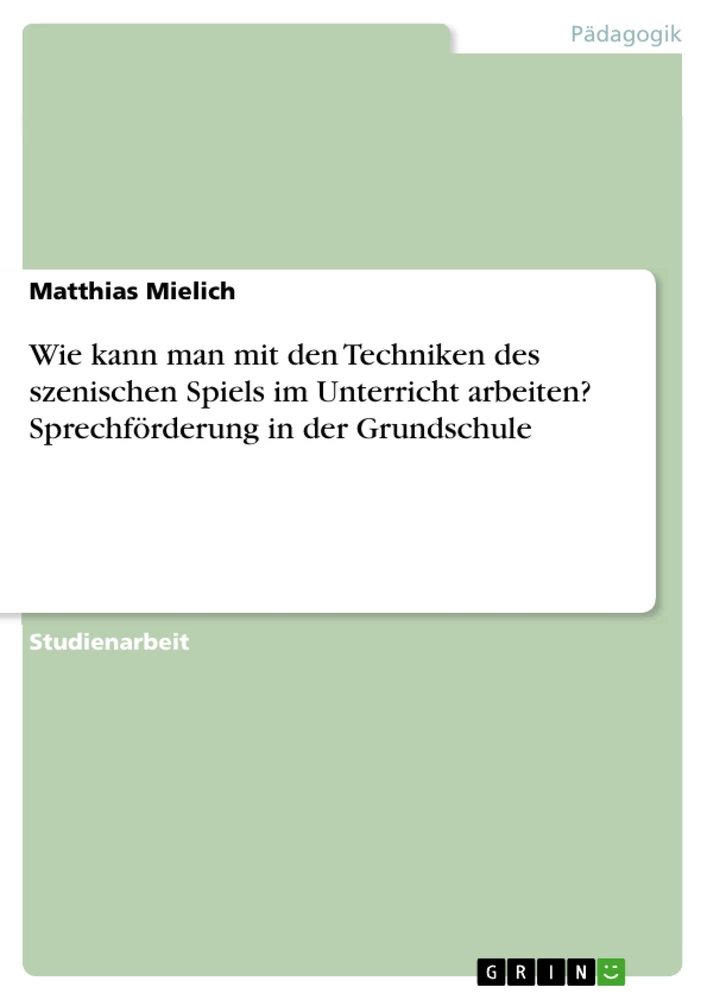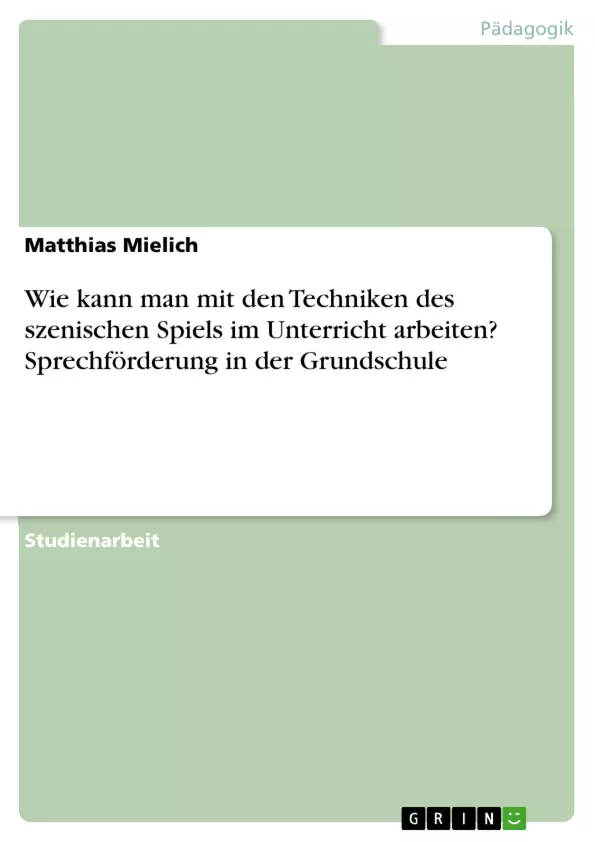Theater als Methode im Sprach-(förder)unterricht ist vorteilhaft für den Sprachlernprozess und die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit des Lerners. Der ganzheitliche Ansatz, das Lernen mit Kopf, Herz und Körper begünstigt den Sprachlernprozess und bietet die Möglichkeit, den Unterricht motivierend, stressfrei und somit erfolgreich zu gestalten.
(Berthold 2010: 4)
Mit dieser Aussage beschreibt Karin Berthold präzise, welche wichtige Bedeutung das szenische Spiel oder im engeren Sinne die Dramapädagogik in der Sprachförderung Deutsch als Zweitsprache einnimmt.
Lange Zeit wurde das szenische Spiel im Rahmen des DaF/DaZ-Unterrichts vernachlässigt, während seit jeher von Seiten der Lehrkräfte große Unsicherheit bezüglich der Umsetzung dieser Form des sozialen Lernens bestand (vgl. Mairose-Parovsky (1997): 116f.).
Deshalb stellt sich natürlich die Frage, welches Potenzial im Einsatz dramapädagogischer Methoden zur Sprechförderung im DaF/DaZ-Unterricht der Grundschule steckt.
Wie kann man effektiv mit den Techniken des szenischen Spiels im Unterricht arbeiten?
Wie lassen sich diese konkret in der Praxis umsetzen und was sollte dabei didaktisch beachtet werden? Auf diese Fragen soll in der vorliegenden Arbeit eine Antwort gefunden werden. Zunächst wird darauf eingegangen, welche Gründe für den vermehrten Einsatz von dramapädagogischen Methoden in der Grundschule sprechen und welche Ziele damit erreicht werden sollen. Des Weiteren werden didaktische Grundlagen zum szenischen Lernen und damit einhergehend Grundideen zur dramapädagogischen Gestaltung von DaF/DaZ-Stunden vorgestellt.
Darüber hinaus widmet sich die Arbeit einzelnen Inszenierungstechniken und Methoden des szenischen Spiels, sowie den didaktischen Prinzipien. Abschließend werden im Praxisteil anhand von konkreten Beispielen aufgezeigt, wie Sprechförderung in der Grundschule mithilfe des szenischen Spiels umgesetzt werden kann.
Dabei soll deutlich gemacht werden, welche Chancen und Möglichkeiten das szenische Spiel im Hinblick auf das Sprechen und Kommunizieren, die Persönlichkeitsentwicklung und den interkulturellen Austausch besitzt.
Am Ende der Arbeit werden in einem abschließenden Resümee die wichtigsten Ergebnisse festgehalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Potenzial dramapädagogischer Methoden zur Förderung des Sprechens und Kommunizierens
- Grundlagen zum szenischen Lernen und Interpretieren im Literaturunterricht der Grundschule
- Didaktische Grundideen zur dramapädagogischen Gestaltung und Umsetzung von DaF-Stunden
- Inszenierungstechniken und Methoden des szenischen Spiels für einen dramapädagogischen DaF-Unterricht. Beispiele
- Praxisteil: Sprechförderung mithilfe des szenischen Spiels an konkreten Beispielen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einsatz von dramapädagogischen Methoden zur Förderung des Sprechens und Kommunizierens im DaF/DaZ-Unterricht der Grundschule. Ziel ist es, das Potenzial des szenischen Spiels in diesem Kontext aufzuzeigen und konkrete Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis aufzuzeigen.
- Das Potenzial des szenischen Spiels im DaF/DaZ-Unterricht
- Didaktische Grundlagen zum szenischen Lernen und Interpretieren
- Inszenierungstechniken und Methoden des szenischen Spiels für einen dramapädagogischen DaF-Unterricht
- Praktische Anwendungsmöglichkeiten der Sprechförderung durch szenisches Spiel
- Chancen und Möglichkeiten des szenischen Spiels im Hinblick auf Sprechen, Kommunizieren und interkulturellen Austausch
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung des szenischen Spiels im Sprachlernprozess und die Hintergründe des vermehrten Einsatzes dramapädagogischer Methoden in der Grundschule beleuchtet. Im zweiten Kapitel wird das Potenzial dramapädagogischer Methoden für die Förderung des Sprechens und Kommunizierens im DaZ-Unterricht der Grundschule erläutert. Dabei werden die Vorteile des ganzheitlichen Lernansatzes, die Steigerung der Motivation und die Förderung der individuellen Sprachkompetenz sowie die Stärkung der sozialen und interkulturellen Kompetenzen herausgestellt. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den didaktischen Grundlagen des szenischen Lernens und Interpretierens im Literaturunterricht der Grundschule. Die Arbeit geht dann auf die didaktischen Grundideen zur dramapädagogischen Gestaltung und Umsetzung von DaF-Stunden ein. Im fünften Kapitel werden Inszenierungstechniken und Methoden des szenischen Spiels für einen dramapädagogischen DaF-Unterricht vorgestellt. Anhand von Beispielen werden die verschiedenen Techniken erläutert und ihre Einsatzmöglichkeiten im Unterricht aufgezeigt. Der Praxisteil der Arbeit stellt konkrete Beispiele für die Sprechförderung mithilfe des szenischen Spiels in der Grundschule vor. Dabei wird deutlich gemacht, wie das szenische Spiel zur Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten, zur Förderung der Persönlichkeit und zur Stärkung des interkulturellen Austausches beitragen kann.
Schlüsselwörter
DaF/DaZ-Unterricht, dramapädagogische Methoden, szenisches Spiel, Sprechförderung, Grundschule, ganzheitliches Lernen, Kommunikation, Interaktion, interkultureller Austausch, Handlungskompetenz, Persönlichkeitsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Dramapädagogik im Sprachunterricht?
Es ist eine Methode, bei der theatrale Elemente und szenisches Spiel genutzt werden, um Sprache ganzheitlich mit Kopf, Herz und Körper zu lernen.
Wie fördert szenisches Spiel die Sprechkompetenz?
Durch das Schlüpfen in Rollen sinkt die Hemmschwelle zu sprechen. Schüler kommunizieren in geschützten, fiktiven Situationen motivierter und stressfreier.
Welche Techniken des szenischen Spiels gibt es?
Dazu gehören Standbilder, Rolleninterviews, Pantomime oder das laute Mitsprechen von Gedanken einer Figur.
Ist szenisches Spiel auch für DaZ-Schüler (Deutsch als Zweitsprache) geeignet?
Ja, besonders in der Grundschule hilft es, sprachliche und interkulturelle Barrieren abzubauen und die Persönlichkeitsentwicklung zu stärken.
Was sollten Lehrkräfte bei der Umsetzung beachten?
Wichtig sind eine klare Struktur, die Auswahl altersgerechter Themen und die Schaffung einer wertschätzenden Atmosphäre, in der sich alle Schüler trauen, mitzuwirken.
- Quote paper
- Matthias Mielich (Author), 2016, Wie kann man mit den Techniken des szenischen Spiels im Unterricht arbeiten? Sprechförderung in der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345262