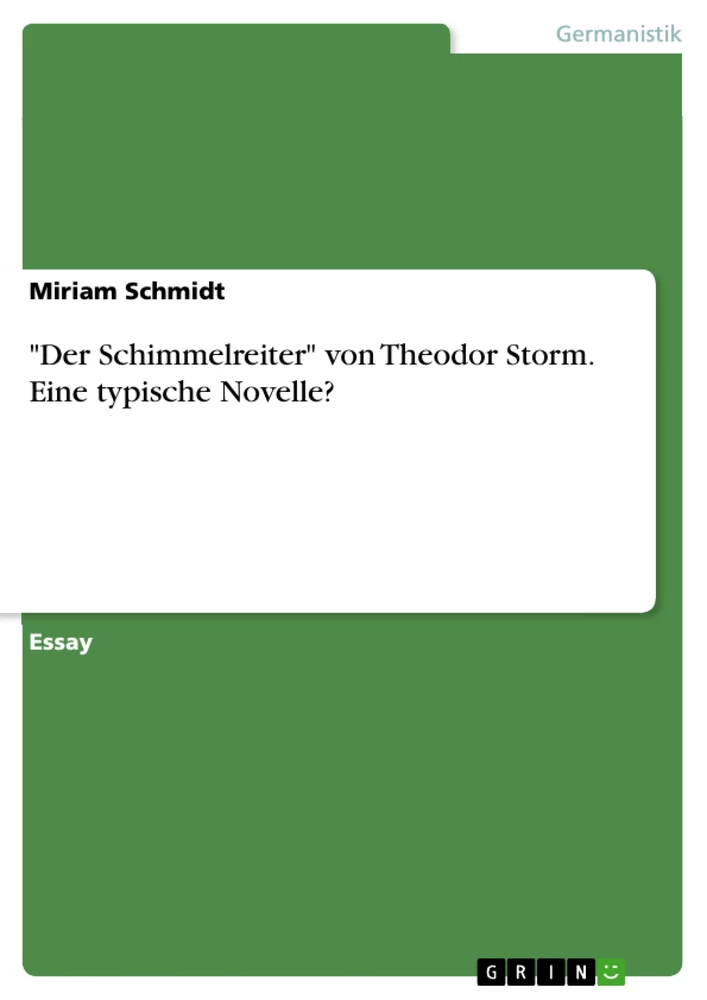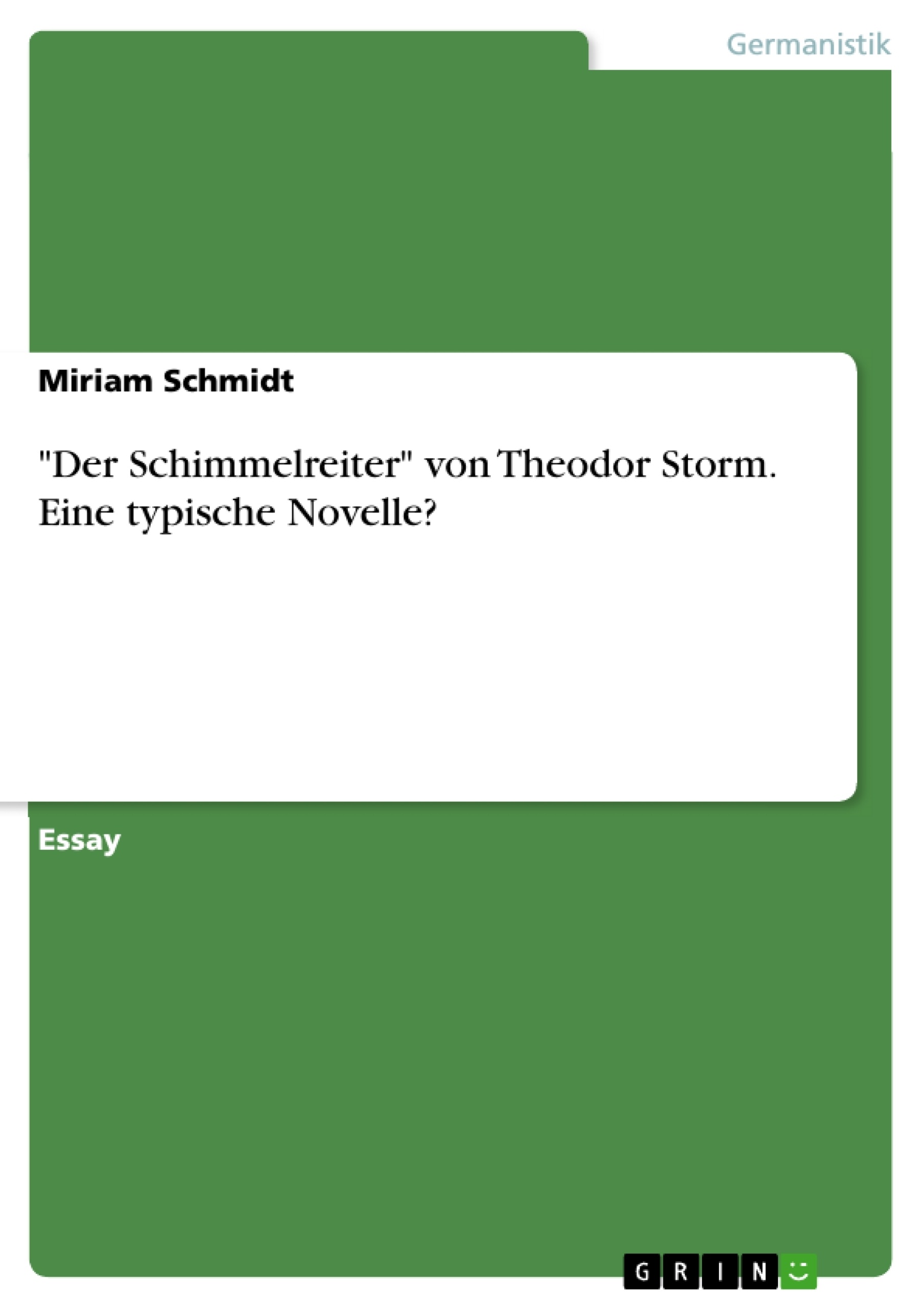Der Essay behandelt die Fragestellung, inwiefern die Novelle „Der Schimmelreiter“ von Theodor Storm ein Beispiel für eine typische Novelle ist, beziehungsweise den bekannten Novellenkriterien entspricht.
Hierfür werden verschiedene Definitionen der Novelle herangezogen und auf Storms Novelle angewendet. Theodor Storm selbst hat ebenfalls eine Definition verfasst, welche auch in Bezug auf den „Schimmelreiter“ diskutiert wird. Aus diesen Definitionen ergeben sich einige wiederkehrende Kriterien für die Textsorte Novelle. Diese Kriterien sind hilfreich, um den „Schimmelreiter“ als Novelle einordnen zu können. Außerdem wird die Frage erörtert, ob diese Novelle ein typisches Beispiel ihrer Gattung darstellt.
Die Novelle „Der Schimmelreiter“ von Theodor Storm wurde im Jahr 1888 veröffentlicht und erzählt die Geschichte von einem Deichgrafen in Norddeutschland, mit Namen Hauke Haien. Dabei gibt es zwei Rahmenhandlungen innerhalb derer die Erzählung stattfindet. Ein immer wiederkehrender Konflikt in der Novelle ist die Gegenüberstellung von Technik und rationalem Denken auf der einen und dem Aberglauben auf der andern Seite.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen der Novelle
- Unerhörte Begebenheiten
- Das Dingsymbol
- Storms Novellendefinition und „Der Schimmelreiter“
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht, inwieweit Theodor Storms Novelle „Der Schimmelreiter“ den Kriterien einer typischen Novelle entspricht. Hierzu werden verschiedene Definitionen der Novelle herangezogen und auf Storms Werk angewendet. Der Fokus liegt auf der Einordnung des „Schimmelreiters“ in die Gattung der Novelle und der Analyse, ob es ein typisches Beispiel dieser Gattung darstellt.
- Definitionen und Kriterien der Novelle
- Analyse unerhörter Begebenheiten im „Schimmelreiter“
- Die Rolle des Dingsymbols
- Storms eigene Definition der Novelle und deren Anwendung auf den „Schimmelreiter“
- Vergleich des „Schimmelreiters“ mit typischen Novellenmerkmalen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Der Essay untersucht, ob Theodor Storms „Der Schimmelreiter“ den Kriterien einer typischen Novelle entspricht. Es werden verschiedene Definitionen der Novelle herangezogen und auf das Werk angewendet, um die Einordnung und den Typus der Novelle zu bestimmen.
Definitionen der Novelle: Der Essay präsentiert verschiedene Definitionen der Novelle von Autoren wie Wieland, Goethe und Heyse. Diese Definitionen betonen Aspekte wie die Simplizität des Plans, den kleinen Umfang, das Auftreten einer unerhörten Begebenheit, die Konzentration auf einen zentralen Punkt und die Wirkung einer verdichteten Erzählung. Diese Kriterien werden im weiteren Verlauf des Essays auf "Der Schimmelreiter" angewendet.
Unerhörte Begebenheiten: Dieser Abschnitt analysiert das Vorkommen „unerhörter Begebenheiten“ in Storms Novelle, wie sie von Goethe definiert werden. Der Kauf des Schimmels durch Hauke Haien wird als eine solche Begebenheit interpretiert, die als Metapher für einen Pakt mit dem Teufel gelesen werden kann. Diese unerhörte Begebenheit trägt zur Einstufung als typische Novelle bei.
Das Dingsymbol: Der Essay diskutiert das Konzept des Dingsymbols nach Heyse und seine Relevanz für die Novelle. Der Schimmel wird als potenzielles Dingsymbol des „Schimmelreiters“ identifiziert, da er den metaphorischen Teufelspakt und das Scheitern Hauke Haiens symbolisiert. Die Bedeutung und Interpretation von Dingsymbolen und deren Einfluss auf die Gesamtdeutung der Novelle wird kritisch hinterfragt.
Storms Novellendefinition und „Der Schimmelreiter“: Storms eigene Definition der Novelle als Schwester des Dramas mit einem zentralen Konflikt wird herangezogen. Im „Schimmelreiter“ wird der Konflikt zwischen Aberglauben und technischem Fortschritt, Glaube und Vernunft als zentrales Element identifiziert. Die geschlossene Form der Erzählung, der Aufbau der Handlung und die Katastrophe am Ende werden im Kontext dieser Definition analysiert.
Schlussfolgerung: Abschließend wird festgestellt, dass „Der Schimmelreiter“, obwohl er einige untypische Merkmale aufweist (z.B. Länge, ausführliche Charakterisierung), den Kriterien einer Novelle weitgehend entspricht. Die Einhaltung von Storms eigenen Kriterien, wie die geschlossene Form und das zentrale Konfliktgeschehen werden hervorgehoben, jedoch werden auch abweichende Punkte, wie die Länge und der detaillierte Schreibstil erwähnt. Die Frage nach dem Einfluss des Zufalls und des Schicksals auf die Handlung wird als Hauptkonflikt des Werkes diskutiert.
Schlüsselwörter
Novelle, Theodor Storm, Der Schimmelreiter, Novellenkriterien, unerhörte Begebenheit, Dingsymbol, Aberglaube, Technik, Konflikt, Drama, Rahmenerzählung, Schicksal, Zufall.
Häufig gestellte Fragen zu Theodor Storms „Der Schimmelreiter“ - Essay
Was ist der Gegenstand des Essays?
Der Essay untersucht, inwieweit Theodor Storms Novelle „Der Schimmelreiter“ den Kriterien einer typischen Novelle entspricht. Er analysiert das Werk anhand verschiedener Definitionen der Novelle und untersucht, ob es als typisches Beispiel dieser Gattung angesehen werden kann.
Welche Definitionen der Novelle werden im Essay verwendet?
Der Essay bezieht sich auf verschiedene Definitionen der Novelle von Autoren wie Wieland, Goethe und Heyse. Diese Definitionen betonen Aspekte wie die Simplizität des Plans, den kleinen Umfang, das Auftreten einer unerhörten Begebenheit, die Konzentration auf einen zentralen Punkt und die Wirkung einer verdichteten Erzählung.
Welche Rolle spielt die „unerhörte Begebenheit“ im „Schimmelreiter“?
Der Essay interpretiert den Kauf des Schimmels durch Hauke Haien als eine „unerhörte Begebenheit“ im Sinne Goethes. Diese Begebenheit wird als Metapher für einen Pakt mit dem Teufel gedeutet und trägt zur Einstufung des Werkes als typische Novelle bei.
Welche Bedeutung hat das Dingsymbol im Essay?
Der Essay diskutiert das Konzept des Dingsymbols nach Heyse und identifiziert den Schimmel als potenzielles Dingsymbol im „Schimmelreiter“. Es symbolisiert den metaphorischen Teufelspakt und das Scheitern Hauke Haiens. Die Bedeutung und Interpretation von Dingsymbolen und deren Einfluss auf die Gesamtdeutung der Novelle wird kritisch hinterfragt.
Wie wird Storms eigene Novellendefinition im Essay verwendet?
Storms eigene Definition der Novelle als Schwester des Dramas mit einem zentralen Konflikt wird herangezogen. Im „Schimmelreiter“ wird der Konflikt zwischen Aberglauben und technischem Fortschritt, Glaube und Vernunft als zentrales Element identifiziert. Die geschlossene Form der Erzählung, der Aufbau der Handlung und die Katastrophe am Ende werden im Kontext dieser Definition analysiert.
Kommt „Der Schimmelreiter“ den Kriterien einer typischen Novelle entgegen?
Der Essay kommt zu dem Schluss, dass „Der Schimmelreiter“, trotz einiger untypischer Merkmale (z.B. Länge, ausführliche Charakterisierung), den Kriterien einer Novelle weitgehend entspricht. Die Einhaltung von Storms eigenen Kriterien, wie die geschlossene Form und das zentrale Konfliktgeschehen werden hervorgehoben, jedoch werden auch abweichende Punkte, wie die Länge und der detaillierte Schreibstil erwähnt. Die Frage nach dem Einfluss des Zufalls und des Schicksals auf die Handlung wird als Hauptkonflikt des Werkes diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Essay?
Schlüsselwörter sind: Novelle, Theodor Storm, Der Schimmelreiter, Novellenkriterien, unerhörte Begebenheit, Dingsymbol, Aberglaube, Technik, Konflikt, Drama, Rahmenerzählung, Schicksal, Zufall.
Welche Kapitel umfasst der Essay?
Der Essay gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Definitionen der Novelle, Unerhörte Begebenheiten, Das Dingsymbol, Storms Novellendefinition und „Der Schimmelreiter“, Schlussfolgerung.
Welche Zielsetzung verfolgt der Essay?
Der Essay zielt darauf ab, die Einordnung von Storms „Der Schimmelreiter“ in die Gattung der Novelle zu untersuchen und zu analysieren, ob es sich um ein typisches Beispiel dieser Gattung handelt.
- Quote paper
- Miriam Schmidt (Author), 2015, "Der Schimmelreiter" von Theodor Storm. Eine typische Novelle?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345034