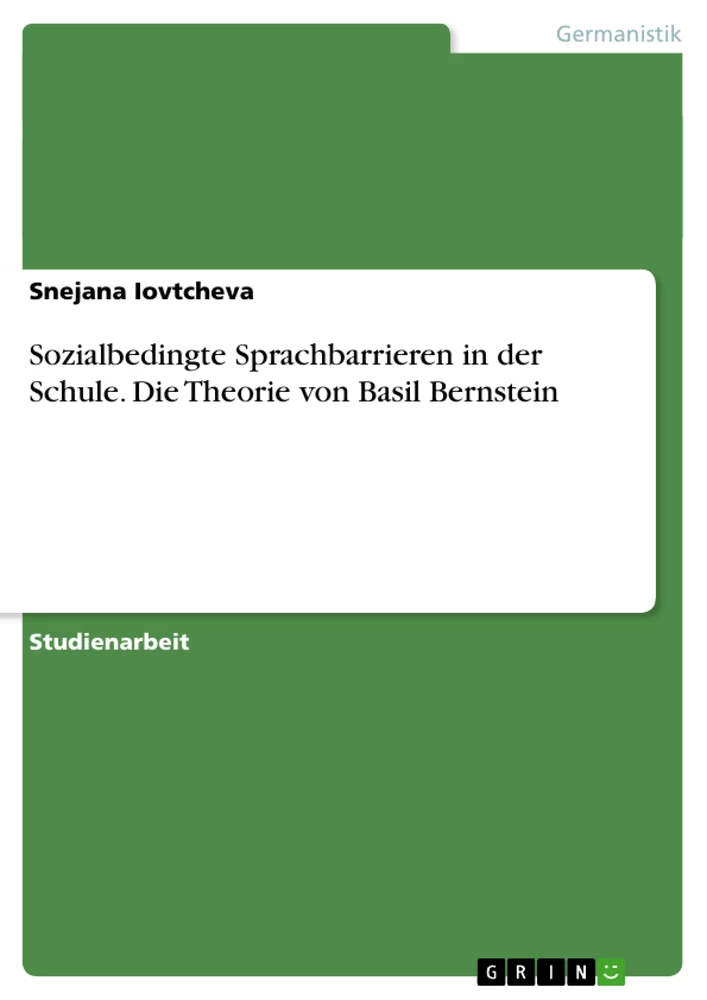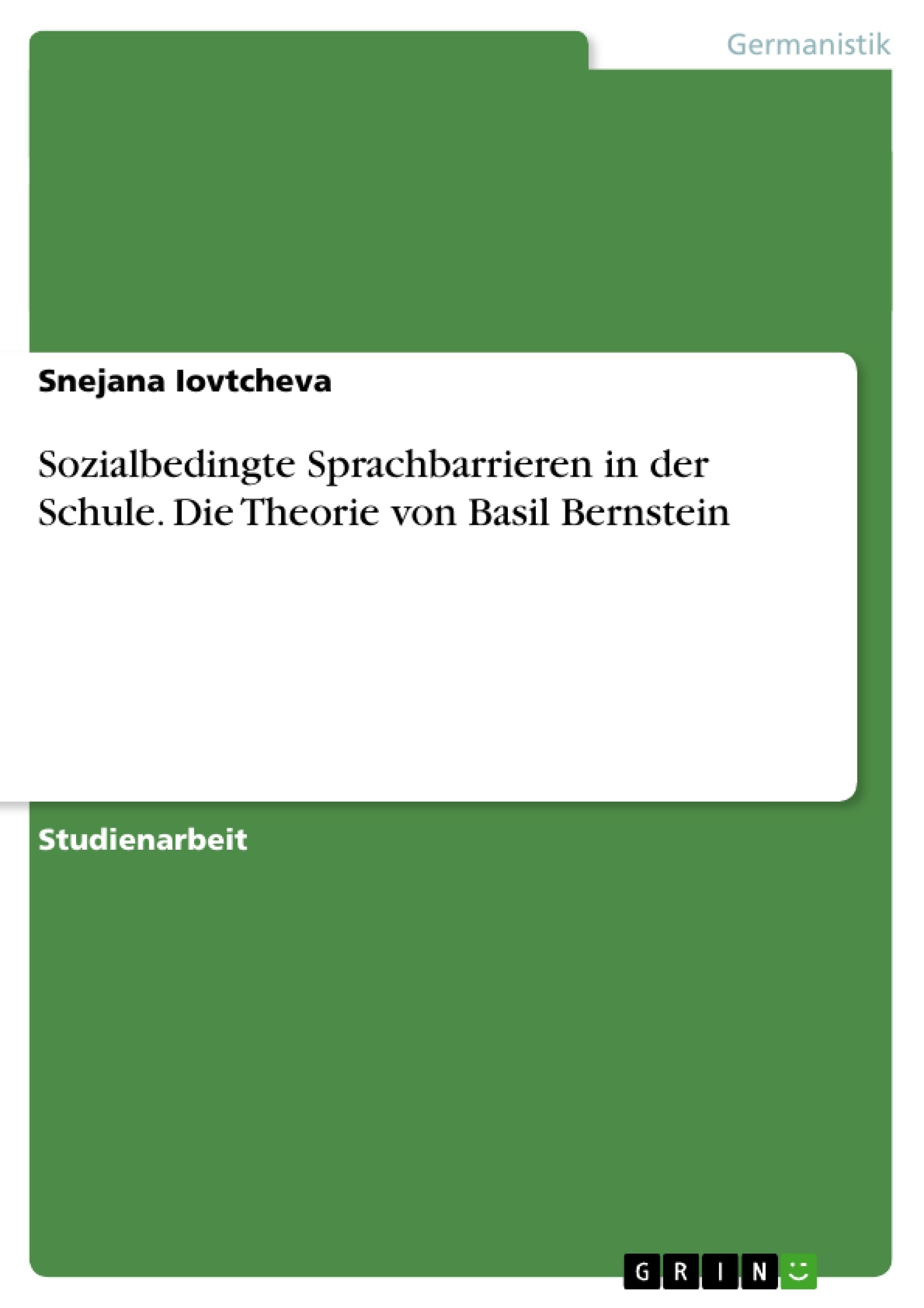Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Darstellung eines der Teilgebiete der Soziolinguistik, nämlich die Erforschung des schichtenspezifischen Sprachverhalten und die existierenden Kommunikationshemmungen zwischen den verschiedenen Schichten einer Gesellschaft. Mitte der 50er und Anfang der 60er Jahre des 20 Jahrhunderts begann das Interesse zu diesem Thema zu wachsen und erfuhr einen regelrechten Boom in den 70er Jahren. Die bildungspolitische Situation weltweit fand zu dieser Zeit ihren Ausdruck in Schlagwörtern wie ‚Mobilisierung der Bildungsreserven’, ‚Chancengleichheit’, ‚kompensatorische Erziehung’ und ähnlichen. Die vorliegende Arbeit behandelt die Ansätze des britischen Bildungssoziologen Basil Bernstein - die s.g. „Theorie der linguistischen Codes“, auch bekannt als „Defizit-Hypothese“. Dazu ist vorab anzumerken, dass Bernstein zwischen 1958 und 1972 etwa 30 Aufsätze verfasst hat, in denen er stets den Grundgedanken seiner Theorie definitorisch und konzeptuell modifiziert hat. Somit wird hier keineswegs der Anspruch erhoben, die Konzeption von Bernstein komplex und vollständig zu erfassen. Dennoch wird versucht, die wesentlichsten Ergebnisse seiner empirischen Arbeiten, wichtigsten Hypothesen, und theorethischen Verhältnis zur Relativitäts- oder „Sapir-Whorf-Hypothese“, darzustellen. Behandelt werden die Merkmale des sozialbedingten Spracharten (Codes), die Rolle der Kommunikationsweise innerhalb sozialer Schicht und Famile, sowie die Rolle der sozialen Kontrolle innerhalb Schicht und Familie. Zusätzlich werden die Konsequenzen auf Schulerfolg und Wirksamkeit von kompensatorischen Erziehung diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Basil Bernsteins Theorie schichtenspezifischen Sprachverhaltens
- Bernstein und die Saphir-Whorf-Hypothese
- Erste Phase der Theorie Bernsteins 1958-1962
- Empirische Untersuchungen
- Merkmale der sprachlichen Kodes
- Bernsteins Erklärung der Sprachkodes aus der Sozialstruktur
- Die Beziehung zwischen Kognition und sozialer Schicht
- Offene und geschlossene Kommunikationssysteme
- Status- und personen-orientierte Familien
- Die Rolle der sozialen Kontrolle innerhalb der beiden Familientypen
- Der Einfluss der Herkunftsfamilie auf den Schulerfolg der Kinder
- Die kompensatorische Erziehung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, Basil Bernsteins Theorie des schichtenspezifischen Sprachverhaltens darzustellen und zu analysieren. Sie beleuchtet die Entwicklung seiner Theorie, seine empirischen Untersuchungen und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen bezüglich der Beziehung zwischen Sprache, sozialer Schicht und Bildungserfolg.
- Bernsteins Code-Theorie (elaborierter und restringierter Code)
- Der Zusammenhang zwischen Sprachgebrauch und sozialer Schicht
- Der Einfluss der Familie auf den Spracherwerb und den Schulerfolg
- Die Relevanz von Bernsteins Theorie für die kompensatorische Erziehung
- Bernsteins Bezug zur Sapir-Whorf-Hypothese
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Feld der Soziolinguistik ein und beschreibt den Fokus der Arbeit auf Basil Bernsteins Theorie des schichtenspezifischen Sprachverhaltens. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Forschungsinteresses an diesem Thema und die Relevanz von Bernsteins Arbeit im Kontext bildungspolitischer Diskussionen um Chancengleichheit und kompensatorische Erziehung. Die Einleitung gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit und die behandelten Kapitel.
Basil Bernsteins Theorie schichtenspezifischen Sprachverhaltens: Dieses Kapitel stellt Basil Bernsteins Theorie der linguistischen Codes vor, auch bekannt als „Defizit-Hypothese“. Es beschreibt die zentrale These Bernsteins, dass Unterschicht und Mittelschicht unterschiedliche Sprachvarianten verwenden, die in schichtenspezifischen Sozialbeziehungen wurzeln und kognitive Möglichkeiten beeinflussen. Die Unterscheidung zwischen „elaborated code“ und „restricted code“ wird erläutert, sowie der Versuch Bernsteins, soziolinguistische und psycholinguistische Ansätze zu verbinden. Das Kapitel betont die Entwicklung von Bernsteins Theorie und die Anpassungen aufgrund kollegialer Kritik.
Bernstein und die Saphir-Whorf-Hypothese: Dieses Kapitel untersucht die Beziehung zwischen Bernsteins Theorie und der Sapir-Whorf-Hypothese, die besagt, dass Sprache Wahrnehmung und Denken beeinflusst. Es wird dargelegt, wie Bernstein die Sapir-Whorf-Hypothese aufgreift und erweitert, indem er schichtenspezifische Unterschiede im Sprachgebrauch innerhalb einer einzigen Sprache und Kultur nachweist. Der Fokus liegt auf Bernsteins Argumentation, dass soziale Schicht die Sprachform prägt und damit auch kognitive Prozesse beeinflusst.
Erste Phase der Theorie Bernsteins 1958-1962: Dieses Kapitel beschreibt die empirischen Untersuchungen Bernsteins in der ersten Phase seiner Forschung (1958-1962). Es werden die Methoden und Ergebnisse dieser Studien vorgestellt und die Charakteristika des „elaborierten“ und „restringierten“ Codes im Detail erläutert. Der Abschnitt veranschaulicht den methodischen Ansatz Bernsteins und seine ersten Erkenntnisse zur Beziehung zwischen sozialer Schicht und Sprachcode.
Bernsteins Erklärung der Sprachkodes aus der Sozialstruktur: Dieses Kapitel analysiert Bernsteins Erklärung für die Entstehung der beiden Sprachcodes aus den unterschiedlichen Sozialstrukturen. Es wird die Beziehung zwischen Kognition und sozialer Schicht, die Unterscheidung zwischen offenen und geschlossenen Kommunikationssystemen sowie die Rolle von Status- und personenorientierten Familien ausführlich diskutiert. Der Zusammenhang zwischen den Familienstrukturen und dem Spracherwerb wird in diesem Kapitel besonders betont.
Der Einfluss der Herkunftsfamilie auf den Schulerfolg der Kinder: Dieses Kapitel behandelt den Zusammenhang zwischen der Herkunftsfamilie, dem Sprachgebrauch und dem Schulerfolg von Kindern im Lichte von Bernsteins Theorie. Es wird untersucht, wie die unterschiedlichen Sprachcodes den Zugang zum Bildungssystem und den Lernerfolg beeinflussen und welche Implikationen sich daraus für bildungspolitische Maßnahmen ergeben.
Schlüsselwörter
Soziolinguistik, Basil Bernstein, Code-Theorie, elaborierter Code, restringierter Code, Schichtenspezifisches Sprachverhalten, soziale Schicht, Spracherwerb, Bildungserfolg, kompensatorische Erziehung, Sapir-Whorf-Hypothese, Kommunikationssysteme, Familienstrukturen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Basil Bernsteins Theorie schichtenspezifischen Sprachverhaltens
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit Basil Bernsteins Theorie des schichtenspezifischen Sprachverhaltens. Sie analysiert die Entwicklung seiner Theorie, seine empirischen Untersuchungen und die Schlussfolgerungen zur Beziehung zwischen Sprache, sozialer Schicht und Bildungserfolg.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem Bernsteins Code-Theorie (elaborierter und restringierter Code), den Zusammenhang zwischen Sprachgebrauch und sozialer Schicht, den Einfluss der Familie auf Spracherwerb und Schulerfolg, die Relevanz von Bernsteins Theorie für die kompensatorische Erziehung und den Bezug zu der Sapir-Whorf-Hypothese.
Was ist Bernsteins Code-Theorie?
Bernsteins Code-Theorie beschreibt die Unterscheidung zwischen „elaboriertem Code“ (flexibel, komplex, situationsunabhängig) und „restringiertem Code“ (einfach, kontextabhängig, repetitiv), die mit unterschiedlichen sozialen Schichten in Verbindung gebracht werden. Die Theorie besagt, dass diese Sprachvarianten in schichtenspezifischen Sozialbeziehungen verwurzelt sind und kognitive Möglichkeiten beeinflussen.
Wie erklärt Bernstein den Ursprung der Sprachcodes?
Bernstein erklärt den Ursprung der Sprachcodes durch unterschiedliche Sozialstrukturen. Er untersucht die Beziehung zwischen Kognition und sozialer Schicht, die Unterscheidung zwischen offenen und geschlossenen Kommunikationssystemen sowie die Rolle von Status- und personenorientierten Familien. Familienstrukturen spielen eine entscheidende Rolle im Spracherwerb.
Welchen Einfluss hat die Familie auf den Schulerfolg?
Laut Bernsteins Theorie beeinflusst die Herkunftsfamilie und der damit verbundene Sprachgebrauch den Schulerfolg von Kindern maßgeblich. Unterschiedliche Sprachcodes erschweren oder erleichtern den Zugang zum Bildungssystem und beeinflussen den Lernerfolg. Dies hat Implikationen für bildungspolitische Maßnahmen.
Welchen Bezug hat Bernsteins Theorie zur Sapir-Whorf-Hypothese?
Bernsteins Theorie greift die Sapir-Whorf-Hypothese auf, die besagt, dass Sprache Wahrnehmung und Denken beeinflusst. Bernstein erweitert diese Hypothese, indem er schichtenspezifische Unterschiede im Sprachgebrauch innerhalb einer einzigen Sprache und Kultur nachweist. Er argumentiert, dass soziale Schicht die Sprachform und damit auch kognitive Prozesse prägt.
Welche empirischen Untersuchungen wurden durchgeführt?
Die Arbeit beschreibt die empirischen Untersuchungen Bernsteins in der ersten Phase seiner Forschung (1958-1962). Methoden und Ergebnisse dieser Studien werden vorgestellt, und die Charakteristika des „elaborierten“ und „restringierten“ Codes werden detailliert erläutert.
Was ist die Bedeutung von Bernsteins Theorie für die kompensatorische Erziehung?
Bernsteins Theorie ist relevant für die kompensatorische Erziehung, da sie aufzeigt, wie schichtenspezifische Sprachunterschiede den Bildungserfolg beeinflussen können. Seine Erkenntnisse liefern Ansatzpunkte für pädagogische Interventionen, um Benachteiligungen auszugleichen.
Welche Schlüsselwörter sind mit dieser Arbeit verbunden?
Schlüsselwörter sind: Soziolinguistik, Basil Bernstein, Code-Theorie, elaborierter Code, restringierter Code, Schichtenspezifisches Sprachverhalten, soziale Schicht, Spracherwerb, Bildungserfolg, kompensatorische Erziehung, Sapir-Whorf-Hypothese, Kommunikationssysteme, Familienstrukturen.
- Quote paper
- Snejana Iovtcheva (Author), 2004, Sozialbedingte Sprachbarrieren in der Schule. Die Theorie von Basil Bernstein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34461